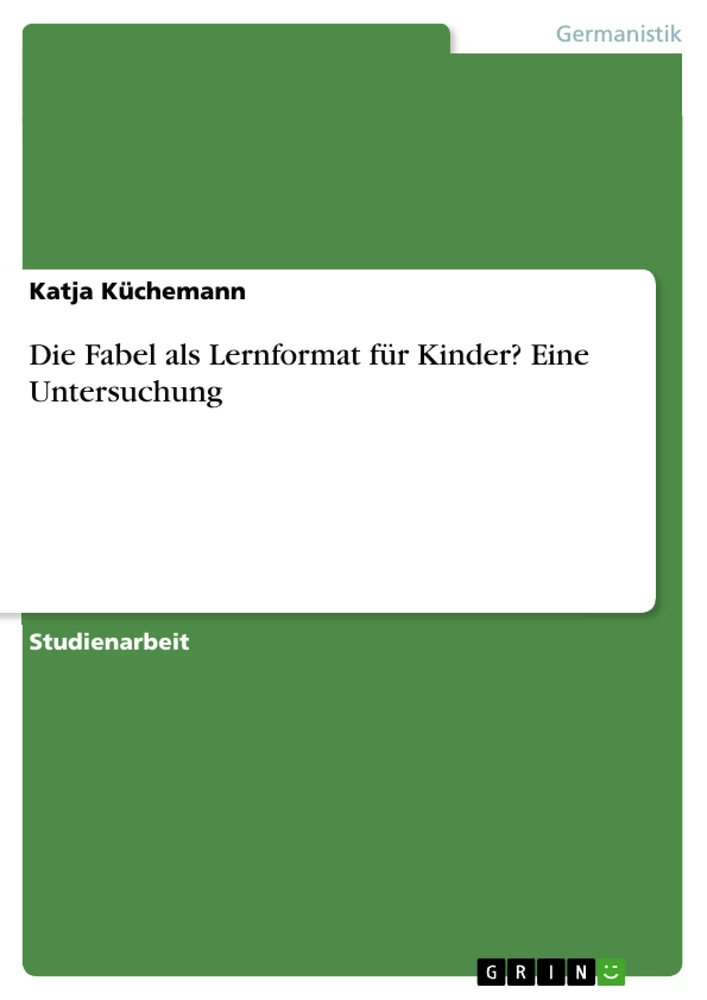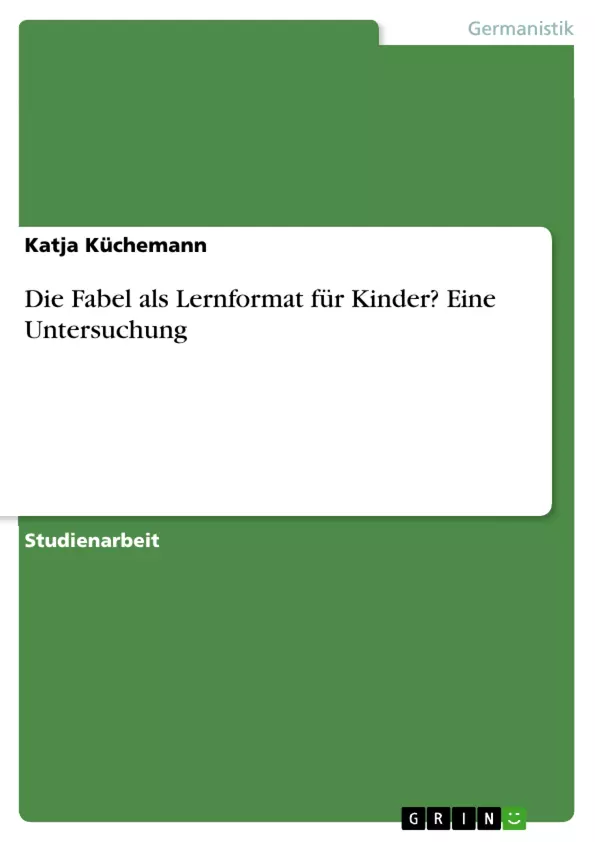Der Wolf kam zum Bach. Da entsprang das Lamm.
„Bleib nur, du störst mich nicht", rief der Wolf.
„Danke", rief das Lamm zurück, „ich habe im Äsop gelesen."
(Helmut Arntzen)
Eine typische, klassische Fabel ist kurz und pointiert, leicht zu merken - wie ein guter Witz. Der Begriff Fabel ruft bei vielen Menschen zunächst die Assoziation Tierfabel hervor, obwohl sie sich nicht nur auf die Welt der Tiere, sondern auch auf die gesam-te belebte und unbelebte Natur, sowie die Menschen- und Götterwelt bezieht. Die handelnden Figuren innerhalb einer Fabel stellen überwiegend dem Leser bekannte Tiere dar. Grund hierfür sind der Bekanntheitsgrad dieser Tiere, da sie aus der Umgebung des Menschen stammen und keiner weiteren Beschreibung bedürfen, sowie die Verkörperung bestimmter Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sich auch in Sprichwörtern und Redensarten finden lassen. Tiere als Akteure besitzen kein Eigen-leben, sondern dienen der Demonstration bestimmter menschlicher Verhaltenswei-sen.
Die Fabel selbst hat viele Gesichter und eine lange Geschichte (von der Antike bis zur Moderne). Sie „ist von jeher eine volkstümliche Gattung, sie will auch den an-sprechen, der „nicht viel Verstand besitzt“ (Ch. F. Gellert). Aber bei aller poetischer Einkleidung (sprechende Tiere!) verlangt sie doch einen denkenden, kritischen Hörer, der die Übertragung aus dem fiktiven Bereich auf seine Wirklichkeit vornimmt. Die Fabel erweist sich damit als eine die ratio ansprechende Gattung.“
Jede Fabel, ob kurz oder lang, enthält eine Lehre, die sowohl vor- oder nachgestellt werden kann oder vom Leser selbst zu suchen ist. Oftmals ist sie Bestandteil der Fabelerzählung und wird einer Figur in den Mund gelegt.
Aufgrund der Kürze und meist leichten Verständlichkeit des Textes ist die Fabel besonders für Kinder im Grundschulalter geeignet und regt zum kritischen Denken und Handeln an. Ist das wirklich so? Innerhalb dieser Hausarbeit soll versucht werden, dieser Frage auf den Grund zu gehen und eine entsprechende Antwort zu finden.
Um einen theoretischen Hintergrund zu schaffen wird zunächst die Gattung Fabel genauer beleuchtet, was eine Begriffserklärung, einen geschichtlichen Rückblick, sowie die Analyse ihrer Strukturmerkmale (Umfang, Aufbau etc.) mit einbezieht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Wort und Begriff
- Die Geschichte der Fabel
- Entstehung der Fabel
- Die griechisch – römische Fabel
- Aesop
- Phädrus
- Die orientalische Fabel
- Panschatantra
- Deutsches Mittelalter
- Sticker
- Ulrich Boner
- Zeitalter der Reformation
- Martin Luther
- Jean de La Fontaine
- Zeitalter der Aufklärung
- Christian Fürchtegott Gellert
- Gotthold Ephraim Lessing
- Das 19. Jahrhundert
- Wilhelm Busch
- Wilhelm Hey
- Das 20. Jahrhundert
- James Thurber
- Strukturmerkmale
- Umfang der Fabel
- Aufbau der Fabel
- Handelnde Figuren und ihre Eigenschaften
- Die Anzahl der Akteure
- Die Typisierung der Fabeltiere
- Die Vermenschlichung der Fabelfiguren
- Sprachliche Charakteristika der Fabel
- Abgrenzung von verwandten Gattungsformen
- Fabel und Parabel
- Fabel und Märchen
- Stilzüge der Fabel
- Belehrender Stil
- Kritisierender Stil
- Satirischer Stil
- Aufbautypen der Fabel
- Die Normalform und ihre Abwandlungen
- Die Sonderform bei Alberus
- Die Kunstfabel
- Fabel und Schule
- Die Bedeutung der Fabel für die Schule
- Einsatz der Fabel im Unterricht
- Die Altersfrage
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fabel als literarische Gattung. Ziel ist es, die Fabel umfassend zu betrachten, von ihrer Geschichte über ihre Strukturmerkmale bis hin zu ihrem Einsatz im Schulunterricht. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Fabel über verschiedene Epochen und Kulturen.
- Begriff und Definition der Fabel
- Geschichtliche Entwicklung der Fabel
- Strukturmerkmale und Stilmittel der Fabel
- Didaktischer Aspekt und Einsatz im Unterricht
- Abgrenzung zu verwandten Gattungen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach der Eignung von Fabeln für den Grundschulunterricht. Es hebt die Kürze, Prägnanz und leichte Verständlichkeit der Fabel hervor, hinterfragt aber gleichzeitig die Annahme, dass alle Fabeln automatisch zum kritischen Denken anregen.
Wort und Begriff: Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Begriffserklärung des Wortes „Fabel“, untersucht verschiedene Bezeichnungen der Gattung über die Jahrhunderte hinweg und zeigt die Schwierigkeiten auf, eine eindeutige Definition zu finden, die für alle Epochen und Autorentypen gleichermaßen gültig ist. Es wird deutlich, dass die Interpretation des Begriffs „Fabel“ je nach Autor und Epoche variiert.
Die Geschichte der Fabel: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Fabel, beginnend mit ihrer Entstehung und ihren griechischen und römischen Wurzeln (Aesop, Phädrus), über die orientalische Fabel (Panschatantra) bis hin zu ihrer Entwicklung im deutschen Mittelalter (Sticker, Ulrich Boner), der Reformationszeit (Luther, La Fontaine), der Aufklärung (Gellert, Lessing) und dem 19. und 20. Jahrhundert (Busch, Hey, Thurber). Es wird die Entwicklung des Fabelverständnisses und der Stilmittel über die verschiedenen Epochen hinweg deutlich gemacht.
Strukturmerkmale: Dieses Kapitel analysiert die formalen Elemente der Fabel. Es untersucht den Umfang, den Aufbau, die handelnden Figuren (Anzahl, Typisierung, Vermenschlichung), die sprachlichen Charakteristika und die Abgrenzung zu verwandten Gattungen wie Parabeln und Märchen. Die Analyse legt den Fokus auf die typischen Merkmale, die eine Fabel ausmachen.
Stilzüge der Fabel: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die verschiedenen Stilmittel, die in Fabeln verwendet werden. Die drei Haupttypen – belehrender, kritisierender und satirischer Stil – werden erläutert, um zu zeigen, wie die moralische Botschaft auf unterschiedliche Weise vermittelt wird. Die Analyse beleuchtet die Vielschichtigkeit der Stilmittel und deren Wirkung auf den Leser.
Aufbautypen der Fabel: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aufbautypen von Fabeln, insbesondere die Normalform und ihre Variationen, die Sonderform bei Alberus und die Kunstfabel. Die Diskussion beleuchtet die Vielfalt in der Struktur und zeigt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Fabeln auf. Der Fokus liegt auf den strukturellen Besonderheiten der jeweiligen Typen.
Fabel und Schule: Der letzte zusammenfassende Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung und dem Einsatz von Fabeln im Schulunterricht. Es werden die Relevanz der Fabel für die pädagogische Arbeit, sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht und die Frage des altersgerechten Umgangs mit Fabeln erörtert. Der Text beleuchtet, wie Fabeln zur Förderung des kritischen Denkens beitragen können.
Schlüsselwörter
Fabel, Tierfabel, Aesop, Phädrus, Didaktik, Moral, Strukturmerkmale, Stilmittel, Gattungsgeschichte, Schulunterricht, Kinderliteratur, kritisches Denken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Fabel - Eine literarische Gattungsanalyse"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse der Fabel als literarische Gattung. Sie behandelt die Geschichte der Fabel, ihre Strukturmerkmale, Stilmittel, verschiedene Aufbautypen und ihre Bedeutung im Schulunterricht. Der Fokus liegt auf einer detaillierten Betrachtung der Fabel von ihren Ursprüngen bis zur Gegenwart, inklusive didaktischer Aspekte.
Welche Epochen und Autoren werden behandelt?
Die Arbeit verfolgt die Geschichte der Fabel von ihren Anfängen in der griechischen und römischen Antike (Aesop, Phädrus) über die orientalische Fabel (Panschatantra) bis ins deutsche Mittelalter (Sticker, Ulrich Boner), die Reformationszeit (Luther, La Fontaine), die Aufklärung (Gellert, Lessing) und das 19. und 20. Jahrhundert (Busch, Hey, Thurber). Die Entwicklung des Fabelverständnisses und der Stilmittel wird über die verschiedenen Epochen hinweg nachvollzogen.
Welche Strukturmerkmale der Fabel werden analysiert?
Die Analyse der Strukturmerkmale umfasst den Umfang, den Aufbau, die handelnden Figuren (Anzahl, Typisierung, Vermenschlichung), die sprachlichen Charakteristika und die Abgrenzung zu verwandten Gattungen wie Parabeln und Märchen. Es wird untersucht, welche Merkmale eine Fabel ausmachen.
Welche Stilmittel werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Stilmittel der Fabel, insbesondere den belehrenden, kritisierenden und satirischen Stil. Die Vielschichtigkeit der Stilmittel und deren Wirkung auf den Leser wird beleuchtet.
Welche verschiedenen Aufbautypen von Fabeln werden vorgestellt?
Die Analyse der Aufbautypen umfasst die Normalform und ihre Variationen, die Sonderform bei Alberus und die Kunstfabel. Die Vielfalt in der Struktur und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Fabeln werden hervorgehoben.
Welche Bedeutung hat die Fabel im Schulunterricht?
Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung und dem Einsatz von Fabeln im Schulunterricht. Es werden die Relevanz der Fabel für die pädagogische Arbeit, deren Einsatzmöglichkeiten und die Frage des altersgerechten Umgangs mit Fabeln erörtert. Die Förderung des kritischen Denkens durch Fabeln wird beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Fabel, Tierfabel, Aesop, Phädrus, Didaktik, Moral, Strukturmerkmale, Stilmittel, Gattungsgeschichte, Schulunterricht, Kinderliteratur und kritisches Denken.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels: Vorwort, Wort und Begriff, Die Geschichte der Fabel, Strukturmerkmale, Stilzüge der Fabel, Aufbautypen der Fabel und Fabel und Schule. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt der einzelnen Kapitel.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das HTML-Dokument enthält ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, das alle Kapitel und Unterkapitel übersichtlich auflistet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist eine umfassende Betrachtung der Fabel, von ihrer Geschichte und Struktur bis hin zu ihrem didaktischen Einsatz im Unterricht. Die Entwicklung der Fabel über verschiedene Epochen und Kulturen wird beleuchtet.
- Quote paper
- Katja Küchemann (Author), 2006, Die Fabel als Lernformat für Kinder? Eine Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/64324