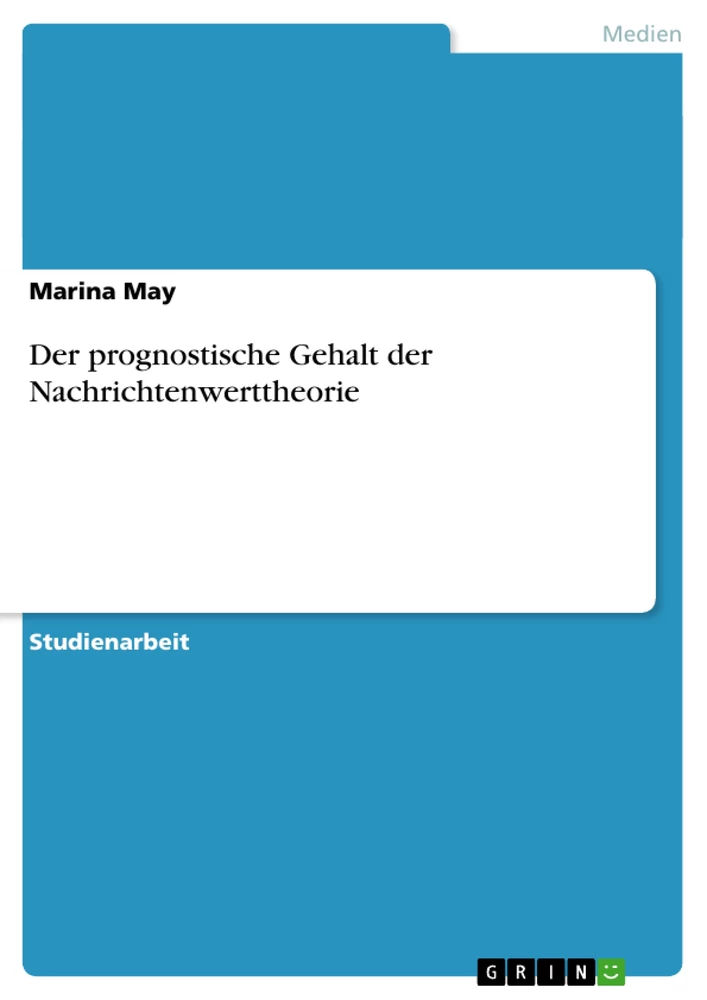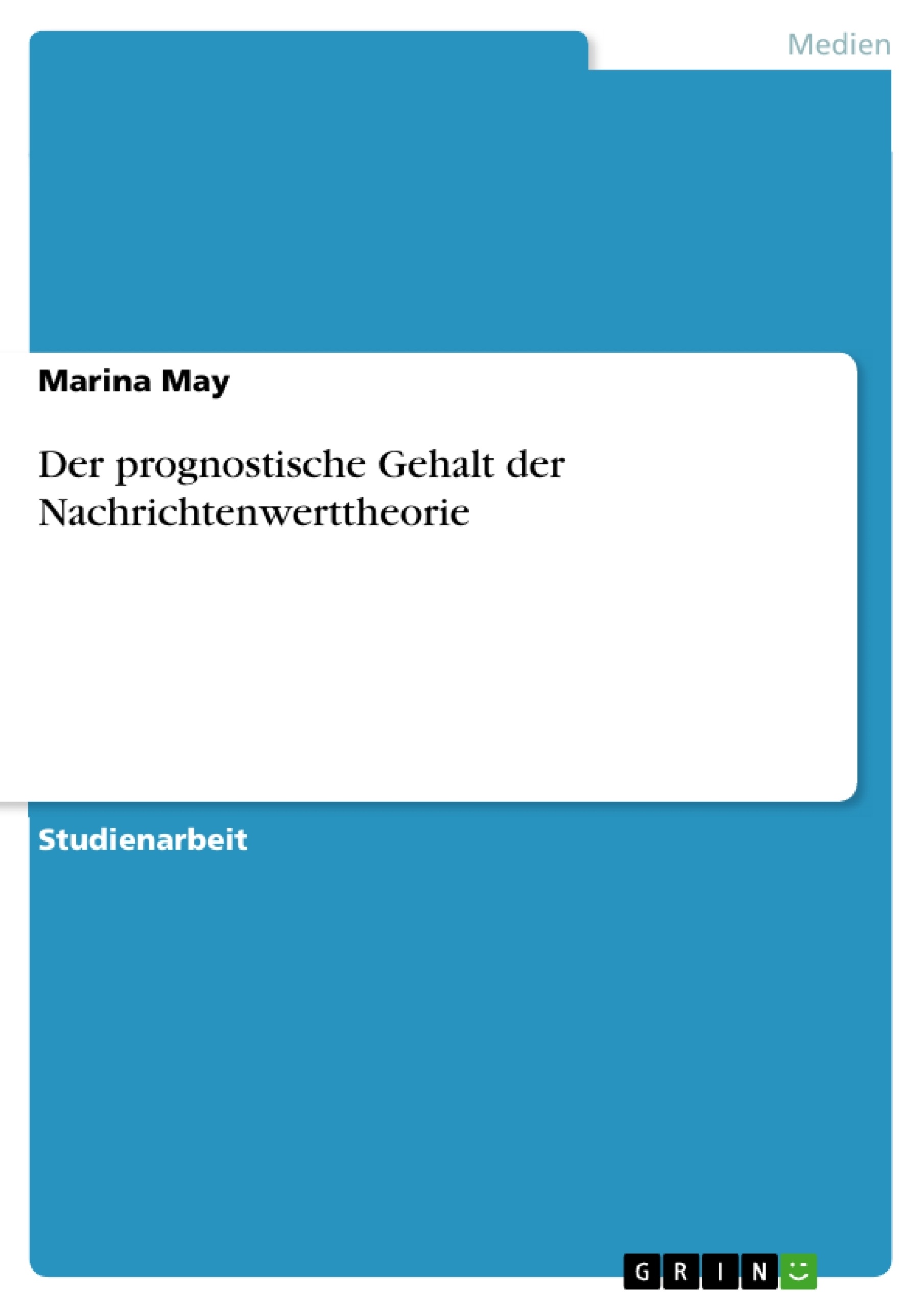Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem prognostischen Gehalt der Nachrichtenwerttheorie. Diese Theorie, die ihre Anfänge schon in den 20er Jahren hat und sich in den 50ern weitläufige Popularität verschafft hat, scheiterte lange an ihrer Nichthinterfragung. So versagt sie in allen Bereichen, die eine Theorie ausmacht: in der Erklärung und in der Prognose.
Nach einer Neuformulierung der Studie durch Schulz in den 70er Jahren und mehreren Studien in den 80er und 90er Jahren, wurde die Grundlage geschaffen, der Nachrichtenwerttheorie einen neuen Weg zu bahnen.
Wegweisend ist dann vor allem eine Studie von Kepplinger und Bastian aus dem Jahre 2000, die versucht haben, nicht unbedingt auf Erklärung zielend, sondern eher auf eine Explizierung der Theorie, den Umfang von Meldungen zu prognostizieren.
Diese Arbeit möchte nun zuerst durch einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung der Nachrichtenwerttheorie an die ihr innewohnende Problematik heranführen und die lange von ihren Vertretern angenommene raum-, zeit- und kontextunabhängige Gültigkeit in Frage stellen. Im folgenden soll dann ein Weg aufgezeigt werden, um einen Ausweg aus dieser Stagnation zu bahnen. Als Grundlage dient hierfür ein von Hans Matthias Kepplinger und Rouwen Bastian entwickeltes Analysesystem und eine Langzeituntersuchung der Deutschlandberichterstattung der Jahre 1951 bis 1995.
Zum Abschluss der Arbeit soll noch mal ein Ausblick gegeben werden auf neu eröffnete Möglichkeiten, die diese Theorie bietet.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rückblick und Paradigmenwechsel
- Die Nachrichtenwert-Theorie-Eine raum-, zeit-, kontextunabhängige Theorie?
- Das 2-Komponentenmodell
- Ein Analysemodell (Kepplinger, Bastian)
- Die Ermittlung des Nachrichtenwertes
- Grundlage der Untersuchung
- Nachrichtenwert der Nachrichtenwerttheorie
- Eine Langzeituntersuchung: 1951-1995
- Verkürzung des Untersuchungszeitraumes: 1981-1995
- Erstellung einer Prognose
- Fazit und Ausblick
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den prognostischen Gehalt der Nachrichtenwerttheorie. Sie untersucht die historische Entwicklung der Theorie und ihre kritische Hinterfragung, insbesondere im Hinblick auf ihre vermeintliche raum-, zeit- und kontextunabhängige Gültigkeit. Die Arbeit erörtert ein neu entwickeltes Analysemodell, das versucht, den Umfang von Meldungen zu prognostizieren, und untersucht die Möglichkeiten, die die Theorie in der Zukunft bietet.
- Entwicklung und Kritik der Nachrichtenwerttheorie
- Raum-, Zeit- und Kontextunabhängigkeit der Theorie
- Entwicklung eines neuen Analysemodells
- Prognose des Umfangs von Meldungen
- Zukünftige Möglichkeiten der Nachrichtenwerttheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und erläutert die Problematik der Nachrichtenwerttheorie in ihrer bisherigen Anwendung.
Das zweite Kapitel bietet einen historischen Rückblick auf die Entwicklung der Nachrichtenwerttheorie und beleuchtet die Veränderungen im Paradigma. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Theorie tatsächlich raum-, zeit- und kontextunabhängig ist.
Das dritte Kapitel stellt ein 2-Komponentenmodell vor, das die Nachrichtenwerttheorie neu definiert. Es soll die Stagnation der Theorie überwinden und einen Weg für eine neue Anwendung aufzeigen.
Das vierte Kapitel analysiert ein spezifisches Analysemodell von Kepplinger und Bastian. Dieses Modell soll den Umfang von Meldungen prognostizieren und wird anhand einer Langzeituntersuchung der Deutschlandberichterstattung der Jahre 1951 bis 1995 untersucht. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Prognosemöglichkeiten der Nachrichtenwerttheorie diskutiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Nachrichtenwerttheorie, Prognose, Medienforschung, Nachrichtenauswahl, Analysemodell, Kepplinger, Bastian, Langzeituntersuchung, Deutschlandberichterstattung.
- Quote paper
- Marina May (Author), 2002, Der prognostische Gehalt der Nachrichtenwerttheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/6295