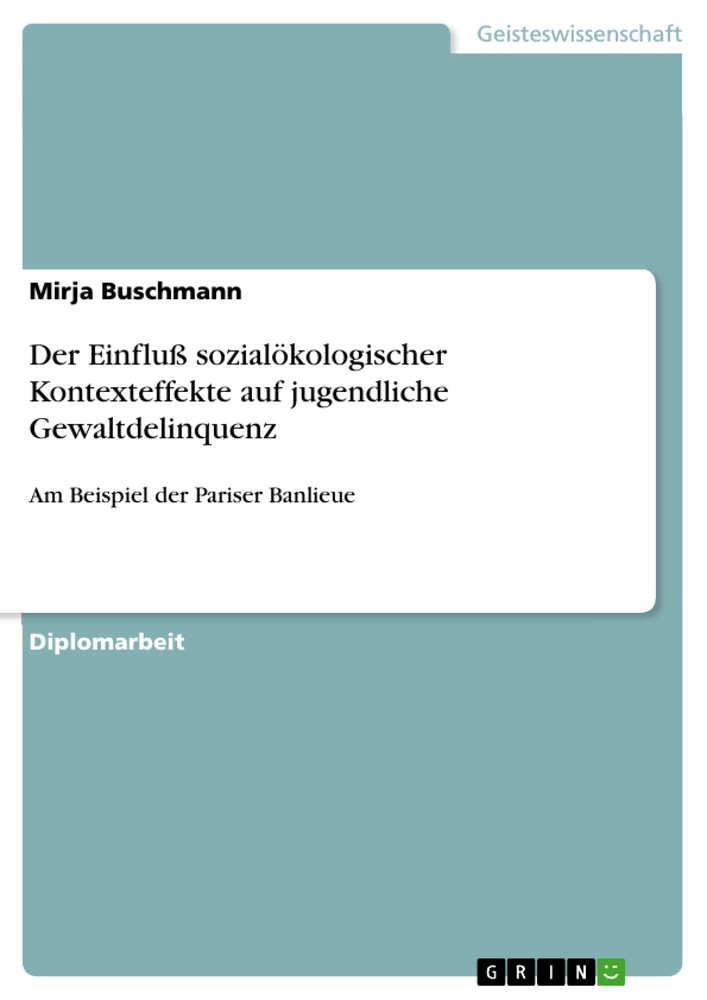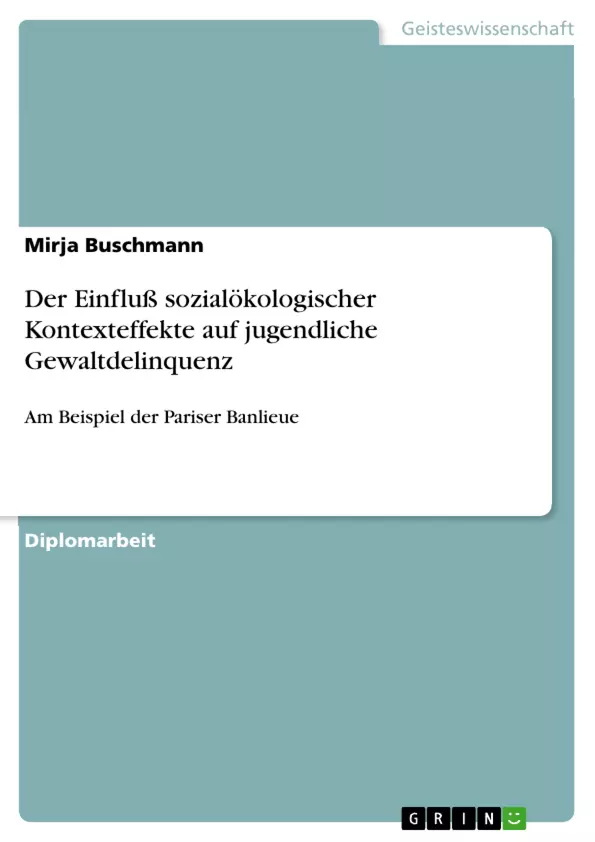Statt Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gibt es für ‚banlieusards’, das Vorortvolk, Elend, Resignation und Isolation […] Frankreich hat eine ganze Generation verloren. Im tristen Zustand der Außenbezirke lebt eine entwurzelte Jugend, die sich ziellos herumtreibt. Die, die in den cités der banlieue existieren, haben den Zug verpasst, der vielleicht nie vorbei gekommen ist […] Ihr Protest ist vorgezeichnet. (François Maspero 1993)
Im Oktober und November 2005 kam es zu den bislang stärksten gewalttätigen Ausschreitungen in der Pariser banlieue. Auslöser für die Gewalt war der Unfalltod zweier Jugendlicher afrikanischer Herkunft, die am 27. Oktober 2005 bei der Flucht vor der Polizei2 versucht hatten, eine Transformatorstation zu überwinden und dabei von Stromschlägen tödlich getroffen wurden und verbrannten. Als Reaktion auf dieses Ereignis zündeten Jugendgangs in dem Pariser Vorort Clichy-sous-Bois, in dem die verstorbenen Jugendlichen beheimatet waren, mehrere Fahrzeuge an. Es kam zu einer Reihe zunächst unorganisierter Sachbeschädigungen und Brandstiftungen an Autos und zahlreichen öffentlichen Gebäuden, wie Kindergärten, Schulen und Stadtteilzentren, sowie christlichen und muslimischen Einrichtungen. Die Unruhen, die ausschließlich nachts stattfanden, griffen schnell auf andere Pariser Vororte und Anfang November schließlich auch auf andere französische Städte wie Lyon, Toulouse und Straßburg über. Im Verlauf der Ausschreitungen fanden dabei auch fortwährend gewalttätige Zusammenstöße zwischen der Polizei und den Jugendlichen statt, in deren Folge 126 Polizisten verletzt wurden. Darüber hinaus wurde am 6. November 2005 auch ein Zivilist Opfer der Gewaltakte, als ein Passant im Pariser Vorort Stains den Verletzungen erlag, die Jugendliche ihm zugefügt hatten. Ausgeführt wurden diese Aktionen überwiegend von Gruppen männlicher3 Jugendlicher mit Migrationshintergrund, vor allem aus dem Mahgreb und dem subsaharischen Afrika, die in vielen Vororten der Pariser banlieue in der Mehrheit sind.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Anlass zur Arbeit: die französischen Unruhen 2005
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Ursachen von Kriminalität und Delinquenz aus sozialökologischer Sicht
- 2.1 Klassische Theorien sozialer Desorganisation der Chicago School
- 2.1.1 Parks und Burgess „Concentric Zone Theory“
- 2.1.2 Shaws und McKays „Cultural Transmission Theory“
- 2.1.3 Legitimation und Bedeutung der klassischen Theorien sozialer Desorganisation
- 2.2 Moderne sozialökologische Ansätze
- 2.2.1 Wilsons und Kellings „Broken Windows Theory“ und die Nulltoleranzstrategie
- 2.2.2 Sampsons Ansatz kollektiver Wirksamkeit
- 2.3 Implikationen sozialökologischer Ansätze
- 3. Die Pariser banlieue
- 3.1 Die Entstehung und Entwicklung der Pariser banlieue
- 3.2 Die Sozialstruktur der Pariser banlieue
- 3.3 Segregation und Ausgrenzung
- 3.3 Die Jugendlichen der banlieue - les jeunes
- 4. Kriminalität und jugendlicher Gewaltdelinquenz in der banlieue
- 4.1 Definition von jugendlicher Gewaltdelinquenz
- 4.2 Generelle Entwicklung jugendlicher Gewaltdelinquenz in der banlieue
- 4.3 Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht
- 4.4 Kriminalitätskontrolle und Sicherheitspolitik
- 4.5 Polizeigewalt und Rassismus
- 5. Anwendung sozialökologischer Ansätze auf jugendliche Gewaltdelinquenz in der Pariser banlieue
- 5.1 Wandel des urbanen Raums - vom Chicago der 1920er Jahre zum Paris des 21. Jahrhunderts
- 5.2 Leistungsfähigkeit sozialökologischer Ansätze bei der Umsetzung in der sozialen Praxis
- 5.3 Erweiterungen sozialökologischer Ansätze – Verbindungen mit anderen kriminalsoziologischen Theorien
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einfluss sozialökologischer Kontexteffekte auf jugendliche Gewaltdelinquenz in den Pariser Banlieues. Ziel ist es, bestehendes Wissen zu kriminologischen Theorien mit der konkreten Situation in den Vorstädten zu verknüpfen und die Erklärungskraft sozialökologischer Ansätze zu evaluieren.
- Sozialökologische Theorien der Kriminalität (Chicago School, Broken Windows Theory, Kollektive Wirksamkeit)
- Sozioökonomische Bedingungen und Segregation in den Pariser Banlieues
- Jugendliche Gewaltdelinquenz als Ausdruck sozialer Ausgrenzung
- Die Rolle von Polizei und Sicherheitspolitik
- Übertragbarkeit sozialökologischer Ansätze auf den Kontext der Pariser Banlieues
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt den Anlass der Arbeit: die französischen Unruhen von 2005 in den Pariser Banlieues. Es werden die Auslöser, der Verlauf und die Folgen der Unruhen detailliert dargestellt und die Notwendigkeit einer sozialökologischen Betrachtungsweise begründet. Das Kapitel skizziert die Zielsetzung der Arbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau.
2. Ursachen von Kriminalität und Delinquenz aus sozialökologischer Sicht: Dieses Kapitel präsentiert klassische und moderne sozialökologische Theorien der Kriminalität. Es werden die „Concentric Zone Theory“ von Parks und Burgess, die „Cultural Transmission Theory“ von Shaw und McKay sowie die „Broken Windows Theory“ von Wilson und Kelling und Sampsons Ansatz der kollektiven Wirksamkeit vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf der Erklärung von Kriminalität durch räumliche und soziale Faktoren.
3. Die Pariser banlieue: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung, Entwicklung und Sozialstruktur der Pariser Banlieues. Es analysiert die Prozesse von Segregation und Ausgrenzung, die zu spezifischen Lebensbedingungen für die dort lebenden Jugendlichen führen. Die soziale Lage und die Herausforderungen der „les jeunes“ werden im Detail beleuchtet.
4. Kriminalität und jugendlicher Gewaltdelinquenz in der banlieue: Dieses Kapitel widmet sich der jugendlichen Gewaltdelinquenz in den Pariser Banlieues. Es definiert den Begriff, analysiert die generelle Entwicklung, betrachtet Aspekte der Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht und untersucht die Rolle von Kriminalitätskontrolle und Sicherheitspolitik sowie den Einfluss von Polizeigewalt und Rassismus. Es bietet einen umfassenden Überblick über das Phänomen.
5. Anwendung sozialökologischer Ansätze auf jugendliche Gewaltdelinquenz in der Pariser banlieue: In diesem Kapitel wird die Übertragbarkeit der im zweiten Kapitel vorgestellten sozialökologischen Theorien auf die spezifischen Gegebenheiten der Pariser Banlieues geprüft. Es analysiert den Wandel des urbanen Raums und untersucht die Leistungsfähigkeit der Ansätze in der sozialen Praxis. Zusätzlich werden mögliche Erweiterungen und Verbindungen mit anderen kriminologischen Theorien diskutiert.
Schlüsselwörter
Jugendliche Gewaltdelinquenz, Pariser Banlieue, Sozialökologie, Segregation, Ausgrenzung, Kriminalitätstheorien, Chicago School, Broken Windows Theory, Kollektive Wirksamkeit, Polizeigewalt, Rassismus, soziale Desorganisation, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Jugendlicher Gewaltdelinquenz in den Pariser Banlieues
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Einfluss sozialökologischer Faktoren auf jugendliche Gewaltdelinquenz in den Pariser Banlieues. Sie verknüpft kriminologische Theorien mit der konkreten Situation vor Ort und evaluiert die Erklärungskraft sozialökologischer Ansätze.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt klassische und moderne sozialökologische Kriminalitätstheorien. Dazu gehören die „Concentric Zone Theory“ und die „Cultural Transmission Theory“ der Chicago School, die „Broken Windows Theory“ und der Ansatz der kollektiven Wirksamkeit von Sampson.
Welche Aspekte der Pariser Banlieues werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Entstehung, Entwicklung und Sozialstruktur der Pariser Banlieues, fokussiert auf Segregation, Ausgrenzung und die Lebensbedingungen der Jugendlichen ("les jeunes"). Sie beleuchtet die soziale Lage und die Herausforderungen dieser Bevölkerungsgruppe.
Wie wird jugendliche Gewaltdelinquenz definiert und untersucht?
Die Arbeit definiert den Begriff der jugendlichen Gewaltdelinquenz und untersucht deren Entwicklung in den Banlieues. Sie betrachtet Aspekte der Viktimisierung, Kriminalitätsfurcht, Kriminalitätskontrolle, Sicherheitspolitik, Polizeigewalt und Rassismus.
Wie werden sozialökologische Ansätze auf die Pariser Banlieues angewendet?
Die Arbeit prüft die Übertragbarkeit der vorgestellten Theorien auf die spezifischen Gegebenheiten der Pariser Banlieues. Sie analysiert den Wandel des urbanen Raums und untersucht die Leistungsfähigkeit der Ansätze in der sozialen Praxis. Mögliche Erweiterungen und Verbindungen zu anderen kriminologischen Theorien werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendlicher Gewaltdelinquenz, Pariser Banlieue, Sozialökologie, Segregation, Ausgrenzung, Kriminalitätstheorien, Chicago School, Broken Windows Theory, Kollektive Wirksamkeit, Polizeigewalt, Rassismus, soziale Desorganisation, Migrationshintergrund.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einführung, Ursachen von Kriminalität aus sozialökologischer Sicht, Die Pariser Banlieue, Kriminalität und jugendliche Gewaltdelinquenz in der Banlieue, Anwendung sozialökologischer Ansätze und Fazit.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Evaluierung der Erklärungskraft sozialökologischer Ansätze zur Erklärung jugendlicher Gewaltdelinquenz in den Pariser Banlieues, unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Bedingungen und der Rolle von Polizei und Sicherheitspolitik.
Was ist der Anlass der Arbeit?
Der Anlass der Arbeit sind die französischen Unruhen von 2005 in den Pariser Banlieues. Die Arbeit untersucht die Hintergründe und sucht nach Erklärungen für diese Ereignisse im Kontext sozialökologischer Faktoren.
- Quote paper
- Mirja Buschmann (Author), 2006, Der Einfluß sozialökologischer Kontexteffekte auf jugendliche Gewaltdelinquenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/62293