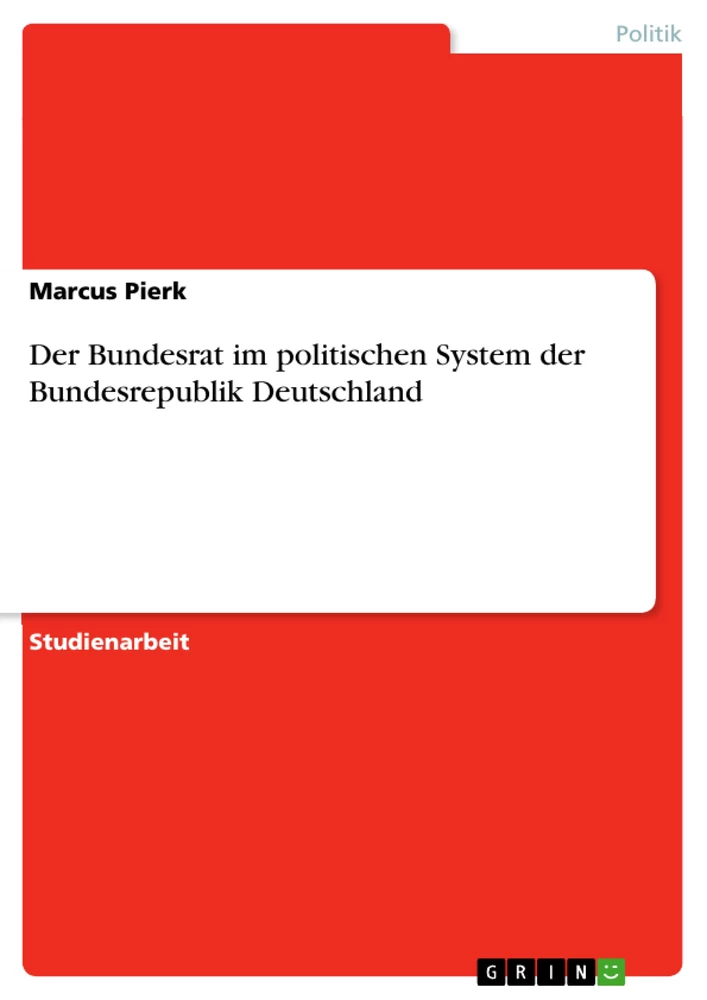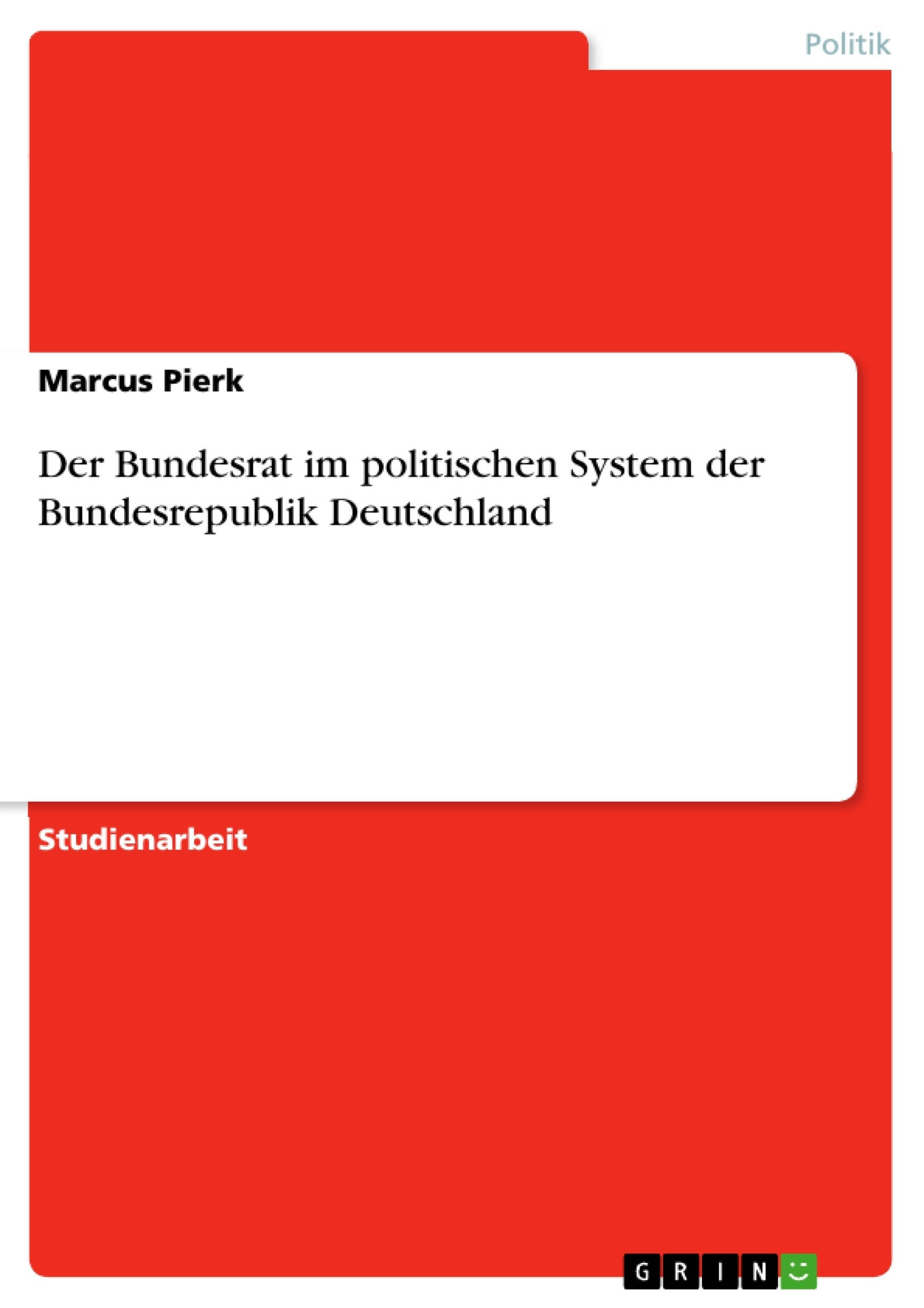Zielsetzung der Arbeit
Im Sommer 2000 war der Bundesrat das Thema in den Medien und damit auch in der Öffentlichkeit. Die Tatsache, dass die Steuerreform der Bundesregierung ungehindert den Bundesrat passieren konnte, erregte vor allem deswegen Aufsehen, weil dort die oppositionsgeführten Länder die Mehrheit hatten und mithin die Steuerreform hätten zum Scheitern bringen können. Der Umstand, dass die Ländervertreter nicht dem politischen Votum des Oppositionsführers im Bundestag folgten, wurde von den Oppositionsparteien kritisiert und von der
Öffentlichkeit verwundert zur Kenntnis genommen. Es wurde kolportiert, die Ländervertreter hätten sich ihre Zustimmung durch finanzielle Zugeständnisse seitens des Bundes abkaufen lassen.(1) Als Grund für das Abweichen der Ländervertreter von der offiziellen Linie der Partei wurden gewissermaßen unlautere Ziele unterstellt. Das führte sogar so weit, dass die Oppositionspartei CDU in eine Krise gestürzt wurde.(2) In diesem Fall ist der sonst gegen den
Bundesrat ins Felde geführte Vorwurf, er werde als Blockadeinstrument
missbraucht, gewissermaßen in sein Gegenteil verkehrt worden.
Blockadeinstrument zu sein ist allerdings ein Vorwurf, der empirisch schwer zu belegen ist. Bislang sind etwa 90 Prozent aller Gesetze mehr oder minder problemlos durch den Bundesrat gegangen.(3)
[...]
______
1 Vergl. Herz, Wilfried: Der nächste Kuhhandel, bitte! In: Die Zeit. Nr. 30 vom 20.7.00. S. 15.
2 Vergl. Lölhöffel, Helmut: Steuerreform stürzt CDU in Krise. In: Frankfurter Rundschau vom 15.7.00. S. 1.
3 Vergl. Schneider, Hans-Peter: Nehmen ist seliger als Geben. Oder: Wieviel „Förderalismus“ verträgt der Bundesstaat? In: NJW 1998. S. 3757 – 3759. Hier: S. 3759.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung der Arbeit
- Die Entstehung des Bundesrats
- Das Senatsmodell
- Die klassische Bundesratslösung
- Die abgeschwächte Bundesratslösung
- Organisation und Arbeitsweise des Bundesrates
- Der Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren
- Zustimmungsbedürftige Gesetze
- Einspruchsgesetze
- Der Vermittlungsausschuss
- Der Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren
- Der Bundesrat im politischen System
- Parteipolitische Instrumentalisierung des Bundesrates
- Die Gemeinschaftsaufgaben
- Die Kooperation auf der Dritten Ebene
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle des Bundesrats im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Der Fokus liegt insbesondere auf der Analyse der Einflusskräfte und politischen Prozesse, die die Stellung des Bundesrates beeinflussen. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwieweit der Bundesrat tatsächlich Länderinteressen vertreten kann, oder ob er eher als Instrument der Zentralisierung fungiert.
- Die Entstehung des Bundesrats und die verschiedenen Modelle der Länderbeteiligung
- Die Organisation und Arbeitsweise des Bundesrates, insbesondere seine Rolle im Gesetzgebungsverfahren
- Die politische Instrumentalisierung des Bundesrates und seine Bedeutung für das Verhältnis zwischen Bund und Ländern
- Die Gemeinschaftsaufgaben und die Kooperation auf der Dritten Ebene als Beispiele für die Interaktion zwischen Bund und Ländern
- Die Relevanz des Bundesrates für die politische Entscheidungsfindung in der Bundesrepublik Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Zielsetzung der Arbeit und stellt den aktuellen Forschungsstand dar. Es werden die Besonderheiten des Bundesrats und die Herausforderungen seiner Positionierung im politischen System der Bundesrepublik Deutschland aufgezeigt. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung des Bundesrats und die unterschiedlichen Modelle der Länderbeteiligung, die im Parlamentarischen Rat diskutiert wurden. Dabei wird insbesondere auf das Senatsmodell und das klassische Bundesratsmodell eingegangen, um die Hintergründe der heutigen Funktionsweise des Bundesrates zu verdeutlichen.
Im dritten Kapitel werden die Organisation und Arbeitsweise des Bundesrates im Detail analysiert. Dabei wird besonderer Wert auf seine Rolle im Gesetzgebungsverfahren gelegt. Die verschiedenen Arten von Gesetzen, die die Zustimmung des Bundesrats erfordern, sowie der Vermittlungsausschuss, der bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundestag und Bundesrat einberufen wird, werden hier näher erläutert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Positionierung des Bundesrats im politischen System. Dabei wird die Rolle des Bundesrates im Spannungsfeld zwischen Bund und Ländern beleuchtet, insbesondere die Frage, inwieweit der Bundesrat die Interessen der Länder tatsächlich vertreten kann. Die Kapitel analysieren außerdem die Möglichkeiten der parteipolitischen Instrumentalisierung des Bundesrats sowie die Bedeutung der Gemeinschaftsaufgaben und der Kooperation auf der Dritten Ebene für das Verhältnis zwischen Bund und Ländern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Bundesrat im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Zentrale Themen sind die Ländermitwirkung, das Gesetzgebungsverfahren, die Interessenvertretung der Länder, die Gemeinschaftsaufgaben, die Kooperation auf der Dritten Ebene sowie die parteipolitische Instrumentalisierung des Bundesrates. Die Arbeit untersucht die Entwicklung und Bedeutung des Bundesrats im deutschen Föderalismus und analysiert seinen Einfluss auf politische Entscheidungen.
- Quote paper
- Marcus Pierk (Author), 2000, Der Bundesrat im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/606