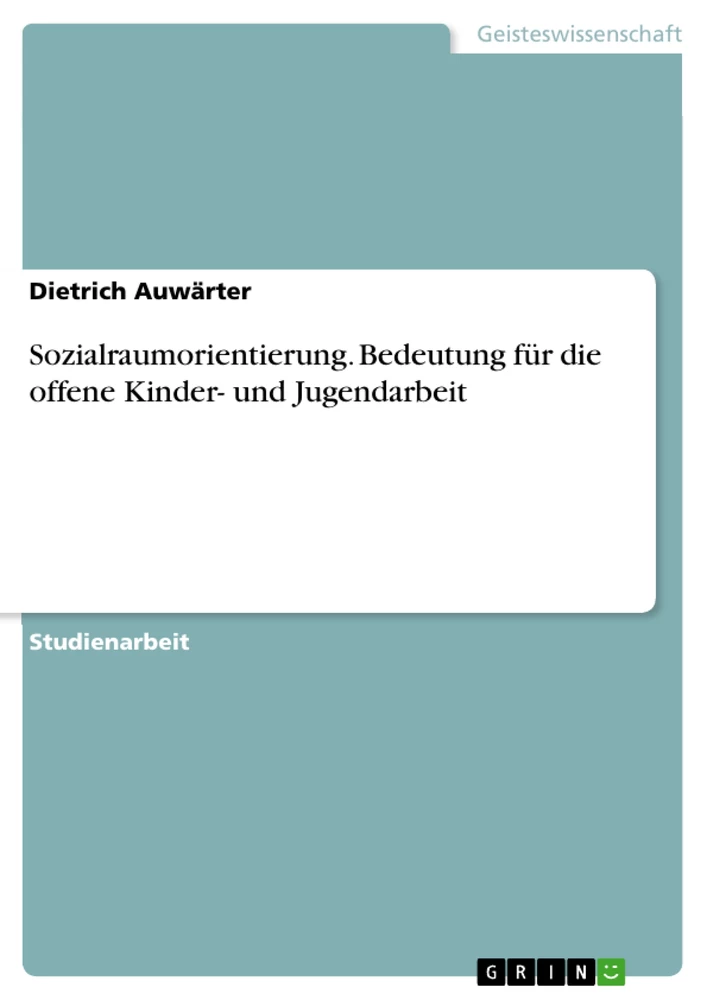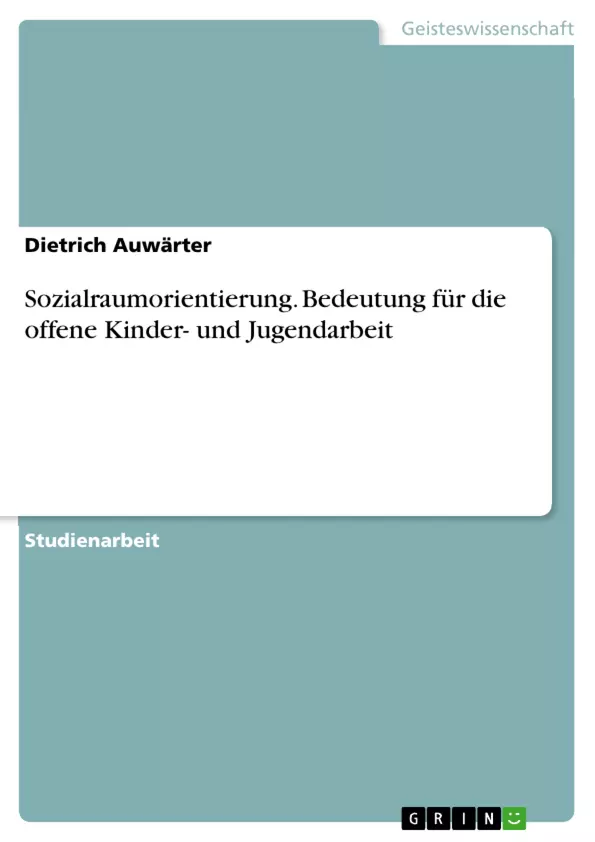Diese Abhandlung widmet sich dem Thema „Sozialraumorientierung - Bedeutung für die offene Kinder- und Jugendarbeit“ und der daraus folgenden Frage: Wie kann Sozialraumorientierung in die Offene Kinder- und Jugendarbeit implementiert werden? Ich werde mich mit dem Konzept der Sozialraumorientierung, seiner Entwicklung und Möglichkeiten der Umsetzung in der Offenen Jugendarbeit beschäftigen. Außerdem werde ich die wichtigsten Eckpunkte des Berufsfelds Offene Kinder- und Jugendarbeit skizzieren.
In letzter Zeit geistert der Begriff Sozialraumorientierung verstärkt durch die Fachdiskussion. Viele befürchten, es sei ein Trojanisches Pferd der neoliberalen Politik, mithilfe dessen Mittel eingespart werden und professionelle Hilfen durch Nachbarschaftshilfe ersetzt werden sollen. Einleuchtend ist jedoch auch, dass ohne eine Einbindung des Sozialraums in die pädagogische Einzelfallarbeit Möglichkeiten der Verstärkung von Effekten durch die Umgebung verloren gehen. Außerdem verzichtet man auf Nachhaltigkeit über die Dauer der Maßnahme hinaus, die entstehen kann, wenn Sozialraumressourcen eingebunden werden. Die Veränderung der Gesellschaft und die damit einhergehende Veränderung von Familienstrukturen machen es notwendig Soziale Arbeit in allen Bereichen neu auszurichten und anzupassen. Insbesondere für die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat der demographische Wandel und die damit einhergehende Verminderung der Anzahl von Jugendlichen und Kindern in der Gesellschaft eine wichtige Bedeutung. Es entstehen neue Chancen durch eine Erweiterung des Fokus auf den Sozialraum, beispielsweise die professionelle Arbeit mit Menschen effektiver und nachhaltiger zu gestalten. Durch die Einbindung und Nutzung der Umgebung und nicht-professioneller Helfer kann ein Mehrwert für die professionelle Arbeit durch Synergie-Effekte entstehen. Hier ist zu beachten, dass dieser Mehrwert ein zusätzlicher Wert ist, der nicht zur Reduktion professioneller Leistungen genutzt werden soll. In jedem Fall scheint das Konzept Einzug in die Politik zu halten und ist somit als Tatsache zu verstehen, an der sich zukünftige soziale Arbeit orientieren wird. Ich möchte in dieser Hausarbeit ein wenig Licht ins Dunkel bringen und sowohl Risiken und Chancen, als auch Herkunft und Entwicklung dieses Fachkonzeptes in Kombination mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sozialraumorientierung
- Prinzipien der Sozialraumorientierung
- Orientierung am Willen der Betroffenen
- Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe
- Blick auf die Ressourcen
- Zielgruppen- und bereichsübergreifender Fokus
- Kooperation und Koordination
- Von der Gemeinwesenarbeit zu Sozialraumorientierung
- Kritische Positionen an der SRO
- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Gesetzliche Grundlage
- Schwerpunkte
- Angebotsspektrum
- Offenes Angebot
- Jugendkulturarbeit
- Arbeitswelt Schule und Familie
- Jugendberatung
- Internationale Jugendarbeit
- Sozialraumorientierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema "Sozialraumorientierung - Bedeutung für die offene Kinder- und Jugendarbeit" und untersucht, wie dieses Konzept in die Praxis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit integriert werden kann. Die Arbeit analysiert das Konzept der Sozialraumorientierung, seine Entwicklung und die Möglichkeiten seiner Umsetzung in der Offenen Jugendarbeit. Darüber hinaus werden die wichtigsten Eckpunkte des Berufsfelds der Offenen Kinder- und Jugendarbeit beleuchtet.
- Konzept und Entwicklung der Sozialraumorientierung
- Prinzipien und Kritikpunkte der Sozialraumorientierung
- Gesetzliche Grundlagen, Prinzipien und Formen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Möglichkeiten der Implementierung der Sozialraumorientierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Risiken und Chancen der Sozialraumorientierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz der Sozialraumorientierung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit. Sie diskutiert die Bedeutung des Konzepts im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und beleuchtet die Notwendigkeit einer Anpassung sozialer Arbeit an den demographischen Wandel. Darüber hinaus werden die Ziele und die Gliederung der Hausarbeit vorgestellt.
Sozialraumorientierung
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Sozialraumorientierung (SRO) und seinen zentralen Prinzipien. Es beleuchtet die Orientierung am Willen der Betroffenen, die Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe sowie die Bedeutung des Ressourcenblicks. Weiterhin werden der historische Hintergrund der Entwicklung der SRO sowie kritische Positionen zu diesem Konzept dargelegt.
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und ihre gesetzliche Grundlage. Es behandelt die Schwerpunkte der OKJA, darunter das Angebotsspektrum, das offene Angebot, die Jugendkulturarbeit, die Arbeitswelt Schule und Familie, die Jugendberatung sowie die Internationale Jugendarbeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe in dieser Arbeit sind: Sozialraumorientierung, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Prinzipien, Eigeninitiative, Selbsthilfe, Ressourcen, Kooperation, Koordination, Gemeinwesenarbeit, kritische Positionen, Gesetzliche Grundlage, Angebotsspektrum, Jugendkulturarbeit, Jugendberatung, Internationale Jugendarbeit, Implementierung, Chancen, Risiken.
- Quote paper
- Dietrich Auwärter (Author), 2019, Sozialraumorientierung. Bedeutung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/594440