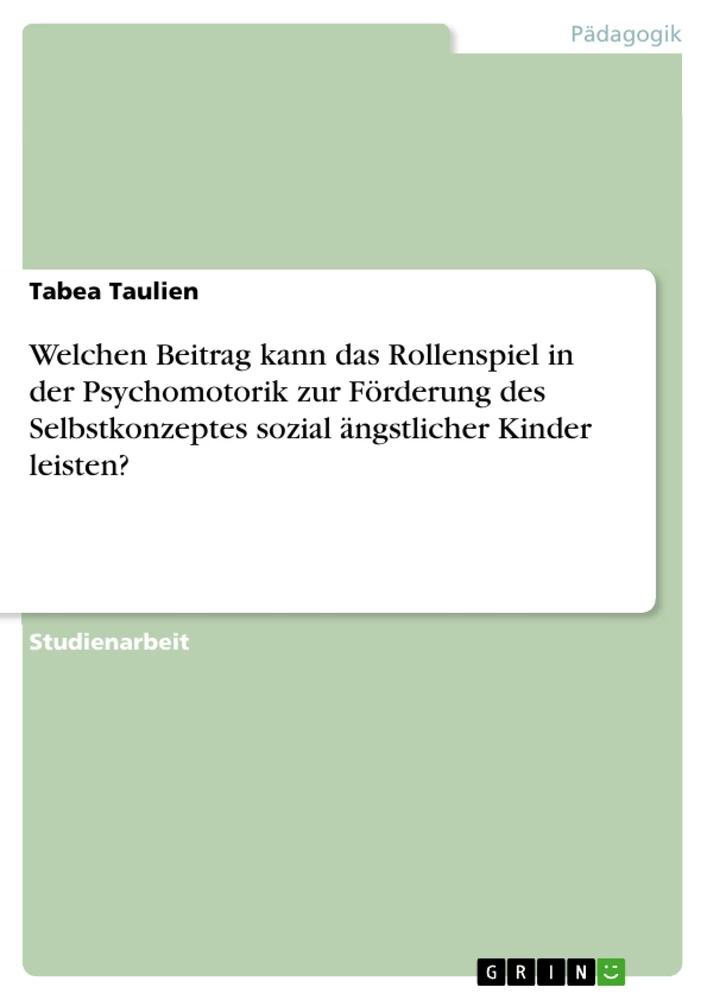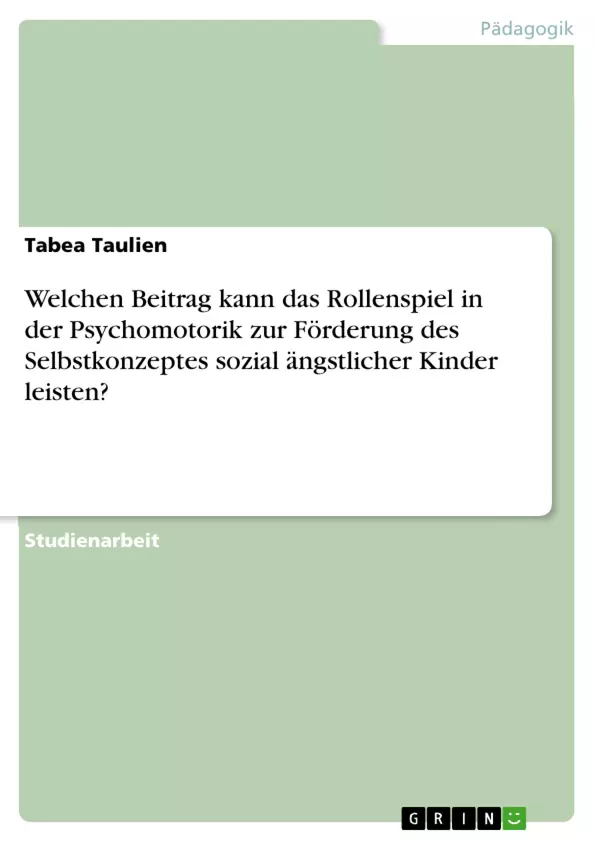In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, welchen Beitrag das Rollenspiel in der Psychomotorik zur Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder leisten kann.
Dazu werden zunächst die Modelle zum Selbstkonzept von Shavelson, Hubner und Stanton (1976) sowie von Zimmer (2012) vorgestellt, auf die im Verlauf der Arbeit Bezug genommen wird und damit verbundene Konstrukte näher beleuchtet. Nach einer Beschreibung des Störungsbildes "Soziale Ängstlichkeit" wird der Zusammenhang von Selbstkonzept und sozialer Ängstlichkeit genannt. Anschließend beschäftigt sich der Autor mit der Psychomotorik und erörtert, inwiefern diese Form der Bewegungsförderung zum Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes beitragen kann. Das Rollenspiel in der Psychomotorik stellt ein erprobtes Mittel dar, um das Selbstkonzept zu fördern. Welche Chancen und Grenzen diese Interventionsmaßnahme zur Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder birgt, wird abschließend untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Selbstkonzept sozial ängstlicher Kinder
- 2.1 Modelle des Selbstkonzeptes und die Bedeutung von Selbstwirksamkeit und Ursachenzuschreibungen
- 2.1.1 Selbstkonzept nach Shavelson, Hubner und Stanton
- 2.1.2 Selbstkonzept nach Zimmer
- 2.1.3 Selbstwirksamkeit, Kausalattribution und erlernte Hilflosigkeit
- 2.2 Soziale Ängstlichkeit im Kindesalter
- 2.3 Zusammenhang von Selbstkonzept und sozialer Ängstlichkeit
- 3. Das Rollenspiel in der Psychomotorik als Beitrag zur Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder
- 3.1 Psychomotorik als Maßnahme zur Förderung des Selbstkonzeptes
- 3.1.1 Empirische Belege für die positiven Auswirkungen von Psychomotorik auf das Selbstkonzept
- 3.1.2 Prinzipien der psychomotorischen Förderung
- 3.2 Das Rollenspiel als psychomotorische Interventionsmaßnahme zur Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder
- 3.2.1 Chancen des Rollenspiels in der Psychomotorik
- 3.2.2 Das Rollenspiel in der Therapie sozial ängstlicher Kinder
- 4. Fazit und Ausblick
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, welchen Beitrag das Rollenspiel in der Psychomotorik zur Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder leisten kann. Im Zentrum der Arbeit steht die Analyse der Zusammenhänge zwischen sozialer Ängstlichkeit und dem Selbstkonzept sowie die Untersuchung der Wirksamkeit von Rollenspielen als psychomotorische Interventionsmaßnahme.
- Das Selbstkonzept sozial ängstlicher Kinder
- Die Rolle von Selbstwirksamkeit und Kausalattributionen
- Der Einfluss von Psychomotorik auf das Selbstkonzept
- Die Chancen und Grenzen von Rollenspielen als Interventionsmaßnahme
- Die Bedeutung von Rollenspielen für die soziale Interaktion und Selbstbewusstseinsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Rollenspielen in der Psychomotorik und der Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder vor. Kapitel zwei befasst sich mit dem Selbstkonzept sozial ängstlicher Kinder. Es werden verschiedene Modelle des Selbstkonzeptes sowie die Bedeutung von Selbstwirksamkeit und Ursachenzuschreibungen diskutiert. Außerdem wird das Störungsbild "Soziale Ängstlichkeit" im Kindesalter erläutert und der Zusammenhang von Selbstkonzept und sozialer Ängstlichkeit beleuchtet. Kapitel drei analysiert die Psychomotorik als Maßnahme zur Förderung des Selbstkonzeptes. Die positiven Auswirkungen von Psychomotorik auf das Selbstkonzept werden empirisch belegt. Kapitel drei beleuchtet das Rollenspiel als psychomotorische Interventionsmaßnahme zur Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder. Die Chancen und Grenzen des Rollenspiels werden diskutiert und es wird gezeigt, wie Rollenspiele in der Therapie sozial ängstlicher Kinder eingesetzt werden können. Der Fokus liegt dabei auf den positiven Auswirkungen von Rollenspielen auf die soziale Interaktion und die Selbstbewusstseinsentwicklung.
Schlüsselwörter
Selbstkonzept, soziale Ängstlichkeit, Psychomotorik, Rollenspiel, Selbstwirksamkeit, Kausalattribution, erlernte Hilflosigkeit, Förderung, Intervention, Therapie, Kinder, Entwicklung, soziale Interaktion, Selbstbewusstsein.
- Arbeit zitieren
- Tabea Taulien (Autor:in), 2019, Welchen Beitrag kann das Rollenspiel in der Psychomotorik zur Förderung des Selbstkonzeptes sozial ängstlicher Kinder leisten?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/593686