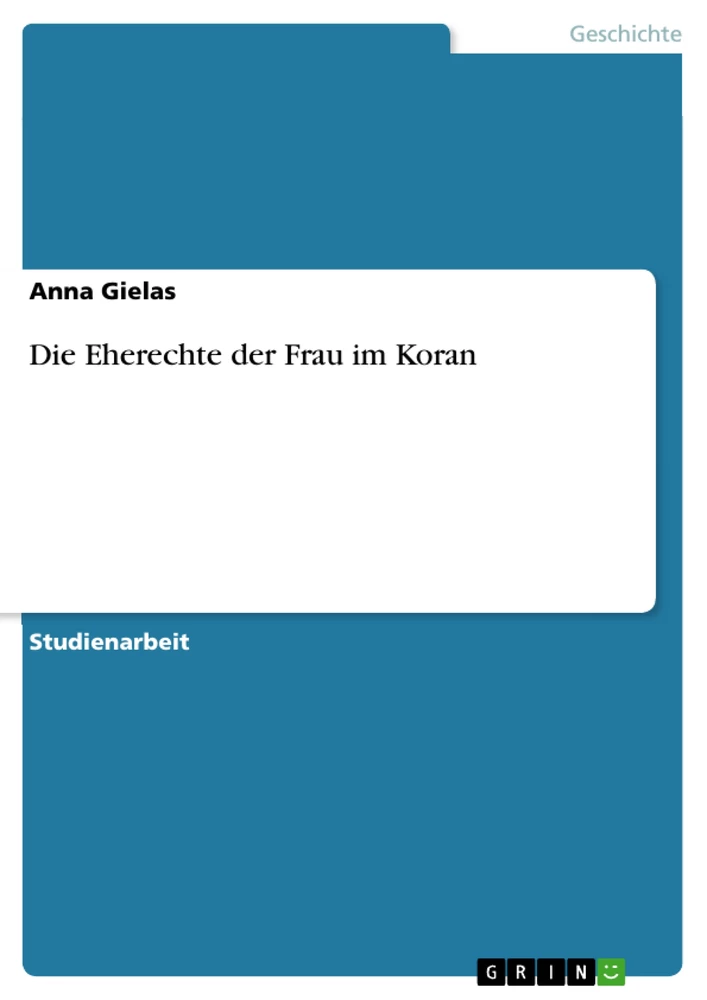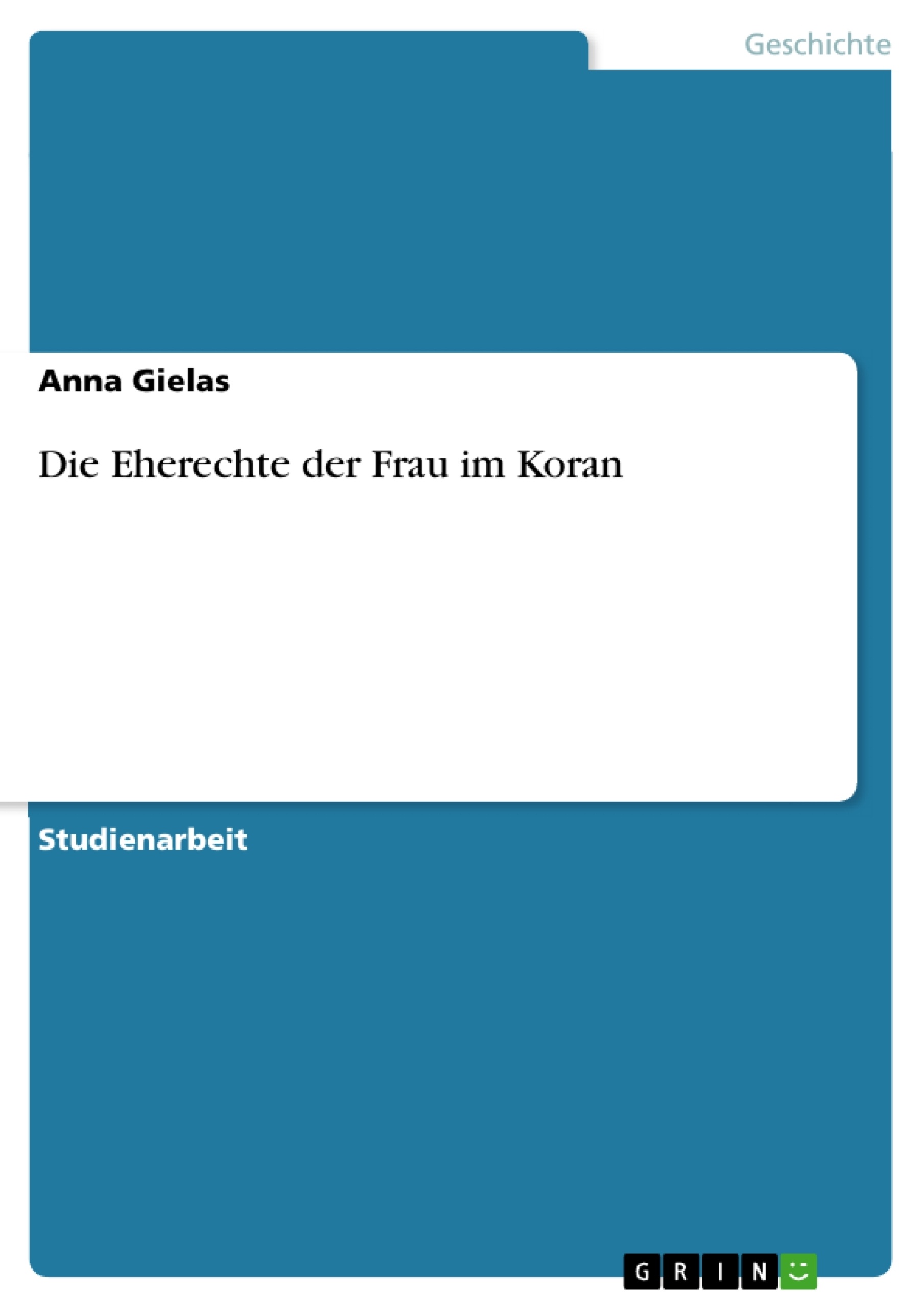Der Koran betont die Gleichheit zwischen Mann und Frau, legt aber gleichzeitig Regeln fest, die die Frau dem Mann unterordnen. Im Verlauf dieser Arbeit sollen die Ehe- und Scheindungsrechte, die der Koran festhält, näher beleuchtet werden, mit dem Ziel einer konkreten Aussage über die Stellung der verheirateten oder geschiedenen Frau in der moslemischen Gemeinschaft zur Entstehungszeit des Koran.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I – Der Koran
- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Hauptthemen des Korans
- 1.3 Entstehung des Korans
- 1.4 Stellung des Menschen laut des Korans
- 1.5 Visuelle und akustische Koranrezitation
- 1.6 Exegese des Korans
- 1.7 Der Koran als Gesetzgeber
- Teil II – Ehe- und Scheidungsrecht im Koran
- 2.1 Das islamische Eheverständnis
- 2.2 Zwecke der Ehe
- 2.3 Polygamie
- 2.4 Scheidung und Sorgerecht
- 2.5 Das Patriarchat
- 2.6 Gleichheit zwischen Mann und Frau
- 2.7 Ehe und Sexualität
- 2.8 Ehebruch
- 2.9 Erbe
- Teil III – Kurzer Vergleich der Stellung der Frau im vorislamischen und frühem islamischen Zeitalter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ehe- und Scheidungsrechte im Koran und deren Auswirkungen auf die Stellung der Frau in der muslimischen Gemeinschaft. Ziel ist es, ein konkretes Bild der verheirateten und geschiedenen Frau im Kontext des koranischen Rechts zu zeichnen.
- Die Entstehung und die Hauptthemen des Korans
- Das islamische Eheverständnis und seine Zwecke
- Koranische Regelungen zur Polygamie, Scheidung und zum Sorgerecht
- Der Vergleich der Stellung der Frau im Koran mit der vorislamischen Zeit
- Die scheinbaren Widersprüche zwischen der im Koran postulierten Gleichheit von Mann und Frau und der Realität einer patriarchalischen Struktur.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Stellung der Frau im Islam, basierend auf den im Koran festgelegten Ehe- und Scheidungsrechten. Es wird der Forschungsansatz skizziert, der die Analyse des Korans in drei Teilen gliedert: eine Einführung in den Koran selbst, eine detaillierte Untersuchung der koranischen Ehe- und Scheidungsregelungen und schließlich einen Vergleich mit vorislamischen Traditionen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Übersetzung des Korans von Max Henning.
Teil I - Der Koran: Dieser Teil bietet einen Überblick über den Koran als wichtigste Schriftquelle des Islam. Er erläutert die Glaubensgrundlagen des Islam, die Entstehung des Korans, seine Hauptthemen (Eschatologie, ethische Maximen, Rechtsvorschriften, theologische Diskussionen), und die Herausforderungen der Koranexegese. Der Teil beleuchtet die Entstehung des Korans durch die Niederschrift der Offenbarungen des Propheten Mohammed und die Standardisierung der Schrift unter Kalif Uthman. Die Bedeutung der Koranrezitation und die verschiedenen Interpretationen des Korans werden ebenfalls angesprochen. Abschließend wird die Funktion des Korans als Gesetzgeber und die daraus resultierenden moralischen und rechtlichen Implikationen für die Muslime diskutiert.
Teil II – Ehe- und Scheidungsrecht im Koran: Dieser Abschnitt analysiert detailliert die koranischen Regelungen zur Ehe und Scheidung. Er beleuchtet das islamische Eheverständnis als göttlich befohlene und gleichzeitig zwischenmenschliche Übereinkunft, die Zwecke der Ehe (Fortpflanzung, geordnete Lebensführung, sexuelle Befriedigung), und die koranische Perspektive auf Polygamie unter der Bedingung der gerechten Behandlung aller Frauen. Der Teil beschreibt die koranischen Regelungen zur Scheidung, einschließlich der Rechte der Frau auf finanzielle Absicherung und das Sorgerecht für Kinder. Die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen der Betonung der Gleichheit von Mann und Frau und der gleichzeitig postulierten Überlegenheit des Mannes wird diskutiert, ebenso die koranischen Regelungen zum Ehebruch und zur Erbfolge, die Ungleichheiten zwischen Mann und Frau aufweisen.
Teil III – Kurzer Vergleich der Stellung der Frau im vorislamischen und frühem islamischen Zeitalter: Dieser Teil vergleicht die Stellung der Frau im Koran mit den vorislamischen Traditionen. Er beschreibt verschiedene Formen der Ehe im vorislamischen Vorderen Orient (Polygamie, Polyandrie, monogame Ehen), den Einfluss der christlichen Lehren und die fehlenden Rechte der Frau in der vorislamischen Zeit hinsichtlich der Partnerwahl und der Scheidung. Es werden die soziale und wirtschaftliche Bedeutung der Frau in der vorislamischen Zeit erläutert, sowie die Auswirkungen der Urbanisierung auf ihre Rolle und ihr Ansehen. Der Abschnitt schließt mit der Feststellung, dass der Koran, trotz seiner patriarchalischen Elemente, gewisse Schutzmechanismen für Frauen einführte, die in der vorislamischen Gesellschaft gefehlt hatten.
Schlüsselwörter
Koran, Ehe, Scheidung, Frau, Mann, Islam, Polygamie, Patriarchat, Gleichheit, Sorgerecht, Erbe, vorislamische Zeit, Scharia, Koranexegese, Sunna, Religion.
FAQ: Ehe- und Scheidungsrecht im Koran
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ehe- und Scheidungsrechte im Koran und deren Auswirkungen auf die Stellung der Frau im Islam. Sie vergleicht die koranischen Regelungen mit vorislamischen Traditionen und untersucht scheinbare Widersprüche zwischen der postulierten Gleichheit der Geschlechter und der patriarchalischen Struktur.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil I bietet eine Einführung in den Koran, seine Entstehung, Hauptthemen und Exegese. Teil II analysiert detailliert die koranischen Regelungen zur Ehe und Scheidung, einschließlich Polygamie, Sorgerecht und Erbrecht. Teil III vergleicht die Stellung der Frau im Koran mit der vorislamischen Zeit.
Welche konkreten Fragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht das islamische Eheverständnis, die Zwecke der Ehe, die koranischen Regelungen zur Polygamie und Scheidung, das Sorgerecht, die scheinbaren Widersprüche zwischen Gleichheit und Patriarchat, sowie die Stellung der Frau vor und nach der islamischen Offenbarung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert primär auf dem Koran, insbesondere der Übersetzung von Max Henning. Sie bezieht sich auch auf vorislamische Traditionen und berücksichtigt die Herausforderungen der Koranexegese.
Welche Kapitel gibt es und was ist deren Inhalt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, drei Hauptteile und ein Kapitel mit Schlüsselwörtern. Die Einleitung skizziert den Forschungsansatz. Teil I behandelt den Koran allgemein. Teil II analysiert das Ehe- und Scheidungsrecht. Teil III vergleicht die Stellung der Frau vor und nach dem Islam. Die Schlüsselwörter fassen die wichtigsten Begriffe zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, ein konkretes Bild der verheirateten und geschiedenen Frau im Kontext des koranischen Rechts zu zeichnen und die Stellung der Frau im Islam auf Basis der koranischen Ehe- und Scheidungsrechte zu untersuchen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht die scheinbaren Widersprüche zwischen der im Koran postulierten Gleichheit von Mann und Frau und der Realität einer patriarchalischen Struktur. Sie vergleicht die Situation der Frau im vorislamischen und frühislamischen Kontext und analysiert die im Koran enthaltenen Schutzmechanismen für Frauen, die in der vorislamischen Gesellschaft gefehlt haben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Koran, Ehe, Scheidung, Frau, Mann, Islam, Polygamie, Patriarchat, Gleichheit, Sorgerecht, Erbe, vorislamische Zeit, Scharia, Koranexegese, Sunna, Religion.
- Quote paper
- Anna Gielas (Author), 2006, Die Eherechte der Frau im Koran, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/59088