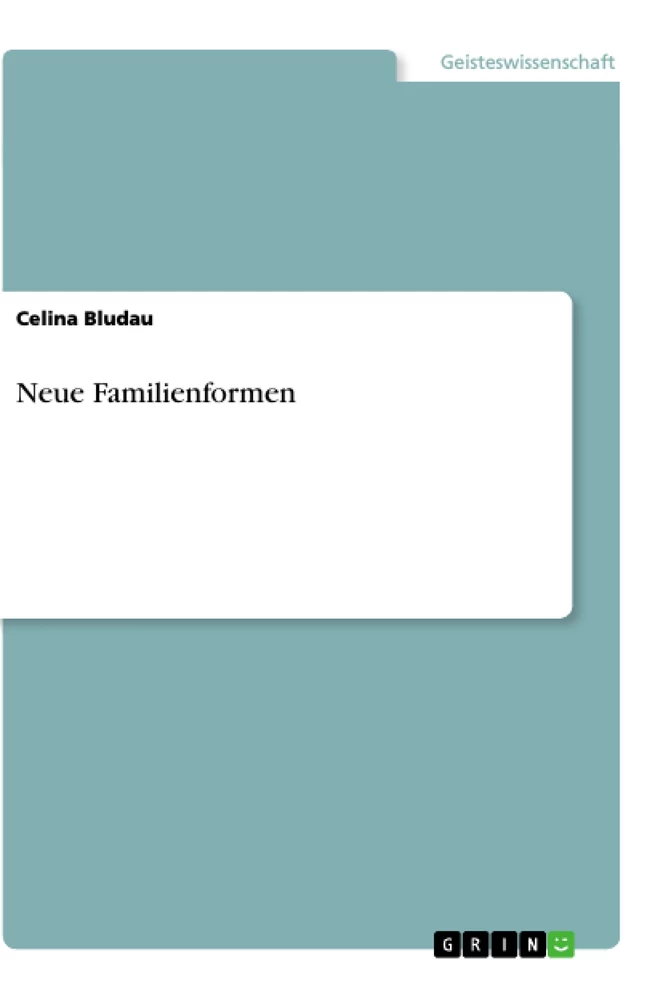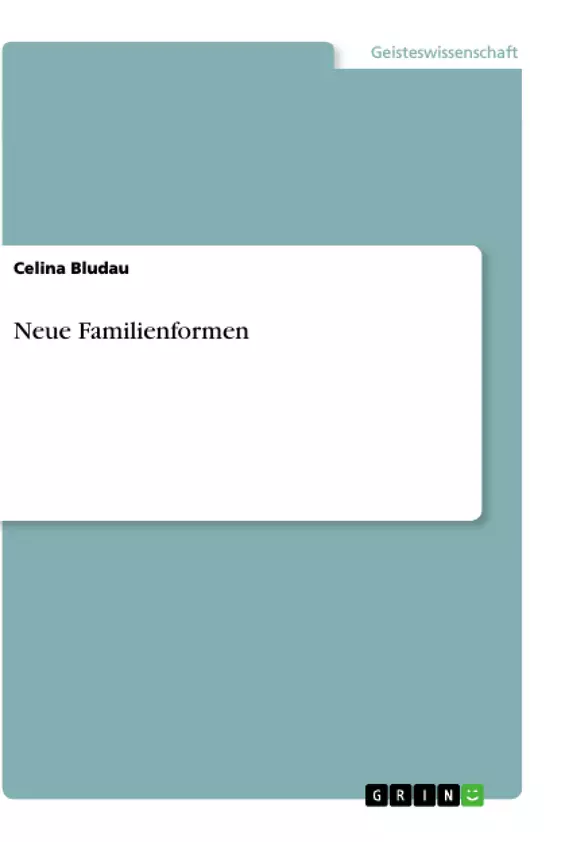Diese Arbeit untersucht die Ursache für die gestiegene Pluralität von Familienformen. Das Thema Familie wird heute immer häufiger zum Mittelpunkt politischer und medialer Debatten. Die bürgerliche Kleinfamilie, die für Deutschland typische gewesen zu sein scheint, ist immer seltener vertreten. Geburtenrückgang, Individualisierung der Gesellschaft, die Rolle der Frau – das und vieles mehr sorgen dafür, dass die "Klischee-Familie" Vater-Mutter-Kind langsam aber sicher verdrängt und durch andere Formen ersetzt wird.
Auch in der Familiensoziologie wurde ein Wandel festgestellt. So definiert der Soziologe Hoffmann-Nowotny (1934-2004) den Begriff "Familie" wie folgt: Familie seien "Sozialformen eigener Art, die primär auf die Gestaltung der sozialen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern angelegt sind, die als solche sozial anerkannt werden. Es bestehen Wechselwirkungen zwischen Familie und Gesellschaft." Diese Definition bezieht nicht nur das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie, sondern auch neue Familienformen mit ein, wie z.B. Alleinerziehende nichteheliche Lebensgemeinschaften oder homosexuelle Partnerschaften mit Kindern, da es um die Beziehung zwischen Eltern und Kind geht und die Lebensart der Eltern dabei keine Rolle spielt.
In der Gesellschaft kann eine zunehmende Akzeptanz neuer Familienformen beobachtet werden, die vor fünfzig Jahren noch verpönt waren. Das wirkt sich auch auf die Familienpolitik aus. Kaum eine andere politische Kategorie erlebt so viele Reformen wie die Familienpolitik. So wurde bspw. 1972 die rechtliche Diskriminierung nichtehelich geborener Kinder und ihrer Mütter verboten. Auch 2001 gab es ein neues wichtiges Gesetz, das für viel Aufruhe gesorgt hatte: die Einführung des Gesetzes über eingetragene Lebenspartnerschaften gibt gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit, ihrer Beziehung einen rechtlichen Rahmen zu geben, die dann in elementaren Punkten einer Ehe gleichgestellt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Thesen zur gestiegenen Pluralität von Familienformen
- Gründe für die Pluralisierung von Familienformen
- Neue Lebensformen von Familie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Referatsausarbeitung untersucht die zunehmende Pluralisierung von Familienformen in Deutschland. Ziel ist es, die wichtigsten Thesen und Gründe für diesen Wandel aufzuzeigen und verschiedene neue Familienmodelle zu beleuchten. Dabei wird auf die gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen eingegangen, die diesen Prozess beeinflussen.
- Pluralisierung von Familienformen
- Thesen zur De-Institutionalisierung, Individualisierung und Pluralisierung
- Demografischer Wandel und Geburtenrückgang
- Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen
- Neue Familienmodelle und rechtliche Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema "Neue Familienformen" ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die zunehmende Pluralisierung von Familienformen. Sie stellt die Struktur der Ausarbeitung vor und betont den Wandel des traditionellen Familienbildes in der Gesellschaft und die damit verbundenen politischen und medialen Debatten. Die Definition von Familie nach Hoffmann-Nowotny wird eingeführt, welche neue Familienformen miteinschließt und die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz dieser betont. Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse der Ursachen und Auswirkungen der Pluralisierung von Familienformen.
Die Thesen zur gestiegenen Pluralität von Familienformen: Dieses Kapitel präsentiert drei Hauptthesen, die die zunehmende Pluralisierung von Familienformen erklären: die De-Institutionalisierungsthese (Verlust der Verbindlichkeit von Ehe und Familie), die Individualisierungsthese (zunehmende Selbstbestimmung im Lebensstil) und die Pluralisierungsthese (Vielfalt an Familienmodellen). Jede These wird detailliert erläutert, mit historischen Kontexten und soziologischen Argumenten untermauert. Der Fokus liegt auf dem Wandel vom traditionellen Familienmodell hin zu einer größeren Vielfalt an Lebensformen und die damit einhergehenden Veränderungen in der Gesellschaft.
Gründe für die Pluralisierung von Familienformen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Gründe für die Pluralisierung von Familienformen, wobei der demografische Wandel als besonders wichtiger Faktor hervorgehoben wird. Es wird der Rückgang der Geburtenrate und die Veränderung der Eheschließungs- und Scheidungsraten seit Mitte der 1960er Jahre analysiert. Der Text verknüpft diese demografischen Entwicklungen mit den im vorherigen Kapitel vorgestellten Thesen und zeigt die komplexen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und individuellen Faktoren auf.
Schlüsselwörter
Familienformen, Pluralisierung, De-Institutionalisierung, Individualisierung, Demografischer Wandel, Geburtenrückgang, Eheschließungen, Scheidungen, gesellschaftlicher Wandel, neue Familienmodelle, Familiensoziologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Neue Familienformen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die zunehmende Pluralisierung von Familienformen in Deutschland. Sie analysiert die wichtigsten Thesen und Gründe für diesen Wandel und beleuchtet verschiedene neue Familienmodelle. Dabei werden gesellschaftliche und demografische Entwicklungen berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Pluralisierung von Familienformen, Thesen zur De-Institutionalisierung, Individualisierung und Pluralisierung, den demografischen Wandel und Geburtenrückgang, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen und neue Familienmodelle sowie rechtliche Entwicklungen. Die Definition von Familie nach Hoffmann-Nowotny, welche neue Familienformen miteinschließt, wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Thesen zur Pluralisierung werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert drei Hauptthesen: die De-Institutionalisierung (Verlust der Verbindlichkeit von Ehe und Familie), die Individualisierung (zunehmende Selbstbestimmung im Lebensstil) und die Pluralisierung (Vielfalt an Familienmodellen). Jede These wird detailliert erläutert und mit historischen Kontexten und soziologischen Argumenten untermauert.
Welche Gründe für die Pluralisierung werden genannt?
Ein wichtiger Grund für die Pluralisierung ist der demografische Wandel, insbesondere der Rückgang der Geburtenrate und die Veränderung der Eheschließungs- und Scheidungsraten seit Mitte der 1960er Jahre. Die Arbeit verknüpft diese demografischen Entwicklungen mit den vorgestellten Thesen und zeigt die komplexen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und individuellen Faktoren auf.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert: Einleitung, Thesen zur gestiegenen Pluralität von Familienformen, Gründe für die Pluralisierung von Familienformen, Neue Lebensformen von Familie und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Struktur der Arbeit vor. Die Kapitel geben detaillierte Einblicke in die Thesen, Gründe und Beispiele neuer Familienmodelle. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Familienformen, Pluralisierung, De-Institutionalisierung, Individualisierung, Demografischer Wandel, Geburtenrückgang, Eheschließungen, Scheidungen, gesellschaftlicher Wandel, neue Familienmodelle, Familiensoziologie.
Welche Definition von Familie wird verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Definition von Familie nach Hoffmann-Nowotny, die neue Familienformen miteinschließt und die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz dieser betont.
- Arbeit zitieren
- Celina Bludau (Autor:in), 2017, Neue Familienformen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/589411