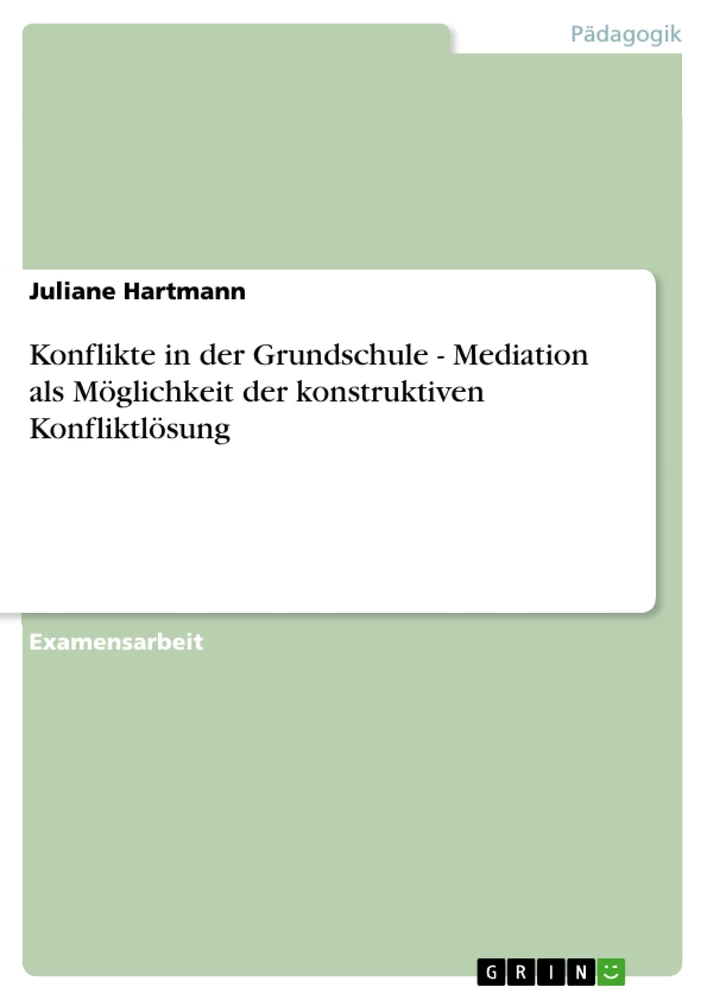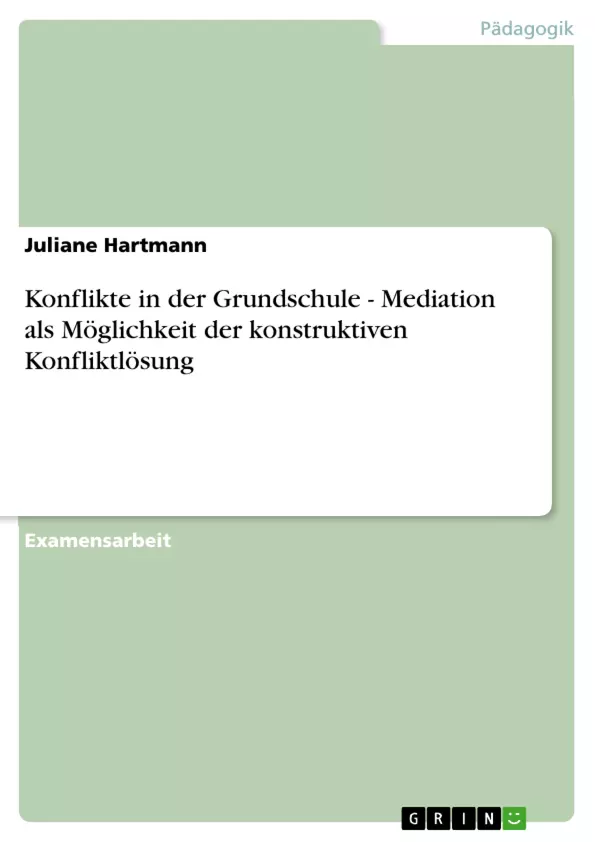Von der Institution Schule wird erwartet, dass sie den Schülern nicht nur reinen Lernstoff vermittelt, sondern auch ein Ort ist, an dem Sorgen, Probleme und Ängste aufgefangen werden. Da der Erziehungsauftrag vom eigenen Elternhaus vermehrt vernachlässigt wird, müssen Lehrer zudem zunehmend erzieherisch tätig werden. Deshalb kommt dem Lern- und Lebensort Schule zusätzlich die Aufgabe zu, das soziale Lernen der Kinder zu fördern, um sie auf das Leben in unserer Gesellschaft vorzubereiten. Diese offenbart sich Kindern als Gesellschaft voller unterschiedlicher menschlicher Interessen und sozialer Bedürfnisse. Die Kinder pädagogisch sinnvoll an die Erwartungen und Anforderungen des Lebens heranzuführen, stellt für den Lehrer eine besondere Herausforderung dar. Konflikte spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle, da sie Teil des gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Lebens sind: Konfliktpotential besteht überall dort, wo Menschen aufeinander treffen. Somit gehören sie auch zum Alltag der Grundschule. Sie werden hier meist als unliebsame Störungen wahrgenommen, die es schnell zu beseitigen gilt. Zugunsten des Unterrichts werden sie oftmals übergangen, unterdrückt, vermieden oder einfach autoritär beendet, indem der Lehrer als außenstehende Autoritätsperson übereilt für einzelne Schüler Partei ergreift oder sie rigoros bestraft. Ungelöste Konflikte können aber bei Kindern Gefühle der Feindseligkeit, des Misstrauens, der Unkonzentriertheit oder des Leistungsabfalls auslösen. Dies führt zu einem schlechten Klima im Klassenraum und zur Bildung von Einzelgängern. Ein solcher Umgang lässt Konflikte unweigerlich als ausschließlich negativ erscheinen und behindert zugleich die Entwicklung des Sozialverhaltens: Wollen Kinder sich in unserer Gesellschaft, in der Konflikte zum festen Bestandteil des täglichen Lebens gehören, zurechtfinden, müssen sie lernen, mit Konflikten friedlich umzugehen. Diese Tatsache macht ein konstruktives Konfliktverhalten umso wichtiger. Viele Kinder sind jedoch dazu nicht in der Lage. Im Alltag erleben sie durch Medien und ihr persönliches Umfeld Gewalt oftmals als erfolgreichstes Mittel der Konfliktlösung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Basiswissen zum Konfliktbegriff
- 1. Begriffsdefinition und Eingrenzung des „Sozialen Konfliktes"
- 1.1 Allgemeine Definition
- 1.2 Entstehung
- 1.3 Abgrenzung: Was ist kein sozialer Konflikt?
- 2. Zu den Ursachen von Konflikten
- 2.1 Zur Typologie sozialer Konflikte
- 2.1.1 Der soziale Rahmen
- 2.1.2 Konfliktarten
- 2.2 Darstellung von Konfliktursachen: Das Eisbergmodell
- 2.3 Emotionen und Aggressionen
- 2.4 Typische Ursachen für Konflikte in der Grundschule
- 2.4.1 Äußere Bedingungen
- 2.4.2 Die Gestaltung des Unterrichts
- 2.4.3 Die Rolle des Lehrers
- 2.4.4 Die Heterogenität der Schüler
- 2.5 Typische Konflikte im Klassenzimmer
- 2.5.1 Konflikte unter Kindern
- 2.5.2 Konflikte zwischen Lehrern und Kindern
- 3. Zur Dynamik von Konflikten
- 3.1 Lernprozesse und Aufbau von Verhaltensmustern
- 3.2 Seelische Veränderungen im Verlauf eines Konfliktes
- 3.3 Effekte des Konfliktverhaltens
- 4. Zur Eskalation von Konflikten nach Friedrich Glasl
- 4.1 Basismechanismen der Eskalationsdynamik
- 4.2 Schwellen der Eskalation
- 4.3 Das Eskalationsmodell
- 4.4 Die Stufen der Eskalation
- 5. Zum Umgang mit Konflikten
- 5.1 Alltägliche Grundmuster der Konfliktbearbeitung
- 5.2 Einflüsse der Altersstufe auf das Verhalten in Konfliktsituationen
- 5.2.1 Die Stufentheorie von Lawrence Kohlberg
- 5.2.2 Das Modell der sozialen Perspektivübernahme nach Robert Selman
- 5.2.3 Untersuchung der Konzepte von Streit von Renate Valtin
- 5.3 Möglichkeiten des Umgangs mit Konflikten in der Grundschule
- 5.3.1 Herkömmliche Methoden der Konfliktaustragung
- 5.3.2 Zum konstruktiven Umgang mit Konflikten
- 5.3.3 Merkmale einer konstruktiven Bearbeitung von Konflikten
- 5.3.3.1 Die präventive Konfliktbehandlung
- 5.3.3.2 Die interventive Konfliktbehandlung
- 5.3.3.3 Die kurative Konfliktbehandlung
- III. Mediation als Medium der konstruktiven Konfliktlösung
- 1. Grundlagen des Mediationskonzeptes
- 1.1 Allgemeine Begriffsdefinition
- 1.2 Historische Wurzeln von Mediation
- 2. Das Verfahren
- 2.1 Der Mediator
- 2.1.1 Aufgaben und Voraussetzungen
- 2.1.2 Techniken der Gesprächsführung
- 2.1.3 Kommunikationsrichtungen während des Mediationsgesprächs
- 2.2 Das Setting
- 2.3 Die Regeln der Mediation
- 2.4 Das Gespräch
- 2.4.1 Die wichtigsten Schritte des Mediationsverfahrens
- 2.4.1.1 Vorphase
- 2.4.1.2 Das Mediationsgespräch
- 2.4.1.3 Umsetzungsphase
- IV. Mediation und Schule
- 1. Grundsätzliche Bedingungen
- 1.1 Einsatz von Mediation in der Schule
- 1.2 Rahmenbedingungen
- 2. Kritische Auseinandersetzung
- 2.1 Chancen und Vorteile von Mediation gegenüber anderen Verfahren der Konfliktlösung
- 2.2 Grenzen von Mediation
- 3. Zum Einsatz von Mediation in der Grundschule
- 3.1 Gewaltfreie Konfliktaustragung in der Grundschule nach Jamie Walker
- 3.1.1 Kennen lernen und Auflockern
- 3.1.2 Förderung des Selbstwertgefühls
- 3.1.3 Kommunikation
- 3.1.3.1 Beobachten und wahrnehmen
- 3.1.3.2 Sich verbal und nonverbal ausdrücken
- 3.1.3.3 Zuhören und sich mitteilen
- 3.1.3.4 Gefühle wahrnehmen, mit Gefühlen umgehen
- 3.1.3.5 Ergänzung: Giraffen- und Wolfssprache – den Wechsel von Perspektiven üben
- 3.1.4 Kooperation
- 3.1.5 Geschlechtsbezogene Interaktion
- 3.1.6 Gewaltfreie Konfliktaustragung
- 3.2 Das Streitschlichterprogramm nach Karin Jefferys-Duden
- 3.2.1 Unterrichtseinheit 1: Einführung in die Schlichtung
- 3.2.2 Unterrichtseinheit 2: Konfliktlösungen
- 3.2.3 Unterrichtseinheit 3: Schlichterkenntnisse und -fähigkeiten
- 3.2.4 Unterrichtseinheit 4: Gefühle erkennen, benennen, vergleichen
- 3.2.5 Unterrichtseinheit 5: Schlichtungsablauf
- 3.2.6 Unterrichtseinheit 6: Erfolgskontrolle
- V. Resümee
- Konfliktbegriff und -ursachen in der Grundschule
- Dynamik und Eskalation von Konflikten
- Konstruktive Konfliktbearbeitung und Mediationskonzepte
- Einsatz von Mediation in der Grundschule: Chancen und Grenzen
- Praktische Ansätze zur Gewaltfreien Konfliktaustragung in der Grundschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Konflikte in der Grundschule und beleuchtet Mediation als eine Möglichkeit der konstruktiven Konfliktlösung. Ziel ist es, einen umfassenden Einblick in das Phänomen von Konflikten im schulischen Kontext zu geben und die Funktionsweise und den Einsatz von Mediation in der Grundschule zu erläutern. Die Arbeit analysiert die Entstehung, Dynamik und Eskalation von Konflikten und stellt verschiedene Ansätze zur Konfliktbearbeitung vor.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel II widmet sich dem Basiswissen zum Konfliktbegriff und beleuchtet dessen Definition, Entstehung und Abgrenzung. Des Weiteren werden Ursachen und Typologie sozialer Konflikte sowie deren Eskalationsdynamik nach Friedrich Glasl analysiert. Kapitel III fokussiert auf Mediation als Medium der konstruktiven Konfliktlösung und erläutert dessen Verfahren, die Rolle des Mediators und die wichtigsten Schritte im Mediationsgespräch. Kapitel IV setzt sich mit der Anwendung von Mediation in der Schule auseinander und beleuchtet die Chancen und Grenzen dieses Verfahrens. Im Fokus stehen dabei praktische Ansätze zur Gewaltfreien Konfliktaustragung in der Grundschule nach Jamie Walker und Karin Jefferys-Duden.
Schlüsselwörter
Konflikte in der Grundschule, Mediation, Konfliktlösung, Eskalation, Gewaltfreie Konfliktaustragung, Streitschlichter, Schüler, Lehrer, sozialer Rahmen, Kommunikation, Perspektivübernahme, pädagogisches Handeln.
- Quote paper
- Juliane Hartmann (Author), 2006, Konflikte in der Grundschule - Mediation als Möglichkeit der konstruktiven Konfliktlösung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58798