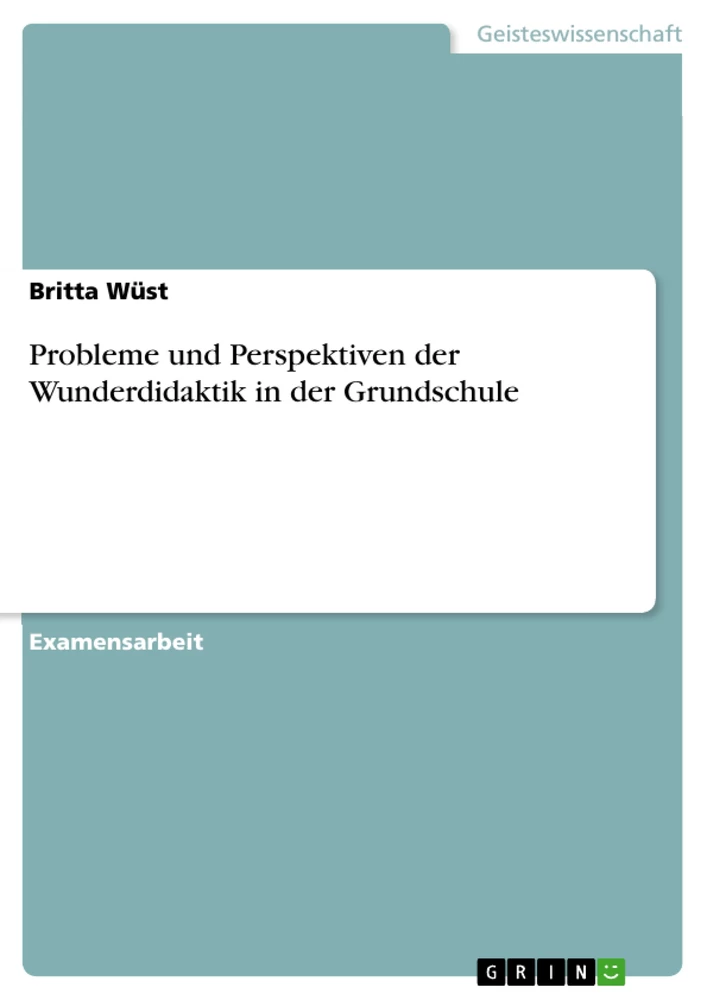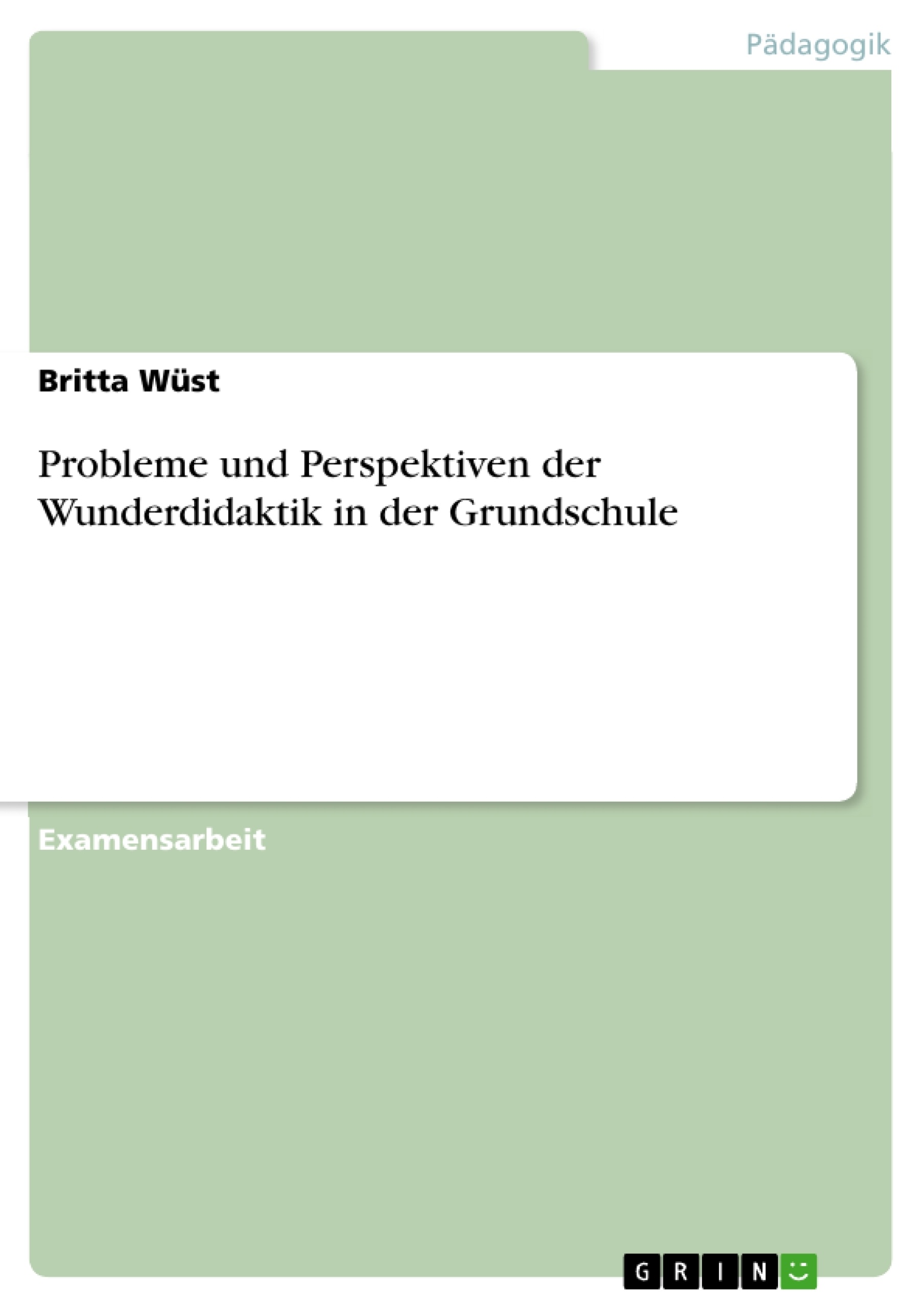Wundergeschichten in der Grundschule? Ja oder Nein? - Diese Frage hält sich beharrlich in den entsprechenden Diskussionen der Religionspädagogik. „Kommen Wunder für Kinder zu früh?“ fragt Werner Ritter beispielsweise in seinem gleichnamigen Aufsatz, um sich dann für eine Thematisierung der Wundergeschichten in der Grundschule auszusprechen. Klaus Wegenast hingegen äußert sich entschieden gegen eine Behandlung dieser Texte in der Grundschule. Um die Argumentation der Religionspädagogen nachvollziehen zu können, ist es nötig, sich mit den entwicklungspsychologischen Voraussetzungen von Grundschülern zu befassen. Hier spielen verschiedene Untersuchungen eine bedeutende Rolle. Jean Piaget beschäftigte sich beispielsweise mit der kognitiven Entwicklung des Menschen, während Lawrence Kohlberg die moralische Urteilsfähigkeit untersuchte. Mit der religiösen Entwicklung befassten sich sowohl Fritz Oser und Paul Gmünder als auch James W. Fowler. Letzterer entwarf eine Theorie über die Stufen des Glaubens. Fritz Oser und Paul Gmünder beschäftigten sich mit dem religiösen Urteil des Menschen und erarbeiteten hierzu ebenfalls ein Stufenschema. Diese Arbeit wird zeigen, dass eine zusammenfassende Betrachtung dieser Erkenntnisse ein supranaturalistisch geprägtes Gottesbild der Kinder im Grundschulalter ergibt. Dies hat zur Folge, dass sie auch die Wundergeschichten in diesem Sinne als ein direktes Eingreifen Gottes in die Welt verstehen. Das Hauptproblem besteht in der Frage der Schüler nach der Wirklichkeit der erzählten Begebenheit. Wundergeschichten sind grundsätzlich als „Glaubens- oder Bekenntnisgeschichten und […] [nicht als] Tatsachenberichte“ zu werten. Diese Übertragung gelingt Grundschülern im Regelfall jedoch nicht. Auch können Wundergeschichten leicht ein missverständliches Jesusbild hervorrufen. Dieser wird dann als Übermensch oder gar als Zauberer gesehen, der jedoch damals gewirkt hat und für ihr heutiges, eigenes Leben keine Relevanz besitzt, „obwohl auch sie Bedrohung und Not leiden.“ Ein weiterer Kritikpunkt ist das mögliche Missverständnis über die Art des christlichen Glaubens. So könnten die Kinder die Schlussfolgerung ziehen, dass es sich bei unserem Glauben lediglich um ein „unkritische[…][s] Fürwahrhalten rational nicht erklärbarer Geschehnisse“ handelt. Dies lässt sie eventuell zunächst am Glauben zweifeln und ihn später sogar aufgeben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wunderüberlieferung in den Evangelien
- Wesentliche Aspekte der neutestamentlichen Wundergeschichten
- Zum Wirklichkeitsverständnis von Wundergeschichten
- Kindliches Wunderverständnis
- Religiöse (Vor-)Erfahrungen
- Entwicklungspsychologische Voraussetzungen
- Die kognitiven Entwicklungsstadien - Jean Piaget
- Die Entwicklung des moralischen Urteils - Lawrence Kohlberg
- Die Stufen des religiösen Urteils - Fritz Oser / Paul Gmünder
- Die Stufen des Glaubens - James W. Fowler
- Schlussfolgerungen für die Thematisierung von Wundergeschichten in der Grundschule
- Wundergeschichten in der Grundschule
- Gegner der Thematisierung der Wundergeschichten in der Grundschule
- Befürworter der Thematisierung der Wundergeschichten in der Grundschule
- Didaktische Umsetzungsmöglichkeiten
- Wundergeschichten als Glaubensgeschichte
- Wundergeschichten als Handlungsanweisungen
- Wundergeschichten als Hoffnungsbilder
- Exemplarische Darstellung didaktischer Umsetzungsmöglichkeiten anhand der Bartimäusgeschichte in Mk 10, 46-52
- Exegetischer Hintergrund
- Didaktische Aspekte
- Die Bartimäusgeschichte als Glaubensgeschichten
- Die Bartimäusgeschichte als Handlungsanweisungen
- Die Bartimäusgeschichte als Hoffnungsbilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie Wundergeschichten in der Grundschule thematisiert werden können. Sie untersucht die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen von Grundschülern und deren Verständnis von Wundern. Die Arbeit beleuchtet auch die Argumentationslinien von Befürwortern und Gegnern der Thematisierung von Wundergeschichten im Grundschulunterricht.
- Entwicklungspsychologische Voraussetzungen von Grundschülern hinsichtlich Wunderverständnis
- Kritikpunkte und Chancen der Thematisierung von Wundergeschichten im Religionsunterricht
- Didaktische Umsetzungsmöglichkeiten von Wundergeschichten
- Exemplarische Analyse der Bartimäusgeschichte als didaktisches Beispiel
- Bedeutung und Relevanz von Wundergeschichten für die christliche Tradition
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Frage nach der Thematisierung von Wundergeschichten in der Grundschule heraus. Sie erläutert die Kontroversen zwischen Befürwortern und Gegnern und gibt einen Überblick über die Themen der Arbeit.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Wunderüberlieferung in den Evangelien. Es analysiert wesentliche Aspekte der neutestamentlichen Wundergeschichten und geht auf das Wirklichkeitsverständnis dieser Erzählungen ein.
Das zweite Kapitel erörtert das kindliche Wunderverständnis. Es beleuchtet die religiösen (Vor-)Erfahrungen von Kindern und analysiert verschiedene entwicklungspsychologische Studien zum kognitiven, moralischen und religiösen Entwicklungsstand von Grundschülern.
Das dritte Kapitel setzt sich mit der Problematik der Thematisierung von Wundergeschichten in der Grundschule auseinander. Es stellt die Argumente von Gegnern und Befürwortern gegenüber und erörtert verschiedene didaktische Umsetzungsmöglichkeiten.
Das vierte Kapitel präsentiert eine exemplarische Darstellung didaktischer Umsetzungsmöglichkeiten anhand der Bartimäusgeschichte. Es beleuchtet den exegetischen Hintergrund der Geschichte und analysiert didaktische Aspekte unter dem Gesichtspunkt der Glaubensgeschichte, Handlungsanweisungen und Hoffnungsbilder.
Schlüsselwörter
Wundergeschichten, Wunderverständnis, Grundschule, Religionspädagogik, entwicklungspsychologische Voraussetzungen, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Fritz Oser, Paul Gmünder, James W. Fowler, didaktische Umsetzung, Bartimäusgeschichte, exegetischer Hintergrund.
- Quote paper
- Britta Wüst (Author), 2005, Probleme und Perspektiven der Wunderdidaktik in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/58530