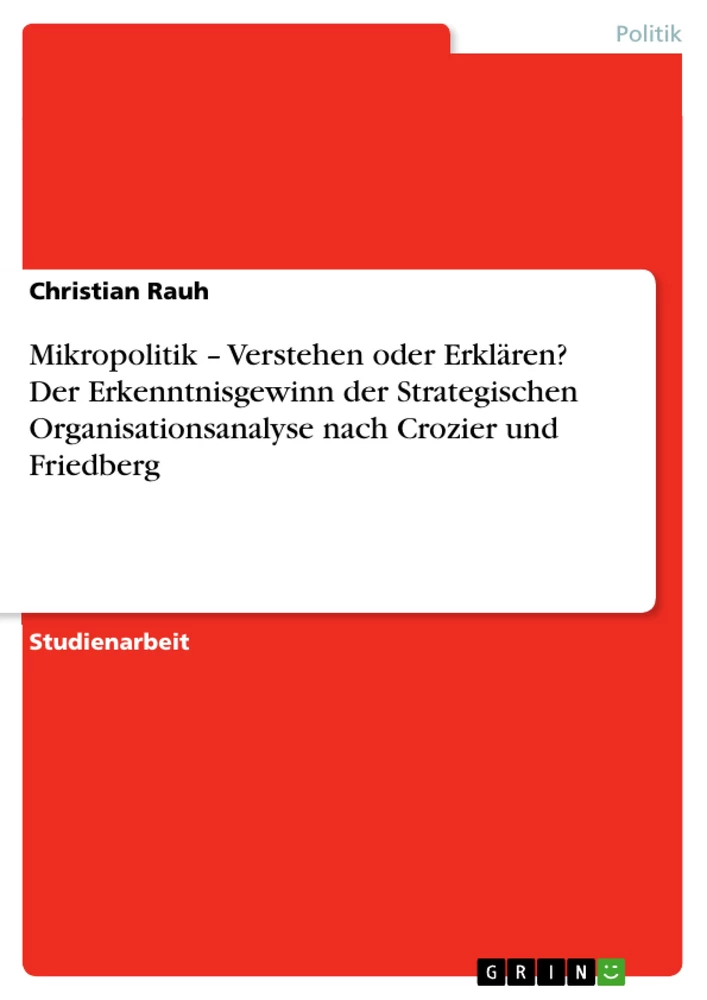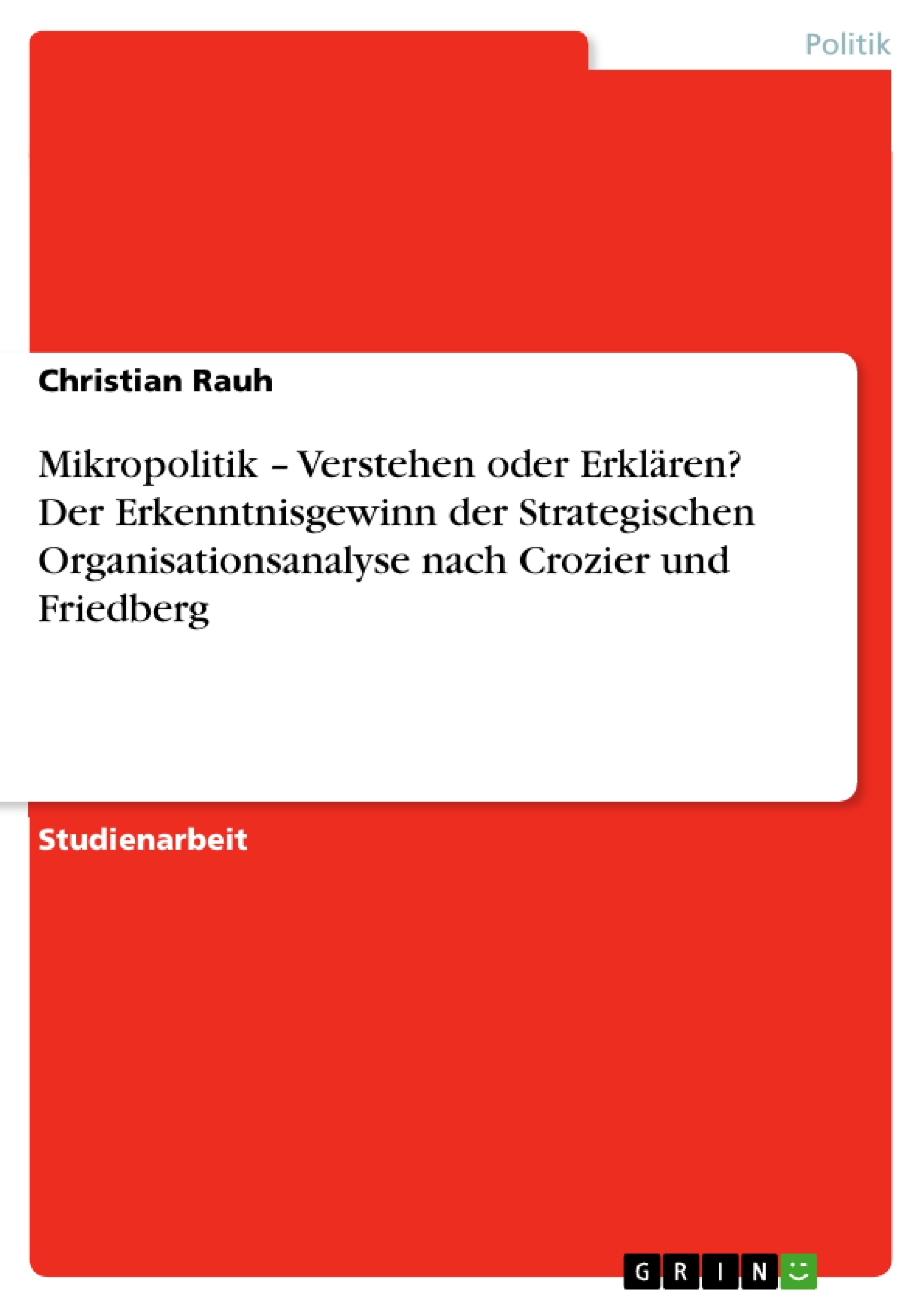1. Einleitung
Organisationen sind heute ein zentrales, wenn nicht sogar das konstituierende Element moderner Gesellschaften. Charles Perrow ging bereits 1991 soweit zu behaupten, dass große Organisationen die Gesellschaft absorbiert hätten und als ihr Surrogat fungierten. Obwohl diese weitreichende These, die auf Lohnabhängigkeit, der Externalitätenlogik und auf hierarchischer Bürokratie basiert, kaum noch zeitgemäß und daher diskussionswürdig ist, kann doch jeder Einzelne leicht die herausragende gesellschaftliche Stellung von Organisationen nachvollziehen. Indem man sich überlegt, welchen und vor allem wie vielen Organisationen man selbst angehört oder verbunden ist, wird deutlich, wie weitgehend der individuelle Alltag strukturiert bzw. „organisiert“ ist. Zu denken sei zum Beispiel an den jeweiligen Arbeitgeber oder die Gemeinde, an das Land und den Staat, in dem man lebt. In Betracht zu ziehen sind auch Parteien, Verbände oder Sport- und sonstige Vereine. Zu betonen ist weiterhin, dass man sich einer solchen „Organisiertheit“ kaum entziehen kann, da häufig Zwangs- oder zumindest wenig selbst bestimmte Mitgliedschaften bestehen. Ein Beispiel dafür ist u.a. die Krankenversicherungspflicht. Alle beispielhaft aufgeführten Systeme – die Liste ließe sich beliebig erweitern – zeichnen sich durch spezifische Ziele, eine geregelte Arbeits- bzw. Beitragsteilung und mehr oder weniger feste Grenzen aus. Ohne theoriegeleitenden Definitionen vorweggreifen zu wollen, lassen sie sich somit im allgemeinen Sinne als Organisationen begreifen (vgl. Schreyögg 1996: 9-11). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Strategische Organisationsanalyse nach Crozier und Friedberg
- Die Erklärungskraft des Ansatzes
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Strategischen Organisationsanalyse nach Crozier und Friedberg und untersucht deren Erklärungskraft. Sie untersucht, welchen Erkenntnisgewinn dieser Ansatz für das Verständnis von Machtprozessen in Organisationen bietet.
- Die Bedeutung der Strategischen Organisationsanalyse für das Verständnis von Organisationen
- Die Rolle des individuellen Akteurs in organisationalen Machtprozessen
- Die Grenzen der Strategischen Organisationsanalyse
- Die Bedeutung von Mikropolitik für die Organisationstheorie
- Die Anwendung des Ansatzes von Crozier und Friedberg auf konkrete Fallbeispiele
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz von Organisationen für die moderne Gesellschaft dar und zeigt die Notwendigkeit einer akteurszentrierten Perspektive auf. Sie führt den Forschungsgegenstand, die Strategische Organisationsanalyse nach Crozier und Friedberg, ein und erläutert die Forschungsfrage. - Kapitel 2: Die Strategische Organisationsanalyse nach Crozier und Friedberg
Dieses Kapitel stellt den Ansatz von Crozier und Friedberg im Detail vor. Es erläutert die zentralen Konzepte der Macht, der Strategien und der Strukturen. Der Fokus liegt auf der Analyse der individuellen Akteure und ihrer Interaktionen in Organisationen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Mikropolitik, Strategische Organisationsanalyse, Macht, Individuum, Organisation, Crozier und Friedberg.
- Quote paper
- Christian Rauh (Author), 2005, Mikropolitik – Verstehen oder Erklären? Der Erkenntnisgewinn der Strategischen Organisationsanalyse nach Crozier und Friedberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/57150