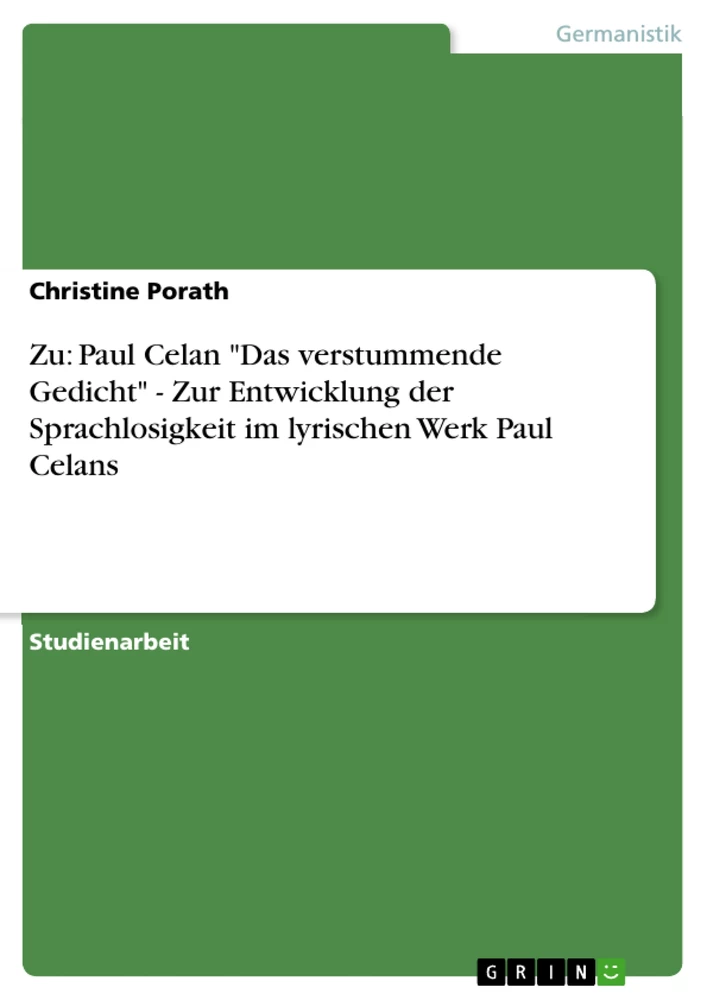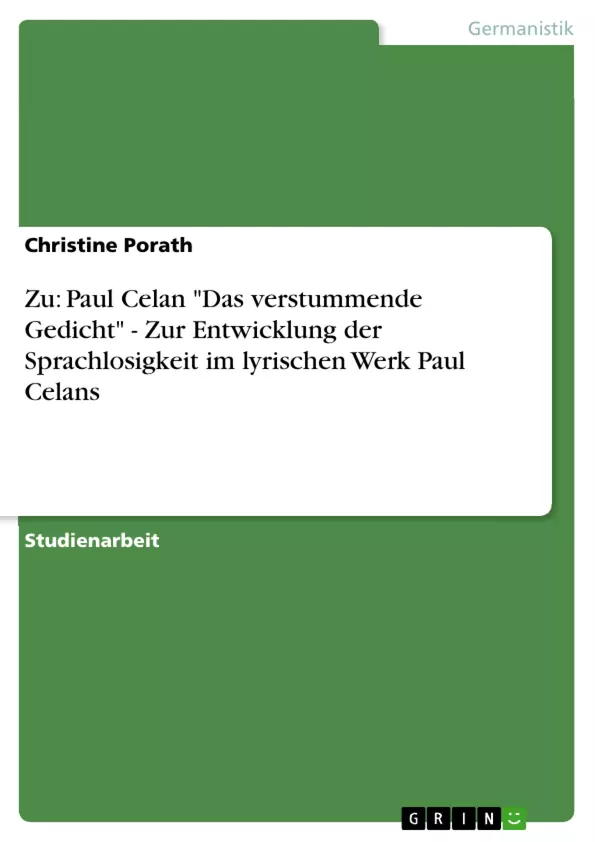Als im Sommer 1945 der Zweite Weltkrieg und damit der Schrecken des antisemitischen Nationalsozialismus’ ein Ende fand, breitete sich die Erleichterung darüber nicht nur in der Masse der Bevölkerung, sondern auch bei den Deutschen und Juden im Exil aus. In das Nachkriegsdeutschland kehrten nun auch nach und nach die ins Exil gegangenen Schriftsteller zurück, die im Exil weiterhin deutschsprachige Literatur verfasst hatten. Anders verhielt es sich jedoch mit dem deutschsprachigen Lyriker Paul Celan, zumal er auch eine andere Seite nicht nur des Krieges, sondern auch des Dritten Reiches erleben musste. Die meisten Schriftsteller, überwiegend deutschstämmig, nahmen entweder aktiv am Krieg teil oder beobachteten die Geschehnisse aus einem anderen Land. Celan war als Jude jedoch vielmehr dem deutschen Antisemitismus ausgesetzt, er musste die Folgen der Judenvernichtung im Ausland miterleben und konnte wie alle anderen Juden nur versuchen irgendwie zu überleben.
In seiner Lyrik versucht Celan diese Geschehnisse zu vergegenwärtigen, nicht alleine um sie zu verarbeiten, sondern vielmehr um die Erinnerung daran wach zu halten, für sich und das ganze deutsche Volk. Die Aufgabe, die Celan sich damit gestellt hatte, grenzte an den Versuch das Unsagbare dieses Schreckens in Worte zu fassen; ein Ringen um Worte in einer Sprache, die durch den Missbrauch der Nazis fast unbrauchbar geworden war, um die vergangenen und gegenwärtigen Ereignisse adäquat ausdrücken zu können.
Dieses Ringen um Worte spiegelt sich deutlich zunehmend in der Lyrik Celans wieder, ein Ringen, das nahe am Verstummen zu sein scheint. Um diese Entwicklung nachzuvollziehen, soll in dieser Arbeit der Weg der Lyrik Celans anhand einiger Werke, die exemplarisch für die jeweilige Schaffensperiode stehen, nachskizziert werden. Hierbei geht es hauptsächlich darum, die typischen Merkmale der Celanschen Poetik zu einem bestimmten Zeitpunkt an Beispielen aufzuzeigen. Diese Betrachtung kann ebenfalls nicht alle Eigenheiten der Lyrik Celans berücksichtigen, da diese zu vielschichtig ist, um alle Motive und Besonderheiten auf engem Raum darstellen zu können. Daher beschränkt sich die Abhandlung auf das Moment des Sprechens, d.h. die Thematisierung und Problematisierung des Sprechens und der allmählichen Verstummung im Gedicht, selbst wenn dies der Vielschichtigkeit und Komplexität im Gesamtzusammenhang der Celanschen Poetik nicht annähernd gerecht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Entwicklung der Lyrik Celans – Der Weg des verstummenden Gedichts
- 2.1. Mohn und Gedächtnis
- 2.2. Von Schwelle zu Schwelle
- 2.3. Sprachgitter und Die Niemandsrose
- 2.4. Atemwende
- 2.5. Ausblick
- 3. Zusammenfassung
- 4. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Sprachlosigkeit in Paul Celans lyrischem Werk nachzuzeichnen. Sie untersucht, wie Celans dichterisches Schaffen von seinen Erfahrungen mit dem Holocaust und dem Problem der deutschen Sprache als Muttersprache und Sprache der Täter geprägt wurde. Die Arbeit konzentriert sich auf die allmähliche Verstummung in Celans Gedichten und analysiert, wie diese Entwicklung in seinen Werken zum Ausdruck kommt.
- Die Problematik der deutschen Sprache nach dem Holocaust
- Die Verarbeitung des Traumas durch die Lyrik
- Die Entwicklung der Sprachlosigkeit in Celans Werk
- Der Einfluss der Biographie auf Celans Poetik
- Die Rezeption von Celans Lyrik im Nachkriegsdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt Paul Celans besondere Situation als deutschsprachiger jüdischer Lyriker nach dem Holocaust dar. Sie beleuchtet den Konflikt zwischen seiner Muttersprache und der Sprache der Täter, den Celan in seiner Lyrik thematisiert. Der Essay kündigt die Analyse von Celans Werk an, die sich auf die Entwicklung seiner Sprachlosigkeit konzentrieren wird, und betont die Unausweichlichkeit, Celans Biografie bei der Interpretation seiner Gedichte zu berücksichtigen. Die Einleitung endet mit einer Eingrenzung des Forschungsgegenstandes auf das Thema Sprechen und Verstummen in Celans Gedichten.
2. Zur Entwicklung der Lyrik Celans – Der Weg des verstummenden Gedichts: Dieses Kapitel skizziert die Entwicklung von Celans Lyrik, beginnend mit frühen Gedichten, die noch stark von der Tradition geprägt sind, bis hin zu Werken, in denen die Sprachlosigkeit immer präsenter wird. Es wird exemplarisch auf einige seiner Gedichtbände eingegangen, ohne jedoch einzelne Gedichte im Detail zu interpretieren. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung, wie Celans Poetik sich im Laufe der Zeit verändert und das Thema des Sprechens und der Sprachlosigkeit immer stärker in den Vordergrund rückt. Biografische und zeitgeschichtliche Bezüge werden als relevant für das Verständnis von Celans Werk dargestellt.
2.1. Mohn und Gedächtnis: Diese Zusammenfassung analysiert Celans Gedichtband "Mohn und Gedächtnis", der in seiner formalen Gestaltung noch relativ traditionsbewusst ist, mit intakter Syntax und Reim. Obwohl formale Elemente der Tradition verpflichtet sind, manifestieren sich bereits die ersten Anzeichen einer sich entwickelnden Sprachlosigkeit und der Auseinandersetzung mit dem Trauma des Holocausts. Das Kapitel beleuchtet den bekannten Gedichtzyklus und seine Bedeutung innerhalb des Gesamtwerks Celans, und zeigt die ambivalenten Möglichkeiten und Grenzen der sprachlichen Darstellung des Unerträglichen auf. Der Bezug zu Celans vorherigen, zurückgezogenen Band "Der Sand aus den Urnen" und die Entstehung des bekannten Gedichts "Todesfuge" wird ebenfalls eingeordnet.
Schlüsselwörter
Paul Celan, Lyrik, Sprachlosigkeit, Holocaust, Trauma, deutsche Sprache, Muttersprache, Mohn und Gedächtnis, Todesfuge, Nachkriegsliteratur, Sprechen, Verstummen, Poetik, Biographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung der Sprachlosigkeit in Paul Celans Lyrik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Sprachlosigkeit in Paul Celans lyrischem Werk. Sie analysiert, wie Celans dichterisches Schaffen von seinen Erfahrungen mit dem Holocaust und dem Problem der deutschen Sprache als Muttersprache und Sprache der Täter geprägt wurde und wie sich diese Entwicklung in seinen Werken manifestiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Problematik der deutschen Sprache nach dem Holocaust, die Verarbeitung des Traumas durch die Lyrik, die Entwicklung der Sprachlosigkeit in Celans Werk, den Einfluss der Biographie auf Celans Poetik und die Rezeption von Celans Lyrik im Nachkriegsdeutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Entwicklung der Lyrik Celans (mit Unterkapiteln zu einzelnen Gedichtbänden wie "Mohn und Gedächtnis"), eine Zusammenfassung und einen Anhang. Das Hauptkapitel beleuchtet exemplarisch Celans Entwicklung von traditionelleren Formen hin zu einer zunehmenden Sprachlosigkeit.
Wie wird das Thema "Sprachlosigkeit" in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit verfolgt die zunehmende Sprachlosigkeit in Celans Gedichten über die Zeit hinweg. Es wird untersucht, wie sich diese Sprachlosigkeit in der formalen Gestaltung und den inhaltlichen Themen seiner Gedichte zeigt. Dabei wird die Beziehung zwischen Celans Biografie und seiner Poetik betont.
Welche Rolle spielt Celans Biografie?
Celans Biografie, insbesondere seine Erfahrungen mit dem Holocaust und die Problematik der deutschen Sprache, spielt eine zentrale Rolle im Verständnis seiner Lyrik und seiner Entwicklung zur Sprachlosigkeit. Die Arbeit betont die Unausweichlichkeit, Celans Biografie bei der Interpretation seiner Gedichte zu berücksichtigen.
Wird "Mohn und Gedächtnis" im Detail behandelt?
Das Kapitel 2.1 analysiert den Gedichtband "Mohn und Gedächtnis" als Beispiel für die frühe Phase von Celans Werk. Es untersucht, wie trotz noch relativ traditioneller Formen bereits die ersten Anzeichen einer sich entwickelnden Sprachlosigkeit und die Auseinandersetzung mit dem Trauma des Holocausts sichtbar werden. Der Bezug zu "Der Sand aus den Urnen" und "Todesfuge" wird ebenfalls hergestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Paul Celan, Lyrik, Sprachlosigkeit, Holocaust, Trauma, deutsche Sprache, Muttersprache, Mohn und Gedächtnis, Todesfuge, Nachkriegsliteratur, Sprechen, Verstummen, Poetik, Biographie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Sprachlosigkeit in Paul Celans lyrischem Werk nachzuzeichnen und zu analysieren, wie diese Entwicklung in seinen Werken zum Ausdruck kommt.
- Quote paper
- Christine Porath (Author), 2006, Zu: Paul Celan "Das verstummende Gedicht" - Zur Entwicklung der Sprachlosigkeit im lyrischen Werk Paul Celans, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55502