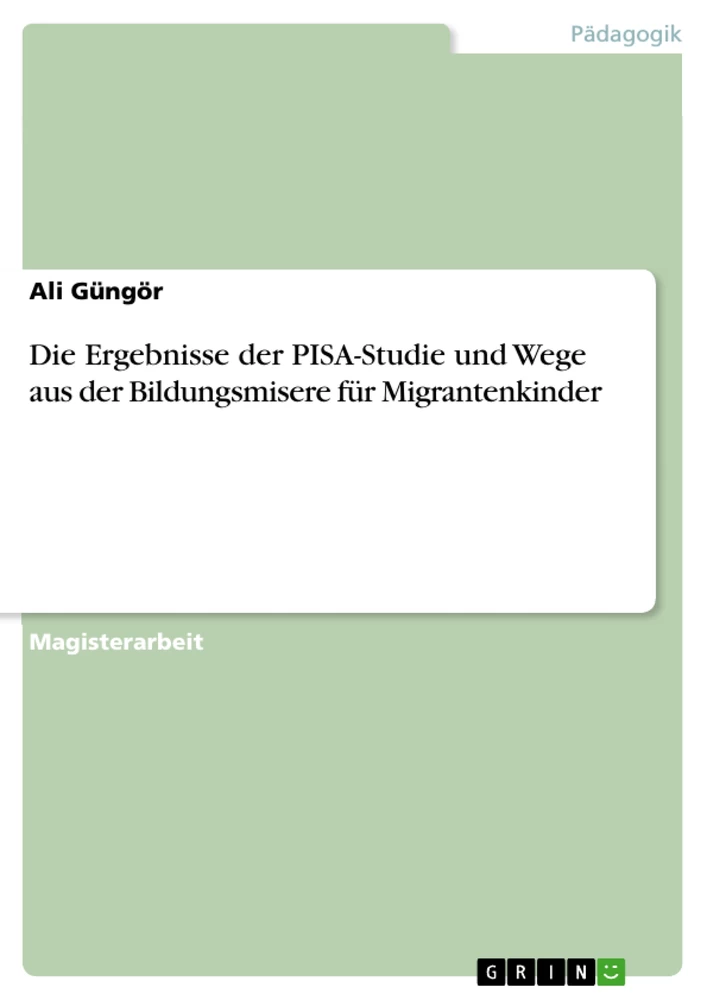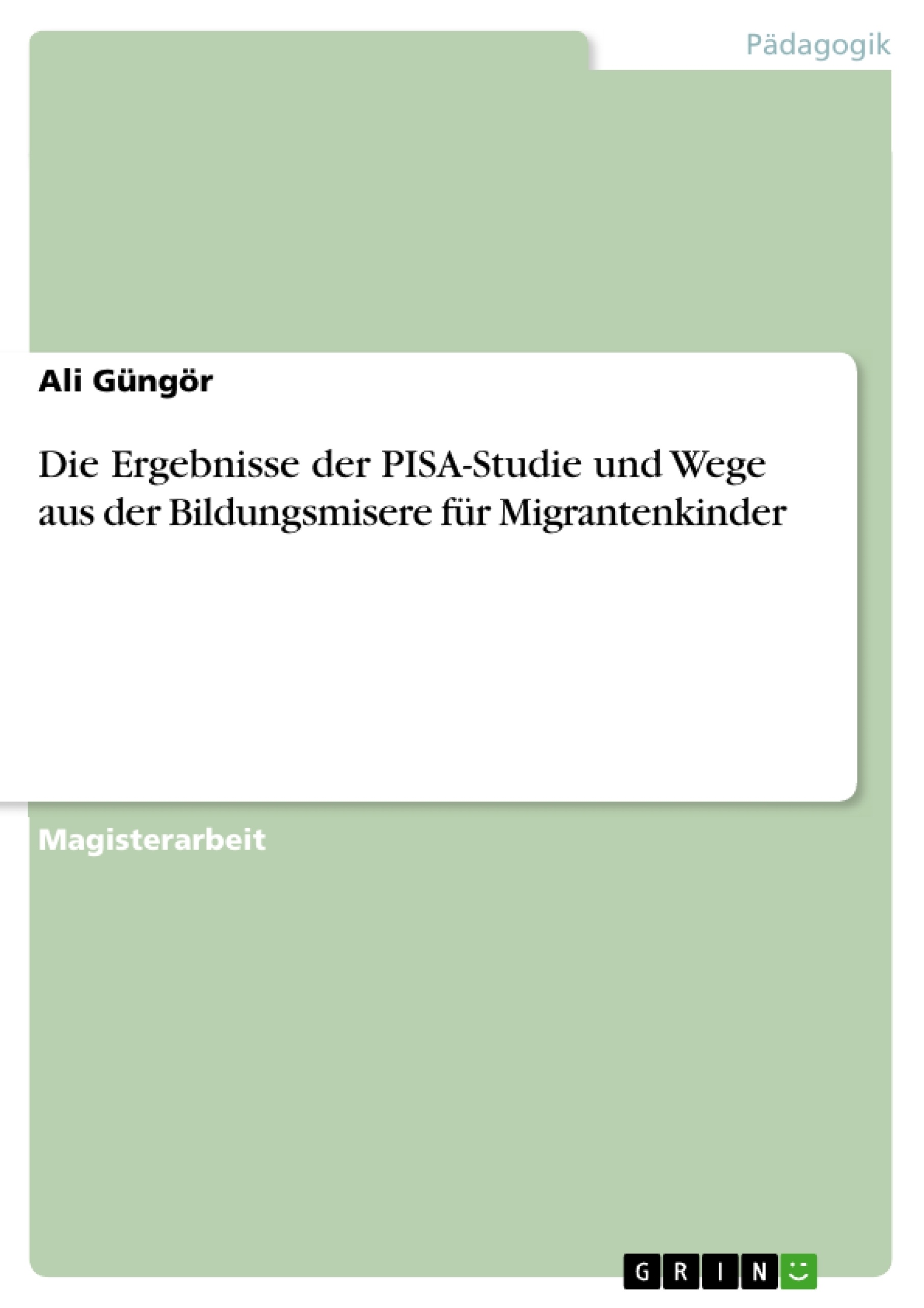Mit der internationalen PISA-Studie werden weltweit die drei Basiskompetenzen Leseverständnis, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern, die sich am Ende der Pflichtschulzeit befinden, untersucht. Der Schwerpunkt dieser internationalen Vergleichstudie lag im Jahr 2000 bei der Lesekompetenz woran insgesamt 32 Staaten teilnahmen. Am 4. Dezember 2001 wurde von der OECD in Paris und zeitgleich in Berlin der nationale PISA-Bericht über die erste Erhebung vorgelegt. Doch die Ergebnisse waren für Deutschland wenig erfreulich und erregten großes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Der sog. PISASchock hielt ganz Deutschland in seinem Bann. Im Durchschnitt erreichten die deutschen Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum OECD-Durchschnitt in allen drei Kompetenzbereichen Leistungen, die nur im unteren Mittelfeld der Teilnehmerstaaten lagen. Besonders alarmierend ist dabei gewesen, dass Rund ein Viertel der deutschen Jugendlichen in der Lesekompetenz nicht über die schwächste Stufe hinaus kommt und damit ein wenig erfolgreiches und unbefriedigendes Leben vor sich hat. Das schlechte Abschneiden in der Lesekompetenz hatte dabei auch die Ergebnisse der mathematischen sowie der naturwissenschaftlichen Grundbildung negativ beeinflusst. Doch in Anbetracht der im Jahre1997 veröffentlichten Ergebnisse der TIMS-Studie (Third international math and science study) war das schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich nicht sehr überraschend.
Die PISA-Studie jedoch unterscheidet sich deutlich von den vorangegangenen international vergleichenden empirischen Schulleistungsuntersuchungen. „So wird neben den kognitiven Leistungen die Leistungsdifferenz zwischen guten und schlechten Schülern gemessen, es wird der Frage nach dem Zusammenhang von Migrationshintergrund und Schulleistungen nachgegangen, es werden gemessene Schulleistungen und Beteiligungsquoten an höheren Bildungsabschlüssen thematisiert und last but not least wird untersucht, wie ausgeprägt der Zusammenhang zwischen familiären Lebensverhältnissen der Schülerinnen und Schüler und ihrem Schulerfolg ist“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel I Grundlagen zur PISA-Studie
- Kapitel II PISA-2000: Einblick in Testkonzeption und Ergebnisse
- 1. Die Lesekompetenz
- 1.1 Allgemeines über die Lesekompetenz
- 1.2 Das Konzept der Lesekompetenz nach PISA
- 1.3 Die Ergebnisse zum internationalen Vergleich
- 2. Die mathematische Kompetenz
- 2.1 Das Konzept der mathematischen Kompetenz nach PISA
- 2.2 Ergebnisse zum internationalen Vergleich
- 2.3 Die Leistungsverteilung in den unterschiedlichen Schulformen
- 3. Die naturwissenschaftliche Kompetenz
- 3.1 Das Konzept des naturwissenschaftlichen Tests nach PISA
- 3.2 Der internationale Vergleich der mittleren Leistung und der Kompetenzstufen
- 3.3 Verteilung der Kompetenzleistungen in den Bildungsgängen
- 4. Zusammenfassung der deutschen Ergebnisse für PISA-2000
- 1. Die Lesekompetenz
- Kapitel III Die PISA-Ergebnisse hinsichtlich der Sozialschichtzugehörigkeit
- Kapitel IV Die PISA-Ergebnisse hinsichtlich Migration
- Kapitel V Zur Benachteiligung von Migrantenkindern durch das deutsche Schulsystem
- Kapitel VI Wege aus der Bildungsmisere für Migrantenkinder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie, insbesondere im Hinblick auf die Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, die bestehenden Bildungsungleichheiten aufzuzeigen und konkrete Lösungsansätze für eine Verbesserung der Bildungssituation dieser Kinder zu entwickeln.
- Analyse der PISA-Ergebnisse im Kontext von Migrationshintergrund
- Aufzeigen von Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung
- Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit
- Bewertung der Rolle des deutschen Schulsystems bei der Benachteiligung von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I Grundlagen zur PISA-Studie: Dieses Kapitel legt die methodischen Grundlagen der PISA-Studie dar. Es beschreibt das Anliegen, das inhaltliche Konzept, die beteiligten Nationen, die Durchführung, die Stichprobe, die Erhebungsmethoden, den Erhebungszyklus und die Ergebnisse der Studie. Besondere Beachtung finden die Kompetenzstufen, die Ausschlusskriterien und die Möglichkeiten nationaler Ergänzungen. Das Kapitel liefert somit das notwendige Verständnis des methodischen Rahmens für die Interpretation der folgenden Kapitel.
Kapitel II PISA-2000: Einblick in Testkonzeption und Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der PISA-2000 Studie in den Bereichen Lesekompetenz, mathematische Kompetenz und naturwissenschaftliche Kompetenz. Für jede Kompetenz wird das jeweilige Konzept nach PISA erläutert, inklusive der Definition, der Erfassung im Test und der Einteilung in Kompetenzstufen. Die Ergebnisse werden im internationalen Vergleich präsentiert, wobei Mittelwerte, erreichte Kompetenzstufen und die freiwillige Leseaktivität betrachtet werden. Die Leistungsverteilung in verschiedenen Schulformen wird ebenfalls analysiert, um ein umfassendes Bild der deutschen Schülerleistungen zu liefern. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Leistungen im internationalen Kontext und der Identifizierung von Stärken und Schwächen des deutschen Bildungssystems.
Kapitel III Die PISA-Ergebnisse hinsichtlich der Sozialschichtzugehörigkeit: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der sozialen Schicht auf den Kompetenzerwerb. Es definiert die Konzeption der sozialen Herkunft nach PISA, inklusive sozioökonomischem Index, kulturellem und sozialem Kapital. Die familiären Lebensverhältnisse der Schüler und Schülerinnen werden analysiert, und der Zusammenhang zwischen Bildungsbeteiligung und sozialer Schicht wird beleuchtet. Im Kern geht es um die Darstellung und Analyse der Leistungsdifferenzen zwischen verschiedenen sozialen Schichten in den drei Kompetenzbereichen (Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften) und ihren Ursachen, sowohl im deutschen Kontext als auch international.
Kapitel IV Die PISA-Ergebnisse hinsichtlich Migration: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Ergebnisse der PISA-Studie im Hinblick auf Schüler mit Migrationshintergrund. Es beleuchtet die Migrationsverteilung in den PISA-Ländern, die Migrationsstatistik in Deutschland und die Migrationsgeschichte Deutschlands. Die Strukturmerkmale von Familien mit Migrationshintergrund sowie deren sozioökonomischer Status im internationalen Vergleich werden ausführlich untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Bildungsbeteiligung und des Kompetenzerwerbs von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu ihren Altersgenossen ohne Migrationshintergrund, sowohl innerhalb Deutschlands als auch im internationalen Kontext.
Kapitel V Zur Benachteiligung von Migrantenkindern durch das deutsche Schulsystem: Dieses Kapitel analysiert die Benachteiligung von Migrantenkindern im deutschen Schulsystem. Es beleuchtet die sozialen Ungleichheiten und deren Reproduktion im Schulsystem, die "institutionelle Diskriminierung" von Migrantenkindern und den Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und gemessener Kompetenz. Der Pygmalion-Effekt und die Problematik der Hauptschulen als "Ausländerschulen" werden diskutiert. Das Kapitel liefert eine kritische Auseinandersetzung mit den strukturellen Faktoren, die zur Benachteiligung beitragen.
Schlüsselwörter
PISA-Studie, Bildungsmisere, Migrantenkinder, soziale Ungleichheit, Kompetenzerwerb, Lesekompetenz, mathematische Kompetenz, naturwissenschaftliche Kompetenz, Bildungsgerechtigkeit, frühe Förderung, Schulsystem, Integrationspolitik.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Analyse der PISA-Studie im Hinblick auf die Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie, insbesondere die Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, bestehende Bildungsungleichheiten aufzuzeigen und Lösungsansätze für eine Verbesserung ihrer Bildungssituation zu entwickeln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der PISA-Ergebnisse im Kontext von Migrationshintergrund, zeigt Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund auf, untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung, entwickelt Strategien zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit und bewertet die Rolle des deutschen Schulsystems bei der Benachteiligung von Migrantenkindern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel I: Grundlagen zur PISA-Studie: Erklärt die Methodik der PISA-Studie, inklusive Anliegen, Konzept, beteiligten Nationen, Durchführung, Stichprobe, Methoden und Ergebnisse. Behandelt Kompetenzstufen, Ausschlusskriterien und nationale Ergänzungen.
Kapitel II: PISA-2000: Einblick in Testkonzeption und Ergebnisse: Präsentiert die Ergebnisse von PISA-2000 in den Bereichen Lesekompetenz, mathematische Kompetenz und naturwissenschaftliche Kompetenz. Erläutert die Konzepte nach PISA, den internationalen Vergleich der Leistungen und die Leistungsverteilung in verschiedenen Schulformen.
Kapitel III: Die PISA-Ergebnisse hinsichtlich der Sozialschichtzugehörigkeit: Untersucht den Einfluss der sozialen Schicht auf den Kompetenzerwerb, definiert die Konzeption der sozialen Herkunft nach PISA und analysiert den Zusammenhang zwischen Bildungsbeteiligung und sozialer Schicht.
Kapitel IV: Die PISA-Ergebnisse hinsichtlich Migration: Konzentriert sich auf die Ergebnisse der PISA-Studie für Schüler mit Migrationshintergrund. Beleuchtet die Migrationsverteilung, die Migrationsstatistik in Deutschland und die Bildungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vergleich.
Kapitel V: Zur Benachteiligung von Migrantenkindern durch das deutsche Schulsystem: Analysiert die Benachteiligung von Migrantenkindern im deutschen Schulsystem, beleuchtet soziale Ungleichheiten und die "institutionelle Diskriminierung". Diskutiert den Pygmalion-Effekt und die Problematik der Hauptschulen als "Ausländerschulen".
Kapitel VI: Wege aus der Bildungsmisere für Migrantenkinder: (Inhalt nicht explizit in der Vorschau beschrieben, aber implizit im Fazit der Zielsetzung enthalten.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
PISA-Studie, Bildungsmisere, Migrantenkinder, soziale Ungleichheit, Kompetenzerwerb, Lesekompetenz, mathematische Kompetenz, naturwissenschaftliche Kompetenz, Bildungsgerechtigkeit, frühe Förderung, Schulsystem, Integrationspolitik.
Welche konkreten Ergebnisse werden in Kapitel II vorgestellt?
Kapitel II präsentiert internationale Vergleiche der mittleren Leistungen in Lesekompetenz, mathematischer Kompetenz und naturwissenschaftlicher Kompetenz. Es werden erreichte Kompetenzstufen und die freiwillige Leseaktivität betrachtet. Die Leistungsverteilung in verschiedenen Schulformen wird ebenfalls analysiert.
Wie wird die soziale Schicht in der Arbeit definiert?
Die soziale Schicht wird nach der Konzeption der PISA-Studie definiert, inklusive sozioökonomischem Index, kulturellem und sozialem Kapital. Die familiären Lebensverhältnisse der Schüler werden analysiert.
Welche Aspekte der Migration werden im Kapitel IV betrachtet?
Kapitel IV betrachtet die Migrationsverteilung in den PISA-Ländern, die Migrationsstatistik in Deutschland, die Migrationsgeschichte Deutschlands, die Strukturmerkmale von Familien mit Migrationshintergrund und deren sozioökonomischen Status im internationalen Vergleich. Es analysiert die Bildungsbeteiligung und den Kompetenzerwerb von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Vergleich.
Welche Kritikpunkte am deutschen Schulsystem werden in Kapitel V angesprochen?
Kapitel V kritisiert soziale Ungleichheiten und deren Reproduktion im Schulsystem, die "institutionelle Diskriminierung" von Migrantenkindern und den Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und gemessener Kompetenz. Der Pygmalion-Effekt und die Problematik der Hauptschulen als "Ausländerschulen" werden diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Ali Güngör (Autor:in), 2006, Die Ergebnisse der PISA-Studie und Wege aus der Bildungsmisere für Migrantenkinder, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55388