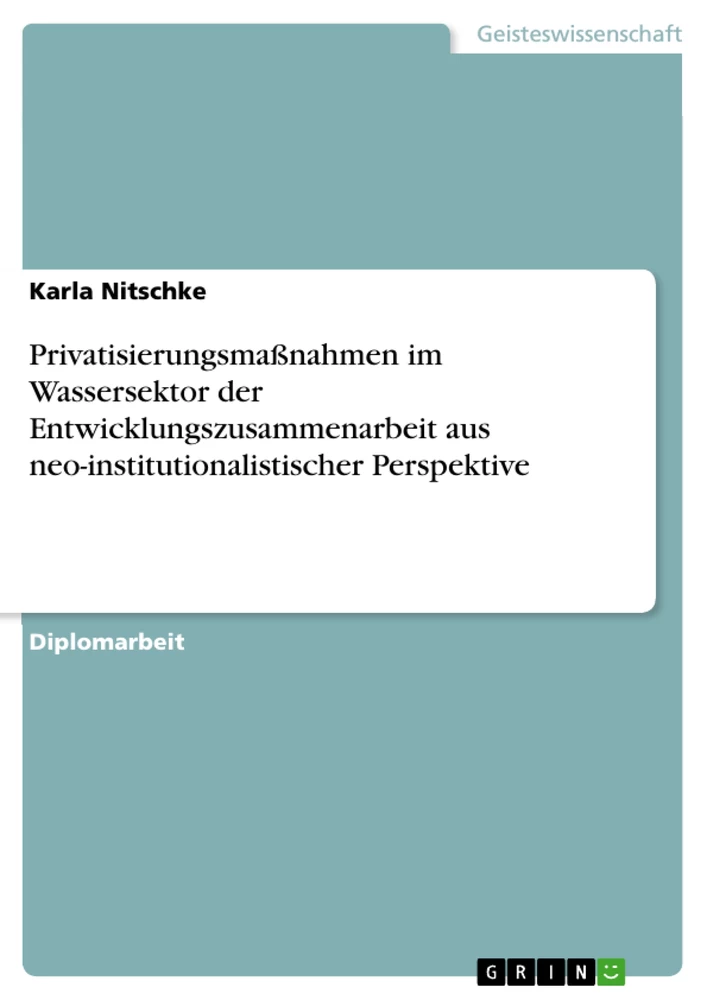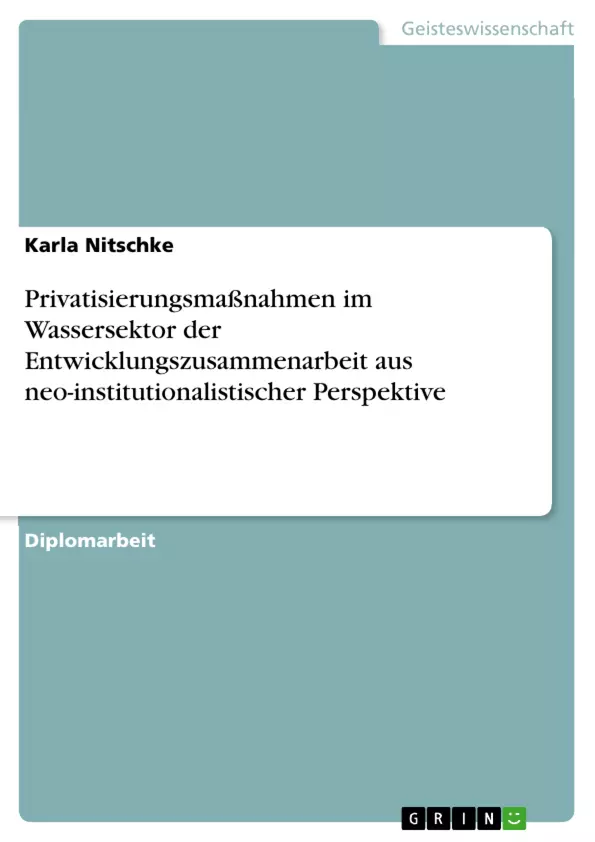Abstract
Als grundlegende Motivation internationaler Entwicklungszusammenarbeit wird meist die Sicherung menschlicher Grundbedürfnisse genannt. In diesem Zusammenhang kann man den gleichberechtigten Zugang zu sauberem Trinkwasser, das in knappen Zeiten stark umkämpft sein kann, als eines der wichtigsten Ziele betrachten. In einigen Entwicklungs- und Schwellenländern wurden öffentliche Güter in der Vergangenheit nicht im kommerziellen Sinne gehandelt, was nun im Zuge der zunehmenden Privatisierung dieser Güter zu öffentlichen Kontroversen führt.
In Rahmen dieser Diplomarbeit wird die globale Tendenz zur Privatisierung der Trinkwasserversorgung mit organisationssoziologischen Annahmen aus dem Theoriebereich des Neoinstitutionalismus analysiert. Entwicklung und Funktionsweise von Entwicklungsorganisationen und multinationalen Unternehmen werden dabei bezüglich ihres Einflusses auf zwei konkrete Privatisierungsprojekte im Wasser- und Abwassersektor von Manila und Buenos Aires exemplarisch genauer unter die Lupe genommen.
Der Text bietet zudem einen Einblick in die Entstehung des Entwicklungsparadigmas ‚Privatisierung’ auf institutioneller Ebene der Entwicklungsorganisationen, wobei ein besonderer Fokus auf die Rolle der Weltbank gelegt wird. Eine weitere Ebene bildet die Untersuchung der internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen, unter der Annahme, dass der veränderte Rechtsrahmen einen nicht unerheblichen Anteil an der zunehmenden Diffusion des Paradigmas hat.
Zusammenfassend können im Verhalten einiger internationaler Unternehmen diverse Strategien identifiziert werden, die vermuten lassen, dass nicht alleine das Streben nach wirtschaftlicher Effizienz, sondern auch der Drang nach Legitimierung des eigenen Handelns durch die Stakeholder das Verhalten bestimmen. Dabei wird die starke Ähnlichkeit zum Agieren der Entwicklungsorganisationen deutlich. Insgesamt kann gezeigt werden, dass Privatisierungsmaßnahmen, die im Rahmen von Entwicklungsprojekten durchgeführt werden durchaus denselben Problemen begegnen können, wie sie während der Durchführung herkömmlicher Projekte immer wieder entstehen. Schlussfolgernd wird somit die Frage gestellt, ob die Beteiligung von Partnern aus der Privatwirtschaft per se für eine positive Wirkung auf Entwicklungsprojekte stehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Einführung in den Untersuchungsgegenstand
- 1.1 Fragestellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Struktur der Arbeit
- 2. Theorien und Historie der Entwicklungspolitik
- 3. Entwicklung der Bedeutung von Privatisierungsmaßnahmen als entwicklungspolitisches Instrument
- 3.1 Begriffliche Prägung
- 3.1.1 Die Entwicklung von GATT, WTO, GATS und AKP-Vertrag
- 3.2 Erhoffte positive Effekte von Privatisierungsmaßnahmen
- 3.2.1 Erwartungen internationaler Finanz- und Entwicklungsinstitutionen und der Regierungen der Entwicklungsländer
- 3.2.2 Die Erwartungen der privaten Wirtschaft
- 3.3 Privatisierung im Wassersektor
- 3.3.1 Betreibermodelle
- 3.3.2 Lobbyisten und Konzerne der Wasser- und Abwasserindustrie
- 3.4 Probleme von Privatisierungen im Wassersektor
- 4. Theoretischer Teil - das Privatisierungskonzept aus neo-institutionalistischer Sicht
- 4.1 Forschungsfragen und Annahmen generiert anhand der Theorie des Neo-Institutionalismus
- 4.1.1 Der world-polity-Ansatz: eine Variante der Globalisierungs- und Weltgesellschaftsdiskussion
- 4.1.2 Die Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus
- 4.2 Die weltweite Verbreitung des Konzeptes der Privatisierung
- 4.3 Die Weltbank als zentraler Agent der Diffusion
- 4.3.1 Normenübernahme und Produktion des Privatisierungskonzeptes
- 4.3.2 Kopiervorgänge bei der Verbreitung von Projekten und Strategien
- 4.3.3 Implementierung
- 4.4 Die Wasserkonzerne als Teil des organisationalen Feldes der Weltbank
- 4.4.1 Konzerne als nach Legitimation strebende Organisationen
- 4.5 Internationale Handels- und Wirtschaftsabkommen als Beschleuniger der Verbreitung von Privatisierungsmaßnahmen
- 5. Methode zur Untersuchung der Projekte
- 5.1 Begründung der Fallauswahl
- 5.2 Vorgehen
- 6. Empirischer Teil – Projektanalysen
- 6.1 Der Privatisierungsprozess in Buenos Aires – Grundlegende Vereinbarungen
- 6.2 Struktur und Verlauf der Privatisierung
- 6.2.1 Zugang zu Wasser
- 6.2.2 Wasserverluste
- 6.2.3 Investitionen
- 6.2.4 Wasserpreis
- 6.2.5 Arbeiter
- 6.2.6 Effizienz der Regulierung
- 6.3 Analyse und Bewertung der Privatisierung in Buenos Aires aus neo-institutionalistischer Perspektive
- 6.4 Die Privatisierung der Wasserversorgung in Manila - Grundlegende Vereinbarungen
- 6.5 Struktur und Verlauf der Privatisierung
- 6.5.1 Zugang zu Wasser
- 6.5.2 Wasserverluste
- 6.5.3 Investitionen
- 6.5.4 Wasserpreis
- 6.5.5 Arbeiter
- 6.5.6 Effizienz der Regulierung
- 6.6 Analyse und Bewertung der Privatisierungen in Manila aus neo-institutionalistischer Perspektive
- 6.7 Synthese der Analysen
- 6.7.1 Monopolisierungsstrategien
- 6.7.2 Bietstrategien
- 6.7.3 Die Unterschätzung von Kosten und die Überschätzung von Einnahmen
- 6.7.4 Die Schwächung der Regulierungsbehören
- 6.7.5 Strategien der nachträglichen Rationalisierung
- Die Verbreitung von Privatisierungsmaßnahmen als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit
- Die Rolle der Weltbank bei der Diffusion von Privatisierungskonzepten
- Die Interessen und Strategien der Wasserkonzerne in diesem Kontext
- Die Auswirkungen von Privatisierung auf die Wasserversorgung und die Menschen in Entwicklungsländern
- Die Bewertung der Privatisierung aus neo-institutionalistischer Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Privatisierungsmaßnahmen im Wassersektor der Entwicklungszusammenarbeit aus neo-institutionalistischer Perspektive. Sie analysiert die Verbreitung von Privatisierungskonzepten und -strategien durch internationale Akteure wie die Weltbank und die Rolle der Wasserkonzerne in diesem Prozess.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Untersuchungsgegenstand, die die Fragestellung und die Struktur der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel werden Theorien und Historie der Entwicklungspolitik sowie die Entwicklung der Bedeutung von Privatisierungsmaßnahmen als entwicklungspolitisches Instrument beleuchtet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Privatisierung im Wassersektor, einschließlich der Betreibermodelle, der Interessen der Lobbyisten und Konzerne und der Probleme von Privatisierungen in diesem Bereich. Der vierte Kapitel widmet sich dem Privatisierungskonzept aus neo-institutionalistischer Sicht, wobei der world-polity-Ansatz, die Mikrofundierung des soziologischen Neo-Institutionalismus und die Rolle der Weltbank als zentraler Agent der Diffusion untersucht werden. Das fünfte Kapitel beschreibt die Methode zur Untersuchung der Projekte, einschließlich der Fallauswahl und des Vorgehens. Der empirische Teil der Arbeit umfasst die Projektanalysen in Buenos Aires und Manila, wobei die Struktur und der Verlauf der Privatisierungen, die Auswirkungen auf den Zugang zu Wasser, die Wasserverluste, die Investitionen, den Wasserpreis, die Arbeiter und die Effizienz der Regulierung untersucht werden. Die Arbeit schließt mit einer Synthese der Analysen und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Privatisierung, Wassersektor, Entwicklungszusammenarbeit, Neo-Institutionalismus, Weltbank, Wasserkonzerne, Monopolisierung, Bietstrategien, Kosten- und Einnahmenüberschätzung, Schwächung der Regulierungsbehören, strategische Rationalisierung.
- Quote paper
- Diplom-Soziologin Karla Nitschke (Author), 2005, Privatisierungsmaßnahmen im Wassersektor der Entwicklungszusammenarbeit aus neo-institutionalistischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55297