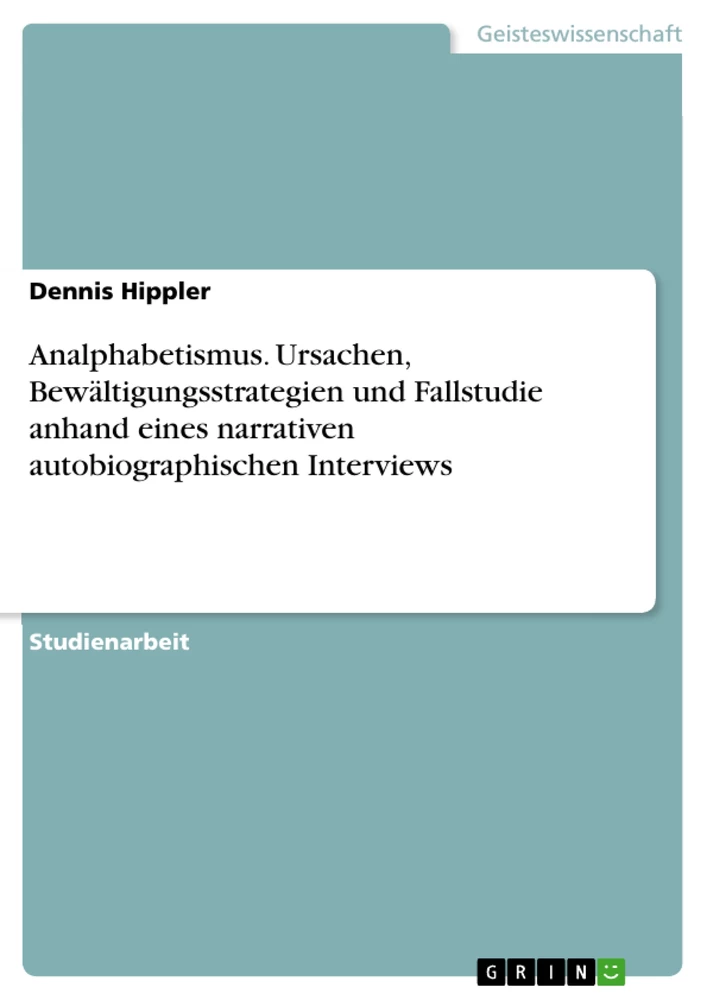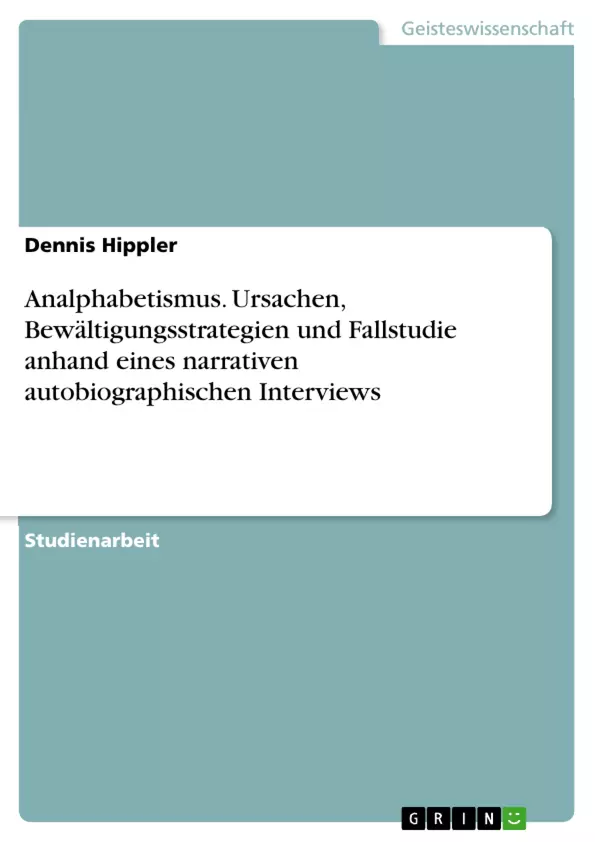Mein Forschungsinteresse richtet sich dabei primär auf die Ursachen von Analphabetismus sowie alltägliche Handlungsstrategien und Bewältigungsmuster der Betroffenen. Denn als `Outsider` kam mir der Analphabetismus von erwachsenen Menschen in unserer „Wissensgesellschaft“ sehr fremd vor.
Im Rahmen meines Soziologie-Studiums besuchte ich zwei Semester lang die am Institut für Soziologie angebotene „Forschungswerkstatt qualitative Sozialforschung“, um Kenntnisse im Bereich der Erfassung und Auswertung narrativer Interviews zu erlangen. Während dieser Zeit entwickelte ich ein persönliches Interesse am Phänomen des Analphabetismus, das wider eigenen Erwartens in Deutschland selbst heutzutage noch stark ausgeprägt zu sein scheint. „Nach Schätzungen des Deutschen UNESCO-Institutes sind zwischen 0,75 und 3% der erwachsenen deutschen Bevölkerung in der Bundesrepublik funktionale Analphabeten.“ (Städtische Volkshochschule Magdeburg, S. 6)
Diese Zahlen erstaunten mich so sehr, dass ich beschloss, Kontakt mit Analphabeten aufzunehmen, um Bereitwillige unter ihnen zu interviewen. Über die Städtische Volkshochschule, welche seit 1993 zahlreiche Alphabetisierungskurse durchführt, fand ich Zugang zu einer sehr heterogenen Gruppe von etwa 15 Teilnehmern, von denen sich letztlich zwei bereiterklärten, mir in jeweils einem Interview ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Eines der beiden geführten Interviews fand nach langer Recherche- und Motivationsarbeit mit einer Seniorin im Januar 2004 statt, es bildet die Grundlage dieser Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsinteresse
- Methode
- Selbstkritik
- Einführende Bemerkungen
- Analyse
- Strukturelle Beschreibung
- Literaturnachweis
- Anhang: Transkription des Interviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Analphabetismus in Deutschland, insbesondere mit den Ursachen und Bewältigungsstrategien von Betroffenen. Die Arbeit basiert auf einem narrativen autobiographischen Interview, das mit einer Seniorin geführt wurde. Der Fokus liegt darauf, die Lebensgeschichte der Interviewten zu analysieren und so zu einem besseren Verständnis der Ursachen von Analphabetismus sowie der alltäglichen Handlungsstrategien und Bewältigungsmuster der Betroffenen zu gelangen.
- Ursachen von Analphabetismus
- Alltägliche Handlungsstrategien von Analphabeten
- Bewältigungsmuster von Analphabeten
- Der Einfluss sozialstruktureller Bedingungen auf Analphabetismus
- Die Rolle der Bildung im Leben von Analphabeten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einleitung und der Begründung des Forschungsinteresses. Es wird die Relevanz der Thematik Analphabetismus in der heutigen Gesellschaft aufgezeigt und die Methode des narrativen autobiographischen Interviews als geeignete Forschungsmethode vorgestellt. Im zweiten Kapitel werden einführende Bemerkungen zum Forschungsgegenstand Analphabetismus gegeben. Das dritte Kapitel befasst sich mit der strukturellen Beschreibung des erhobenen Datenmaterials. Die Analyse der einzelnen Sinneinheiten erfolgt dabei methodisch nach Froschauer und Südmersen. Es werden Hypothesen über die Funktionen der Äußerungen der Interviewten im Interview selbst aufgestellt und latente Momente aufgedeckt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Analphabetismus, narrative Interviews, qualitative Sozialforschung, Lebensgeschichte, Handlungsstrategien, Bewältigungsmuster, Sozialstruktur, Bildung. Die Arbeit bietet einen Einblick in die Lebenswelt von Analphabeten und analysiert die Ursachen und Folgen von Analphabetismus.
- Quote paper
- Dennis Hippler (Author), 2005, Analphabetismus. Ursachen, Bewältigungsstrategien und Fallstudie anhand eines narrativen autobiographischen Interviews, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/55167