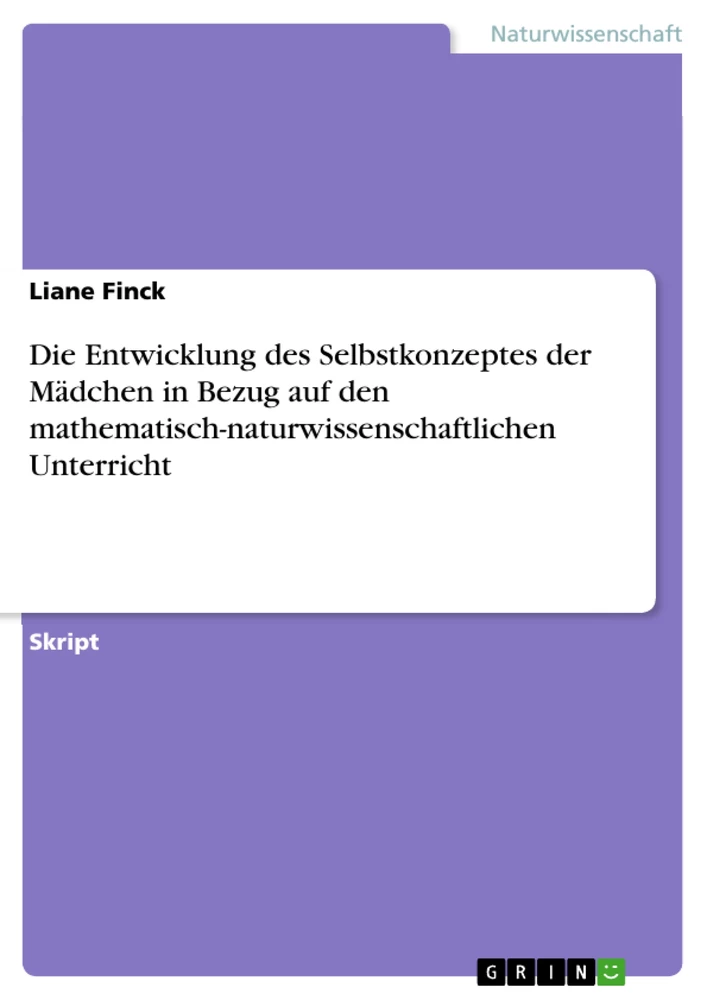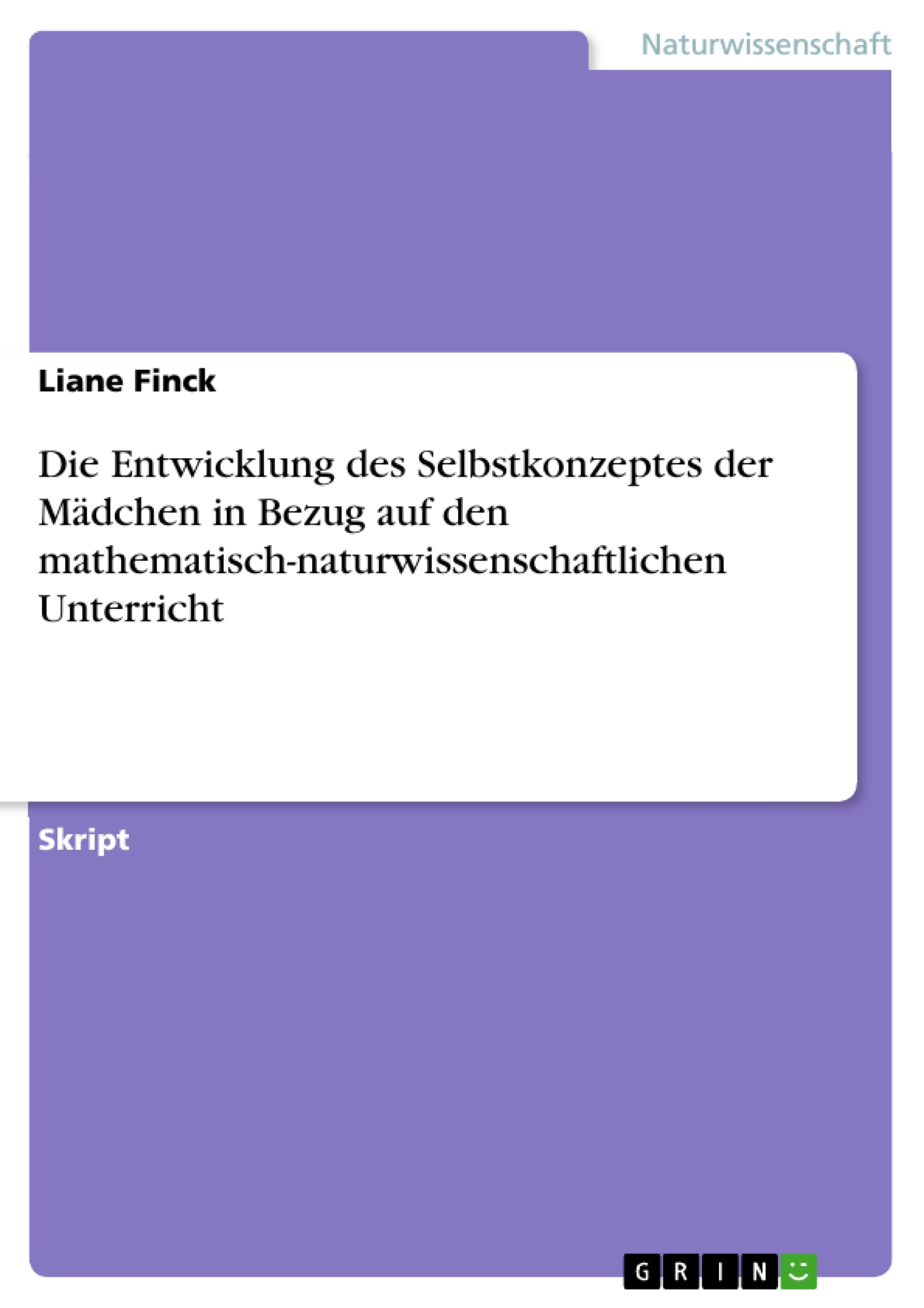Die Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft unterlagen in den letzten Jahrzehnten tief greifenden Veränderungen, nicht nur in gesellschaftlicher Hinsicht, sondern auch aus politischer und bildungspolitischer Sicht. So war z. B. das Recht auf Bildung jahrtausendelang nur Männern vorbehalten. Erst durch die Einführung der allgemeinen Schulpflicht um 1800 wurde Frauen zumindest das Recht auf „Grundbildung“ gewährt (vgl. Richter 1996). Allerdings konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht von gleichberechtigten Bildungschancen von Frauen und Männern gesprochen werden, denn die Bildung von Mädchen und Jungen wurde strikt nach Geschlechtern getrennt und die Lehrpläne unterschieden sich. So war es den Mädchen vorbehalten, beispielsweise am Hauswirtschaftsunterricht teilzunehmen, wohingegen die Jungen den Werkunterricht besuchten. Gründe dafür lagen zum Teil in der gesellschaftlichen Stellung der Frauen, deren Lebensbereiche hauptsächlich auf die Familie beschränkt waren. Diese Geschlechterrollentypisierung wurde in Deutschland erst in den sechziger Jahren mit der Einführung der Koedukation beseitigt und schlug sich zu Beginn der siebziger Jahre auch endgültig in den Lehrplänen nieder (vgl. Srocke, B. 1989; Richter, S. 1996). Mit der Einführung der Koedukation wurde also eine gewichtige Grundlage für die Chancengleichheit in der Bildungslaufbahn von Jungen und Mädchen geschaffen. Deshalb ist es umso verwunderlicher, dass es trotz dieser Chancengleichheit dennoch Geschlechterdifferenzen z. B. im mathematischen und naturwissen-schaftlichen Bereich gibt (vgl. Meuche 1997; Conrads 1992; Richter 1996). So werden in unserer Gesellschaft Naturwissenschaften und Technik nach wie vor als männliche Domänen angesehen. Zusätzlich sind Mädchen und Frauen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern in den Leistungskursen der Sekundarstufe II im Vergleich zu Männern unterrepräsentiert und legen sich auch bei der Studien- und Berufswahl eher auf „frauentypische“ Berufe fest, „die zum Teil erheblich schlechtere soziale Chancen bieten, als solche im naturwissenschaftlichtechnischen Bereich“ (Conrads, H. 1992, S. 9).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ergebnisse der PISA-Studie
- Die Entwicklung des Selbstkonzeptes
- Einflüsse durch die Eltern
- Schulische Einflüsse auf das Selbstkonzept
- Einflüsse der Lehrerinnen bezüglich des Mathematikunterrichts
- Einflüsse auf das Selbstkonzept durch Mathematikbücher
- Zusammenfassende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Ursachen für Geschlechterdifferenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich, insbesondere die Rolle des Selbstkonzepts von Mädchen. Sie analysiert, wie das Selbstkonzept von Mädchen im Laufe der Erziehung entwickelt wird und wie es sich auf die mathematisch-naturwissenschaftlichen Leistungen auswirken kann.
- Einflüsse der Eltern auf das Selbstkonzept von Mädchen
- Die Bedeutung des Lehrerverhaltens im Mathematikunterricht für das Selbstkonzept von Mädchen
- Der Einfluss von Mathematikbüchern auf das Selbstkonzept von Mädchen
- Der Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept von Mädchen und ihren Leistungen in Mathematik
- Mögliche Ansatzpunkte für eine gleichberechtigte Gestaltung der Lernbedingungen im Mathematikunterricht für Jungen und Mädchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Bildungschancen von Mädchen und Frauen und führt die Fragestellung der Arbeit ein: Warum engagieren sich Mädchen weniger für Mathematik und sind in der Mathematik und den Naturwissenschaften unterrepräsentiert? Die Ergebnisse der PISA-Studie werden vorgestellt, die Geschlechterunterschiede in den Basiskompetenzen aufzeigen, insbesondere im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich.
Das Kapitel über die Entwicklung des Selbstkonzeptes definiert den Begriff und stellt die verschiedenen Dimensionen des Selbstvertrauens vor. Die Auswirkungen eines niedrigen Selbstkonzepts auf die Leistungsergebnisse von Mädchen im mathematischen Bereich werden erläutert.
Im ersten Unterkapitel über die Einflüsse durch die Eltern wird die Rolle der Eltern im Sozialisationsprozess der Kinder und ihre bewusste oder unbewusste Einflussnahme auf das Selbstkonzept der Kinder beleuchtet.
Das zweite Unterkapitel fokussiert auf die schulischen Einflüsse auf das Selbstkonzept, wobei die Einflüsse der Lehrerinnen bezüglich des Mathematikunterrichts und die Auswirkungen von Mathematikbüchern auf das Selbstkonzept der Mädchen betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Selbstkonzept, Mädchen, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschlechterdifferenzen, PISA-Studie, Eltern, Lehrer, Schulbücher, Sozialisation, Leistung, Motivation, Angst, Gleichberechtigung, Lernbedingungen.
- Quote paper
- Liane Finck (Author), 2006, Die Entwicklung des Selbstkonzeptes der Mädchen in Bezug auf den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/54292