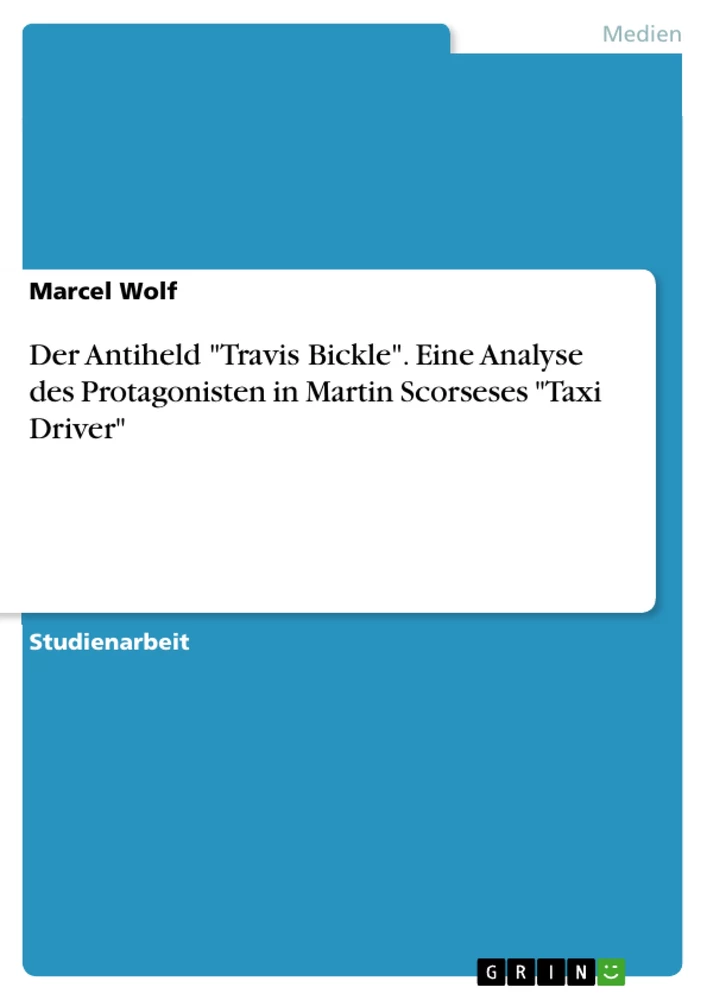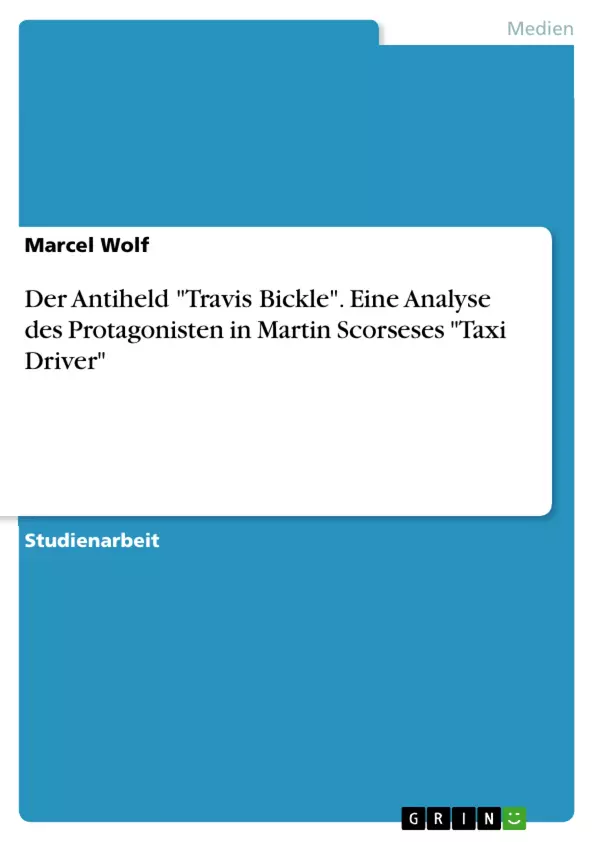Martin Scorseses Taxi Driver (1976) entstammt einer Zeit, in der sich Hollywood im Umbruch befindet. Kinofilme werden zu Autorenwerken, das glattgebügelte Kinoerlebnis der vorangegangenen Jahrzehnte weicht pessimistischeren Darstellungen. Hinzu kommt eine etwa durch den Vietnamkrieg angeheizte politische Stimmung in den USA. Deshalb ist Taxi Driver als zeitgenössische Kritik einerseits zu verstehen, andererseits stellt der Film auch heute noch ein in sich geschlossenes Kunst- und Meisterwerk dar.
Nicht zuletzt Robert De Niros ikonische Darstellung des geistig zermürbten Taxifahrers Travis Bickle bleibt in Erinnerung. Es sind Darstellungen wie diese, die Scorsese den Ruf eingebracht haben, eine Vorliebe für sog. Antihelden zu haben. In der Filmkritik zu The Wolf of Wallstreet unterstellt Spiegel Online dem Regisseur sogar, über „drei Stunden hinweg […] die Perversion der männlichen Antihelden“ (Kleingers 2014) zu zelebrieren. Über die Protagonisten in einem Scorsese-Film gibt es vieles zu sagen und Bertellini und Reich widmen sich in einem Aufsatz sogar ganz gezielt „Scorsese’s Male Antiheroes“ (vgl. Bertellini/Reich 2015: 38f.).
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Figur Travis Bickle in Taxi Driver näher zu beleuchten. Ihre Wahrnehmung und die sich aus ihr ergebenden Motivationen und Ziele des Charakters sollen herauszuarbeitet werden. Wie die Figur von Scorsese und dem Drehbuchautor Paul Schrader konzeptioniert ist, soll dabei auch aus dem soziohistorischen Kontext abgeleitet werden. In einem letzten Schritt soll schließlich geklärt werden, ob die Figur tatsächlich als Antiheld zu verstehen ist und welche Eigenschaften eine solche Charakterisierung zulassen. Denn wann wird ein Protagonist zu mehr als einem bloßen Protagonisten? Was macht ihn zu einem Helden, geschweige denn zu einem Antihelden? Letzterer bildet schließlich einen Widerspruch in sich, weshalb der Antiheld in seiner Grundkonzeption schwieriger greifbar ist als die klassische Heldenfigur. Die Frage erscheint auch insofern interessant, als dass Taxi Driver das Konzept in seinen letzten Minuten ad absurdum führt, indem gezeigt wird, dass Protagonist Travis von der Öffentlichkeit als Held gefeiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 New Hollywood
- 2.2 Der Protagonist von Martin Scorsese
- 2.3 Der Antiheld: Konzeption und Definition
- 3. Methodik
- 3.1 Figurenanalyse im Film
- 4. Taxi Driver: Eine Charakteranalyse
- 4.1 Travis Bickle, der Taxifahrer. Travis Bickle, der Soldat.
- 4.2 Travis Kommunikationsprobleme
- 4.3 Katalysator der Veränderung: Iris
- 4.4 Der Pfad Gottes? Travis' Feldzug gegen den Abschaum der Stadt
- 4.5 Heldentum und Erlösung?
- 5. Travis Bickle: Ein Antiheld?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Figur des Travis Bickle im Film Taxi Driver von Martin Scorsese. Sie analysiert die Figur aus psychologischer Perspektive und versucht, die Motivations- und Zielsetzung des Protagonisten im Kontext der New-Hollywood-Ära zu verstehen.
- Analyse der Figur des Travis Bickle im Kontext der New-Hollywood-Ära
- Bedeutung von "Antiheld" als Filmfigur
- Einfluss des soziohistorischen Kontextes auf die Charakterisierung
- Untersuchung der Kommunikationsprobleme des Protagonisten
- Analyse des Motivations- und Zielsetzungsverhaltens des Protagonisten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz von Taxi Driver im Kontext der New-Hollywood-Ära. Kapitel 2 bietet den theoretischen Hintergrund, indem die New-Hollywood-Bewegung, der typische Scorsese-Protagonist und das Konzept des Antihelden beleuchtet werden. Kapitel 3 erläutert kurz die Methodik der Figurenanalyse. Kapitel 4 widmet sich einer detaillierten Charakteranalyse von Travis Bickle, die seine Persönlichkeit, seine Kommunikationsprobleme und seine Motivationen beleuchtet. Das Kapitel behandelt auch die Rolle der Figur Iris und Travis' Feldzug gegen den Abschaum der Stadt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen New Hollywood, Antiheld, Figurenanalyse, Charakterisierung, Motivation, Kommunikation, Taxi Driver, Martin Scorsese, Travis Bickle.
- Arbeit zitieren
- Marcel Wolf (Autor:in), 2016, Der Antiheld "Travis Bickle". Eine Analyse des Protagonisten in Martin Scorseses "Taxi Driver", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/541430