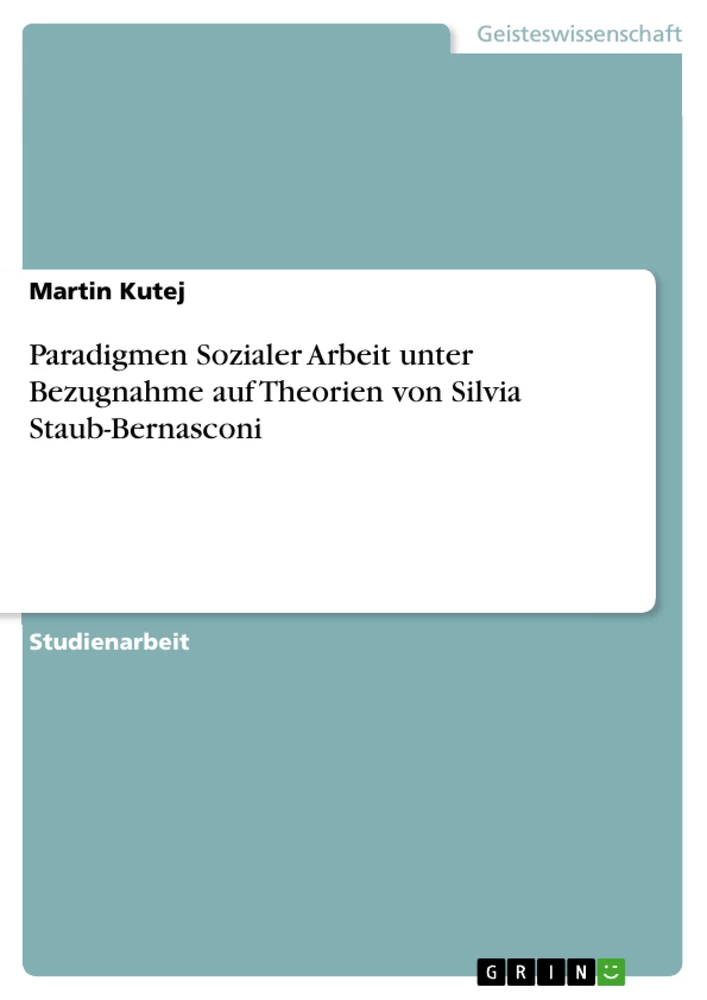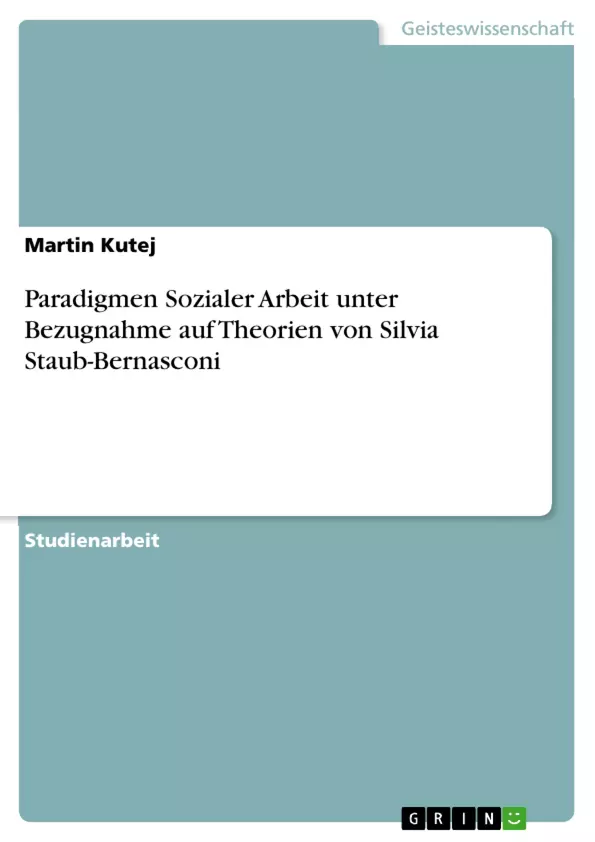Aufgrund meiner sozialarbeiterischen Grundausbildung an einer damaligen Akademie für Sozialarbeit kam ich vom Beginn an mit den Theorien von Silvia Staub-Bernasconi in Berührung.
Ihr Denken in Systemen hat mich (nicht nur damals) beeindruckt und beeinflusst.
Bei der Bekanntgabe der zu lesenden Literatur war ich daher froh, dass ein Artikel von ihr in die Leseliste aufgenommen wurde.
In diesem Essay widme ich mich einerseits jenen Texten, die zu Beginn des Semesters behandelt wurden, andererseits dem Text von Silvia Staub-Bernasconi.
Dies deshalb, weil bei den ersten Texten für mich besonders viel Unbekanntes zu erfahren war. Der Text von Staub-Bernasconi und die anschließende Diskussion haben darüber mich zum Nachdenken über die Grenzen, oder eben Nicht-Grenzen des Systemischen Ansatzes gebracht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Begriffsdefinition
- 3. Der Mensch als soziales Wesen / Helfen
- 4. Das Paradigma Systemischer Sozialen Arbeit
- 5 Fazit
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit dem Paradigma der Systemischen Sozialen Arbeit und analysiert dessen Bedeutung und Anwendung in der Praxis. Der Text beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Paradigma“ und untersucht dessen Relevanz für die soziale Arbeit.
- Begriffsdefinition des Paradigmas
- Der Mensch als soziales Wesen und die Rolle von Hilfe
- Der systemische Ansatz in der Sozialen Arbeit
- Grenzen und Möglichkeiten des Systemischen Ansatzes
- Die Bedeutung von Empathie und Altruismus
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Der Autor schildert seine eigene Auseinandersetzung mit den Theorien von Silvia Staub-Bernasconi und erläutert, wie diese sein Denken beeinflusst haben. Der Essay soll sowohl die zu Beginn des Semesters behandelten Texte als auch den Text von Staub-Bernasconi näher beleuchten.
2. Begriffsdefinition
Die Definition des Begriffs "Paradigma" steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Der Autor beleuchtet die unterschiedlichen Bedeutungen des Wortes, beginnend mit Platons Verständnis des Paradigmas als Modell oder Muster. Er analysiert die Entwicklung des Begriffs im Laufe der Zeit und betont die Relevanz des Paradigmas als dominierende wissenschaftliche Orientierung, wie sie von Rentsch (2007) beschrieben wird.
3. Der Mensch als soziales Wesen / Helfen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, warum Menschen einander helfen. Es wird die Darwinsche Evolutionslehre aufgegriffen, die in der gegenseitigen Hilfe einen Wettbewerbsvorteil für die Gruppe sieht. Der Autor untersucht die Rolle von Altruismus und Empathie und beleuchtet die Erkenntnisse von Batson (2015) über die Motivation zum Helfen. Tomasellos (2014) Forschungsergebnisse zur Entwicklung prosozialen Verhaltens bei Kindern werden analysiert und die Bedeutung von Kontrolle, Scham und moralischem Verhalten für das soziale Zusammenleben beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Essays sind: Paradigma, Systemische Soziale Arbeit, Altruismus, Empathie, prosoziales Verhalten, Kontrolle, Scham, Moral, Evolution, Wettbewerbsvorteil, Hilfe, Silvia Staub-Bernasconi, Rentsch (2007), Batson (2015), Tomasello (2014).
- Quote paper
- MA MSc MA Martin Kutej (Author), 2017, Paradigmen Sozialer Arbeit unter Bezugnahme auf Theorien von Silvia Staub-Bernasconi, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/541392