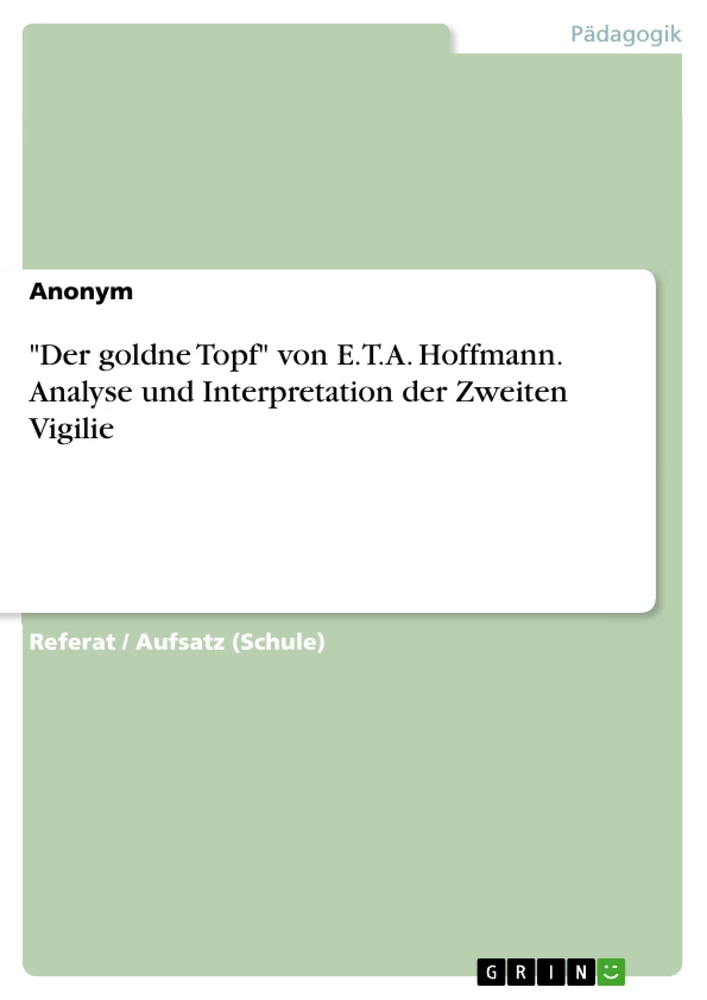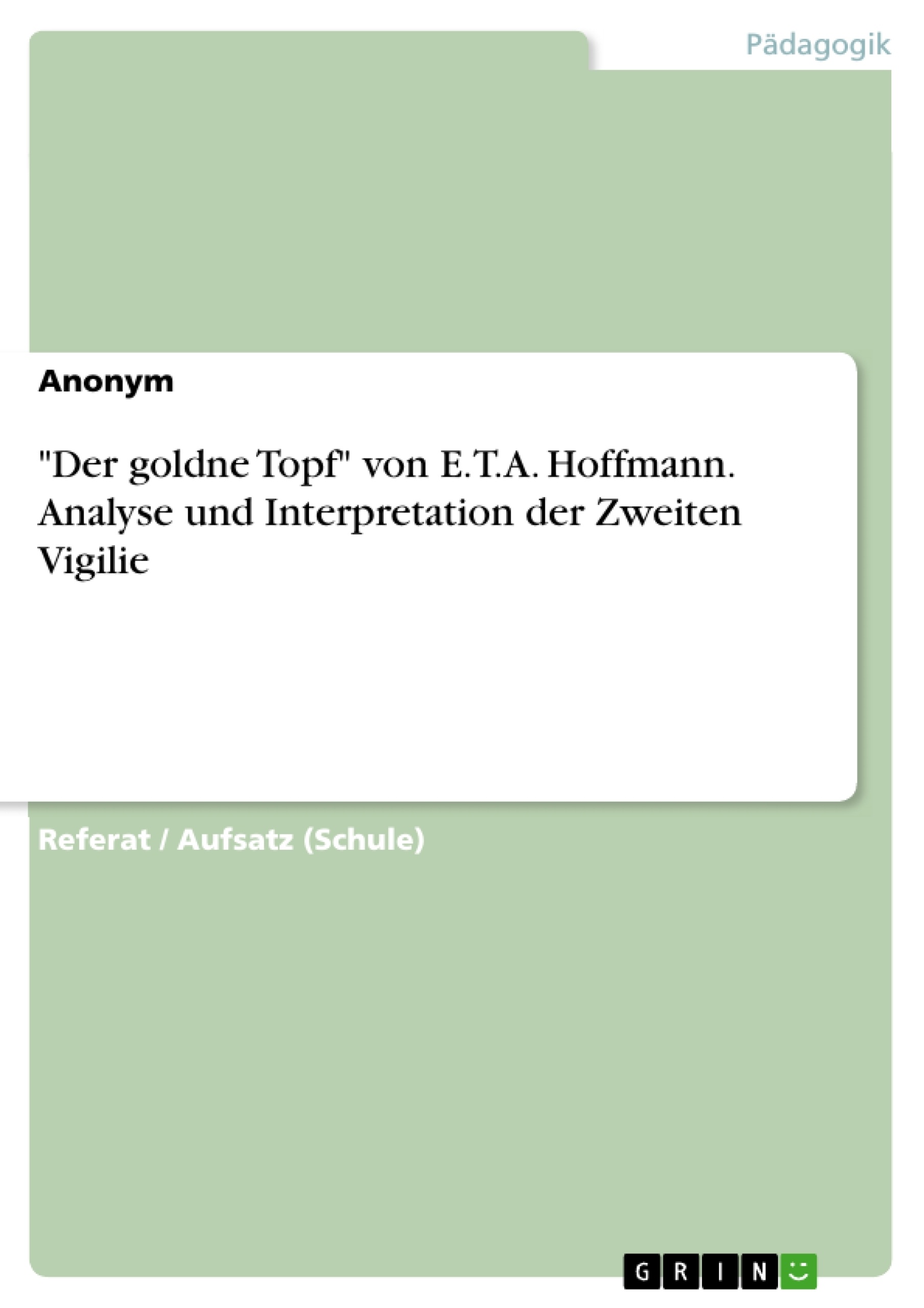Das Dokument umfasst eine detaillierte Analyse und Interpretation eines Ausschnitts aus der Zweiten Vigilie (S.12 Z.22 BIS S.15, Z.31) aus dem Werk "Der goldne Topf" von E.T.A. Hoffmann.
Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Aufsatz.
Bereits der erste Satz einer Bürgersfrau, die Anselmus beobachtet, spiegelt die Einstellung des bürgerlichen Umfelds gegenüber dem Studenten wider. Die Worte „Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste.“ (S.12, Z.22 f.) machen vernehmbar, dass das Verhalten von Anselmus von seiner Umwelt als unnormal und besorgniserregend wahrgenommen wird. Entscheidend hierbei ist, dass genau diese Worte Anselmus aus seinem sehnsüchtigen Zustand reißen. Die Beschreibung „Anselmus war es so, als würde er aus einem tiefen Traum gerüttelt oder gar mit eiskaltem Wasser begossen“ (Z.24 f.) macht deutlich, dass sich der junge Mann zuvor in einem Zustand befunden hat, den er sich selbst nicht richtig erklären kann. Anselmus versucht augenblicklich Erklärungen zu finden und schämt sich für sein Verhalten. Er scheint dabei selbst entsetzt darüber zu sein, „ganz allein für sich selbst in laute Worte“ (Z.28 f.) ausgebrochen zu sein. Auch die Tatsache, dass Anselmus „bestürzt“ (Z.29) die ihn beobachtende Bürgersfrau anblickt, ist ein Zeichen seines Unwohlseins. Darüber hinaus zeigt er die Tendenz aus unangenehmen Situationen zu flüchten, wie bereits bei dem Zusammenstoß mit dem Äpfelweib in der ersten Vigilie deutlich wird. Um schnellstmöglich aus der Situation zu entkommen, beeilt sich Anselmus von dem Holunderbaum „davonzueilen“ (Z.31).
Auch der Mann, der zur Familie der Bürgerfrau gehört, beobachtet Anselmus voller Verwunderung. In der Aussage des Mannes wird der Versuch der bürgerlichen Gesellschaft erkennbar, rationale Erklärungen für scheinbar unerklärliche Ereignisse zu finden. Der Bürger hält Anselmus für einen Student der Theologie, der „zu viel ins Gläschen geguckt“ hat (S.13, Z.6). Wesentlicher Charakterzug von Anselmus zu Beginn des Märchens ist seine Emotionalität und Sensibilität. Die Aussage des Bürgers kommentiert er „weinerlich“ mit der Interjektion „Ach!“ (Z.8), was seine Frustration und sein Selbstmitleid zum Ausdruck bringt. Auch mehrere Bürgermädchen, die das Schauspiel beobachtet haben, „kickern miteinander“ (Z.21) und machen sich damit über Anselmus lustig. An dieser Stelle wird erneut deutlich, dass die Situation für Anselmus unerträglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- DER GOLDNE TOPF – E.T.A. HOFFMANN
- ANALYSE UND INTERPRETATION DER ZWEITEN VIGILIE (S.12 Z.22 BIS S.15, Z.31)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse untersucht die zweite Vigilie von E.T.A. Hoffmanns „Der goldne Topf“ und beleuchtet die Entwicklung des Studenten Anselmus. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung des Spannungsverhältnisses zwischen der bürgerlichen Alltagswelt und der magisch-phantastischen Welt, in dem sich Anselmus zu Beginn seiner Transformation zum Dichter befindet.
- Die Reaktion des bürgerlichen Umfelds auf Anselmus' seltsames Verhalten
- Anselmus' innere Zerrissenheit zwischen rationaler Erklärung und magischer Erfahrung
- Die Bedeutung der Begegnung mit den Schlangen als Auslöser für Anselmus' Sehnsucht nach der magischen Welt
- Die Rolle von Anselmus' Freunden als Repräsentanten der bürgerlichen Welt
- Die zunehmende Entfremdung von Anselmus von der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die zweite Vigilie schildert Anselmus' zunehmende Verwirrung, nachdem er im Holunderbusch goldgrüne Schlangen gesehen hat. Seine Mitbürger halten ihn für verrückt und versuchen, sein Verhalten rational zu erklären. Anselmus selbst versucht, die Ereignisse als Halluzinationen abzutun, doch die Schlangen erscheinen ihm erneut, als er mit seinem Freund Konrektor Paulmann auf der Elbe gondelt. Die Szene endet mit Anselmus' innerer Zerrissenheit, während er versucht, die Ereignisse in der realen Welt zu verorten und gleichzeitig von der magischen Welt angezogen wird.
Schlüsselwörter
Die Analyse konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe der magischen und der realen Welt, die Entwicklung des Studenten Anselmus, die Darstellung seiner inneren Zerrissenheit, die Reaktion des bürgerlichen Umfelds und die Bedeutung der Begegnung mit den Schlangen für Anselmus' Transformation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, "Der goldne Topf" von E.T.A. Hoffmann. Analyse und Interpretation der Zweiten Vigilie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/539850