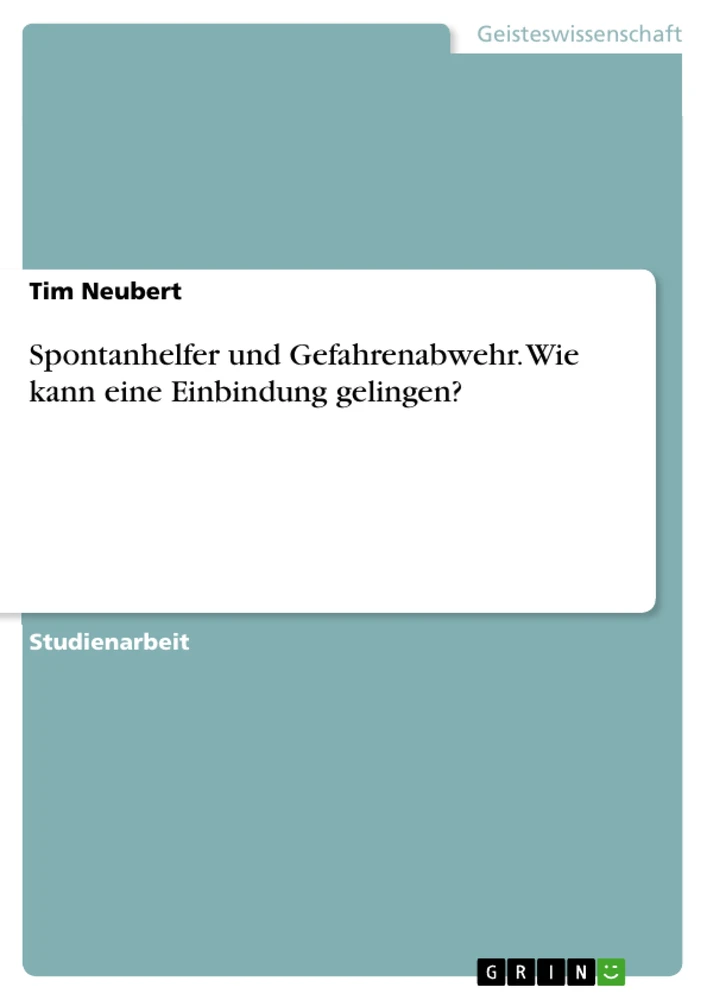Die vorliegende Hausarbeit betrachtet die Möglichkeiten der Einbindung ungebundener Spontanhelfer in die öffentliche Gefahrenabwehr.
Dazu beleuchtet sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Spontanhelfern und stellt im weiteren Verlauf verschiedene Tools und Möglichkeiten vor.
Zunächst wird dafür der Begriff des Spontanthelfers näher definiert und ausgeführt, insbesondere was unter einem sogenannten "ungebundenen Spontanhelfer" verstanden werden kann. Daran anschließend wird deren rechtliche Stellung und Ihre Interaktion untereinander analysiert, bevor genauer drauf eingegangen wird, wie eine Einbringung der Helfer zu Gefahrenabwehr ablaufen kann. Anschließend werden, vor einer zusammenfassenden Diskussion, nochmals die möglichen Motive von Spontanhelfern rekapituliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ungebundene Spontanhelfer
- Digital Volunteers
- Emergent Groups
- Projekt „KUBAS“
- Projekt „ENSURE“
- Rechtliche Stellung von Spontanhelfern
- Interaktion mit den Spontanhelfern
- Vernetzung von ungebundenen Spontanhelfern
- Miteinander reden
- Einbindung von Spontanhelfern in die Gefahrenabwehr
- Motive von Spontanhelfern
- Diskussion
- Fazit und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Einbindung von ungebundenen Spontanhelfern in die öffentliche Gefahrenabwehr. Sie untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Helfer und stellt verschiedene Tools und Möglichkeiten zur Koordination und Vernetzung vor.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von Spontanhelfern
- Möglichkeiten zur Koordination und Vernetzung von Spontanhelfern
- Motive und Handlungsweisen von Spontanhelfern
- Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Spontanhelfern
- Potenziale von Digital Volunteers in der Gefahrenabwehr
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der ungebundenen Spontanhelfer und deren Relevanz für die Gefahrenabwehr ein. Sie stellt die Bedeutung dieser Helfer im Kontext von Großschadenslagen heraus.
- Ungebundene Spontanhelfer: Dieses Kapitel definiert und beschreibt verschiedene Formen von Spontanhelfern, darunter "Digital Volunteers" und "Emergent Groups". Es beleuchtet die Organisation und Motivation dieser Helfer sowie ihre Rolle in Katastrophenhilfe-Situationen.
- Rechtliche Stellung von Spontanhelfern: Dieser Abschnitt untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Spontanhelfern in der Gefahrenabwehr. Er analysiert relevante Gesetze und Verordnungen.
- Interaktion mit den Spontanhelfern: Dieses Kapitel widmet sich der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Behörden und Spontanhelfern. Es betrachtet Herausforderungen und Chancen dieser Interaktion sowie wichtige Aspekte der Koordination.
- Vernetzung von ungebundenen Spontanhelfern: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Vernetzung von Spontanhelfern, unter anderem die Nutzung sozialer Medien und die Förderung von Kommunikationsplattformen.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Gefahrenabwehr, Spontanhelfern, Digital Volunteers, Rechtliche Rahmenbedingungen, Interaktion, Vernetzung, soziale Medien, Krisenkommunikation, Katastrophenhilfe, Großschadenslagen und Hilfsorganisationen.
- Arbeit zitieren
- Tim Neubert (Autor:in), 2019, Spontanhelfer und Gefahrenabwehr. Wie kann eine Einbindung gelingen?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/539777