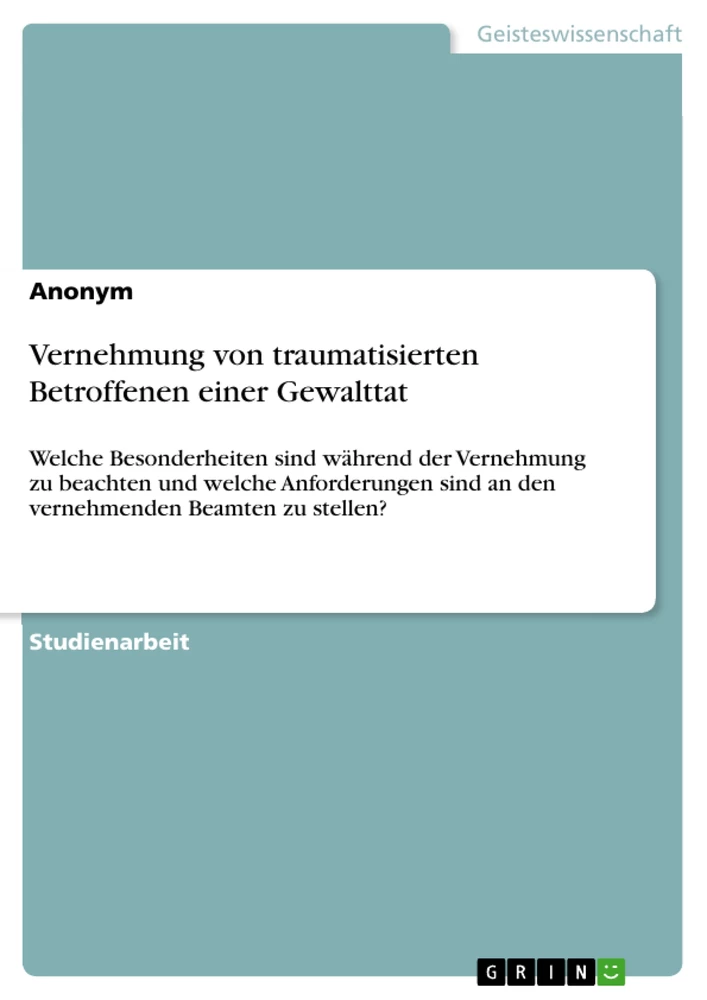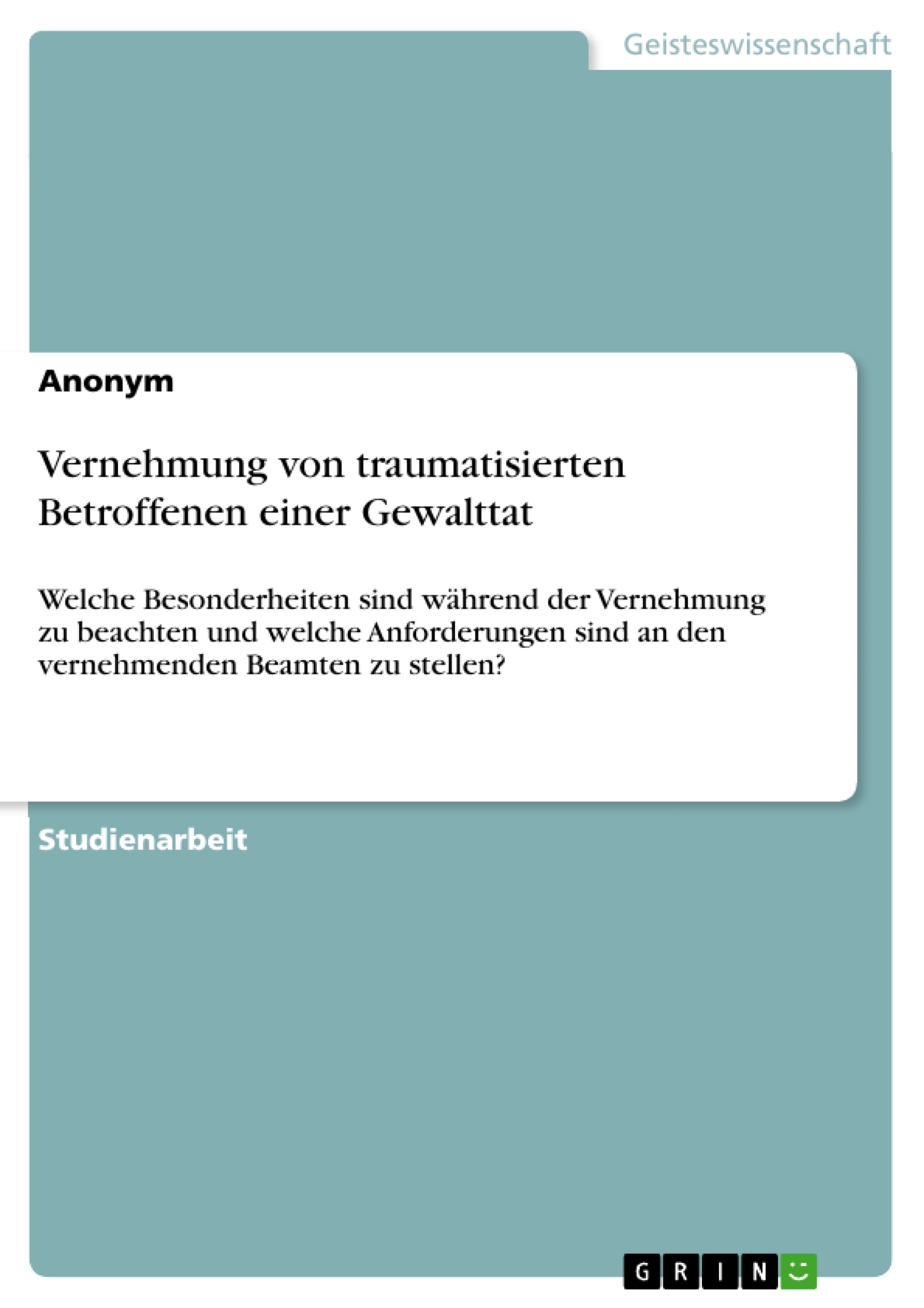Der heutige Rechtsstaat funktioniert gut. Er funktioniert deshalb so gut, weil es bestimmte Regeln gibt. Einige wichtige Regeln, die das Zusammenleben von Menschen erst möglich machen, werden in Gesetzen festgehalten. Diese Gesetze und Regeln machen es möglich, dass eine Person darauf vertrauen kann, Privatsphäre zu haben. Die Person kann ebenso darauf vertrauen, sich frei zu bewegen, ohne dabei eingeschränkt zu werden. Sie kann sich ungeachtet ihrer politischen Einstellung, ihrer Sexualität, ihrer Herkunft oder der Glaubensrichtung frei zu Themen äußern, demonstrieren und Sachverhalte anprangern, die gerade nicht so funktionieren, wie sie eigentlich vorgesehen waren. Die Person kann auch darauf vertrauen, dass der Rechtsstaat und seine Institutionen ihre körperliche und seelische Sicherheit gewährleisten, die durch äußere Umstände bedroht werden könnte, insbesondere durch andere Personen. Durch Personen, die den Kerngedanken des Rechtsstaates nicht verstanden haben, es nicht wollen, oder versuchen, dessen Funktionen, Regeln und Gesetze auszuhebeln. Freilich gelingt es dem Staat nicht immer, die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger zu gewährleisten. Es kommt zu Gewaltakten wie Körperverletzungen, sexuellen Übergriffen bis hin zum Totschlag oder gar Mord. Trotz der in der heutigen Zeit überall erhöhten Polizeipräsenz können solche Gewalttaten nicht verhindert werden und leider auch in Zukunft präsent sein.
Doch was geschieht mit den Menschen, die von solchen furchtbaren Gewaltausbrüchen Anderer betroffen sind? Wie haben sie das Erlebte durchgestanden und wie wirkt sich eine solche Tat auf deren Psyche aus? Wie kann die Person, die anderen Schaden zufügt, rechtsstaatlich zur Rechenschaft gezogen werden?
Eine vollständige und lückenlose Antwort auf die letzte Frage kann es nur geben, wenn die Personen, denen Leid zugefügt wurde, eine beweissichere Aussage in einer Vernehmung tätigen. Dass eine solche Vernehmung nicht wie andere behandelt wird und dass dabei Besonderheiten beachtet werden sollten, muss dem vernehmenden Beamten klar sein. Doch trotzdem ist nicht jeder Beamte automatisch dafür gerüstet.
In der folgenden Ausarbeitung möchte ich die Thematik der Vernehmung von Betroffenen einer Gewalttat näher beleuchten und dabei herausarbeiten, welche Besonderheiten bei der Vernehmung beachtet werden sollten und welche Anforderungen an den vernehmenden Beamten zu stellen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vernehmung
- Vernehmungsbegriff
- Vernehmungsarten
- Durchführung einer kriminalpolizeilichen Vernehmung
- Trauma
- Begriffsklärung
- Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Polizeiliche Vernehmung einer traumatisierten Person
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Vernehmung von Betroffenen einer Gewalttat. Ziel ist es, die Besonderheiten bei der Vernehmung traumatisierter Personen herauszuarbeiten und die Anforderungen an den vernehmenden Beamten zu beleuchten.
- Definition des Begriffs "Trauma" und Analyse der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
- Untersuchung der Besonderheiten bei der Vernehmung von traumatisierten Personen
- Analyse der Anforderungen an den vernehmenden Beamten
- Bewertung der Bedeutung der Vernehmung im Strafprozess
- Herausarbeitung der ethischen und rechtlichen Herausforderungen bei der Vernehmung von Traumatisierten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Vernehmung im Strafprozess dar und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Vernehmung traumatisierter Personen ergeben. Anschließend wird der Begriff der Vernehmung definiert und in die verschiedenen Vernehmungsarten unterteilt. Dabei werden die Unterschiede zwischen informatorischer Befragung und Vernehmung sowie die Rolle von Zeugen und Beschuldigten im Strafprozess herausgearbeitet.
Im Anschluss wird der Begriff des Traumas definiert und die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) näher beleuchtet. Es werden die verschiedenen Symptome und Auswirkungen der PTBS erläutert, um den spezifischen Umgang mit traumatisierten Personen im Vernehmungskontext zu verstehen.
In Kapitel 4 werden die Besonderheiten bei der Vernehmung traumatisierter Personen behandelt. Es werden die psychologischen und rechtlichen Aspekte berücksichtigt, die es bei der Befragung traumatisierter Personen zu beachten gilt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Vernehmung, Trauma, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Opfer, Zeuge, Beschuldigter, Kriminalistik, Strafprozessordnung, Beweisführung, Wahrheitsfindung, Rechtsschutz, Sicherheit, Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Vernehmung von traumatisierten Betroffenen einer Gewalttat, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/535730