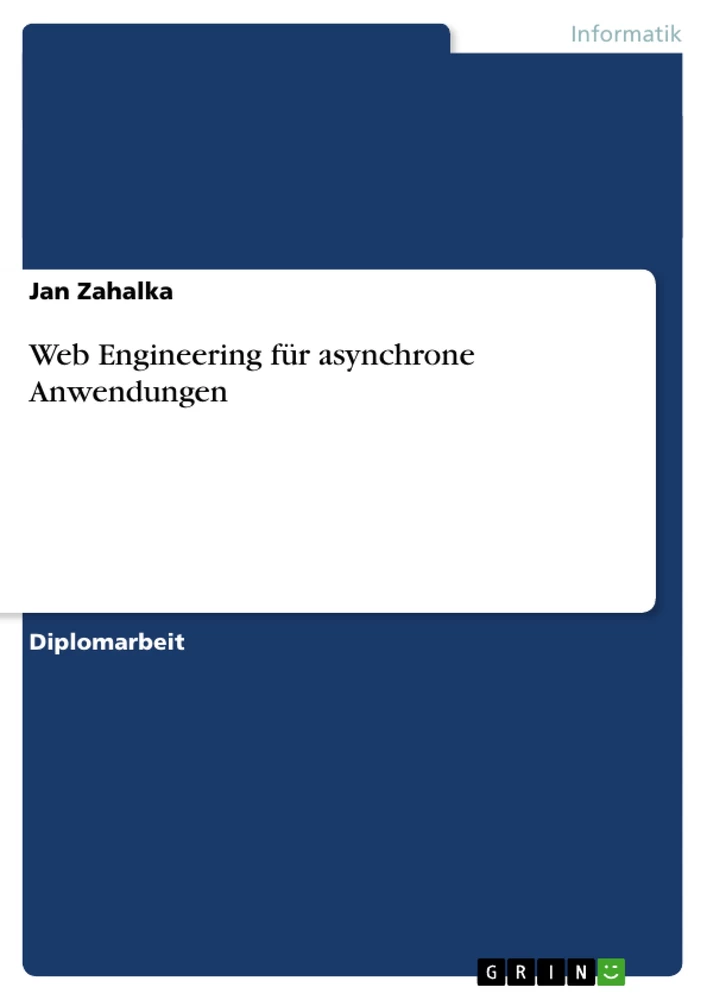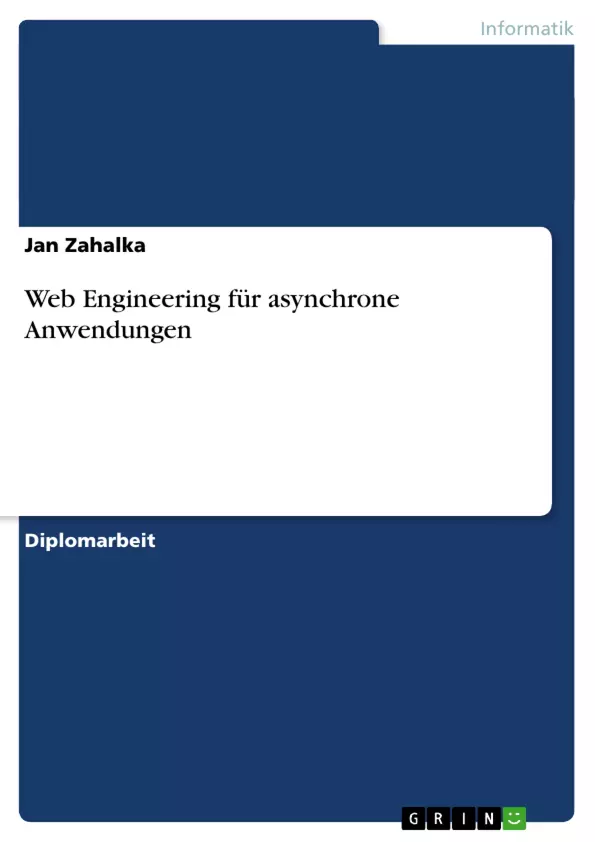Die vorliegende Arbeit beschreibt eine Evaluierung der besonderen Anforderungen, welche der Einsatz eines neuartigen Konzepts zur Realisierung asynchroner Kommunikation innerhalb von Webanwendungen an einen Web Engineering-Prozess stellt. Das World Wide Web, ursprünglich eine Ansammlung miteinander verlinkter Informationsseiten, vollzieht durch aktuelle Entwicklungen und Tendenzen eine grundlegende Veränderung des eigenen Charakters als passive Informationsquelle und Plattform für HTTP-basierte Applikationen. Dieses als Web 2.0 bezeichnete neue Verständnis desWebs deniert dieses als vollwertige Anwendungsplattform für hoch entwickelte Software und Dienste.
Im Sinne von Web 2.0 sind Webapplikationen interaktiv, auf den Endbenutzer zugeschnitten und "fühlen" sich wie Desktop-Anwendungen an. Einzelne Anwendungen sollen nicht für sich alleine stehen, sondern Daten über Web Services zur Verfügung stellen bzw. nutzen, um so neue, übergeordnete Dienste zu ermöglichen. Eine wichtige Säule in diesem Ansatz stellt der AJAX ("Asynchronous Javascript and XML")-Ansatz dar. Dieser ermöglicht eine asynchrone Kommunikation zwischen Browser und einem Server ohne explizite Auorderung durch den Benutzer, und bewirkt damit einen massiven Einschnitt in das Kommunikationsparadigma, auf welchem alle Web Engineering Ansätze aufbauen.
Innerhalb dieser Diplomarbeit sollen daher die Möglichkeiten, aber auch Grenzen der AJAX-Technologie sowie die Anwendbarkeit der Techniken und methodischen Schritte des Web Engineerings für diese neue Generation von Webanwendungen anhand einer Beispielanwendung und UWE als Vorgehensmodell ermittelt werden. Dafür wird ein Fallbeispiel-Projekt, eine Datenbankanwendung zur Suche, Verwaltung und Eintragung von IT-Firmen, dem UWE-Prozessmodell folgend modelliert und anschlieÿend ein Prototyp vorgestellt. Die Anwendbarkeit der UWEDiagrammtypen wird dabei in den Phasen Analyse, Navigations- und Präsentationsmodellierung untersucht und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Motivation
- Webanwendungen
- Definition und Klassifizierung
- Unterschiede zu Standard-Applikationen
- Request Cycle Prinzip
- Überblick über aktuelle Web-Technologien
- Asynchrone Webanwendungen
- Das Web 2.0
- Unterschiede zu herkömmlichen Webanwendungen
- Asynchrone Kommunikation im Web durch AJAX
- UML Web Engineering
- Allgemeines zu Web Engineering
- UWE
- Fallstudie: IT-Atlas
- Beschreibung
- Verteilter Aspekt
- Nicht-Funktionale Anforderungen
- Analyse
- Use Case Modell
- Content Modell
- Datenhaltung regionaler/zentraler Daten
- Modellierung und Einsatz asynchroner Kommunikation
- Entwurf
- Navigationsmodell
- Präsentationsmodell
- Modellierung des Verhaltens
- Entwurf des Web Service.
- Implementierung
- Einsatz der AJAX-Technologie
- Der Web Service
- Probleme/Hindernisse
- Test
- Testen asynchroner Anwendungen
- Testen der IT-Atlas Anwendung
- Testen des Web Service
- Der Prototyp
- Das Modul Suchen
- Das Modul Eintragen
- Das Modul Bearbeiten
- Der Web Service
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Evaluierung der besonderen Anforderungen, die sich durch den Einsatz von asynchroner Kommunikation in Webanwendungen an den Web Engineering-Prozess stellen.
- Der Wandel des World Wide Web zu einer Plattform für hochentwickelte Software und Dienste (Web 2.0)
- Die Bedeutung von AJAX als Technologie für asynchrone Kommunikation im Web
- Die Möglichkeiten und Grenzen von AJAX in Bezug auf Web Engineering Methoden
- Die Modellierbarkeit asynchroner Webanwendungen im Rahmen von UML-basierten Web Engineering Ansätzen (UWE)
- Die Anwendung des UWE-Prozessmodells auf eine Fallstudie, die IT-Atlas Datenbankanwendung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation für die Diplomarbeit erläutert und die Relevanz von Web Engineering und asynchroner Kommunikation im Web hervorhebt. Es werden die Entwicklungen im Webumfeld, insbesondere der Web 2.0-Ansatz, sowie die Herausforderungen, die sich aus der Seitenorientierung und dem synchronen Charakter der Kommunikation ergeben, dargestellt.
Im zweiten Kapitel werden Webanwendungen definiert und in verschiedenen Kategorien klassifiziert. Die Unterschiede zu Standard-Applikationen sowie das Request Cycle Prinzip werden erläutert.
Kapitel drei befasst sich mit asynchronen Webanwendungen und stellt den Web 2.0-Ansatz sowie dessen Unterschiede zu herkömmlichen Webanwendungen heraus. Die Funktionsweise und Bedeutung von AJAX als Schlüsseltechnologie für asynchrone Kommunikation im Web werden vorgestellt.
In Kapitel vier werden UML-basierte Web Engineering Ansätze, insbesondere UWE, behandelt. Es werden die allgemeinen Prinzipien des Web Engineerings sowie die spezifischen Eigenschaften von UWE, wie die Erweiterung der UML und die separate Modellierung von Content, Navigation und Präsentation, erklärt.
Kapitel fünf stellt die Fallstudie IT-Atlas vor, eine Datenbankanwendung zur Suche, Verwaltung und Eintragung von IT-Firmen. Die Beschreibung der Anwendung, der verteilte Aspekt sowie die nicht-funktionalen Anforderungen werden detailliert behandelt.
Die Kapitel sechs bis acht befassen sich mit der Analyse, dem Entwurf und der Implementierung der IT-Atlas Anwendung im Rahmen des UWE-Prozessmodells. Es werden Use Cases, Content Model, Datenhaltung, Navigationsmodell, Präsentationsmodell und die Modellierung des Verhaltens detailliert beschrieben.
Kapitel neun behandelt die Testphase der IT-Atlas Anwendung und stellt die besonderen Herausforderungen beim Testen asynchroner Anwendungen heraus.
Kapitel zehn präsentiert den Prototyp der IT-Atlas Anwendung, der die einzelnen Module, wie Suchen, Eintragen und Bearbeiten, sowie den Web Service beinhaltet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Themenkomplex Web Engineering, insbesondere der Modellierung und Entwicklung asynchroner Webanwendungen im Web 2.0-Umfeld. Die Schlüsselbegriffe sind: Web Engineering, UWE, AJAX, asynchrone Kommunikation, Web 2.0, Web Services, IT-Atlas, Modellierung, Fallstudie.
- Quote paper
- Jan Zahalka (Author), 2006, Web Engineering für asynchrone Anwendungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52453