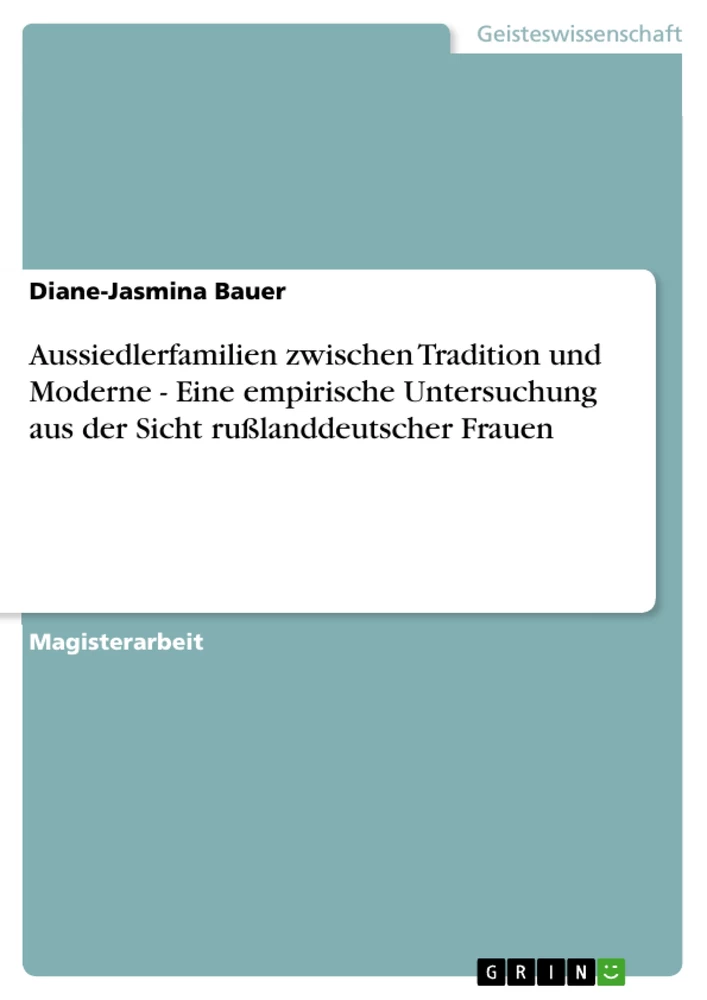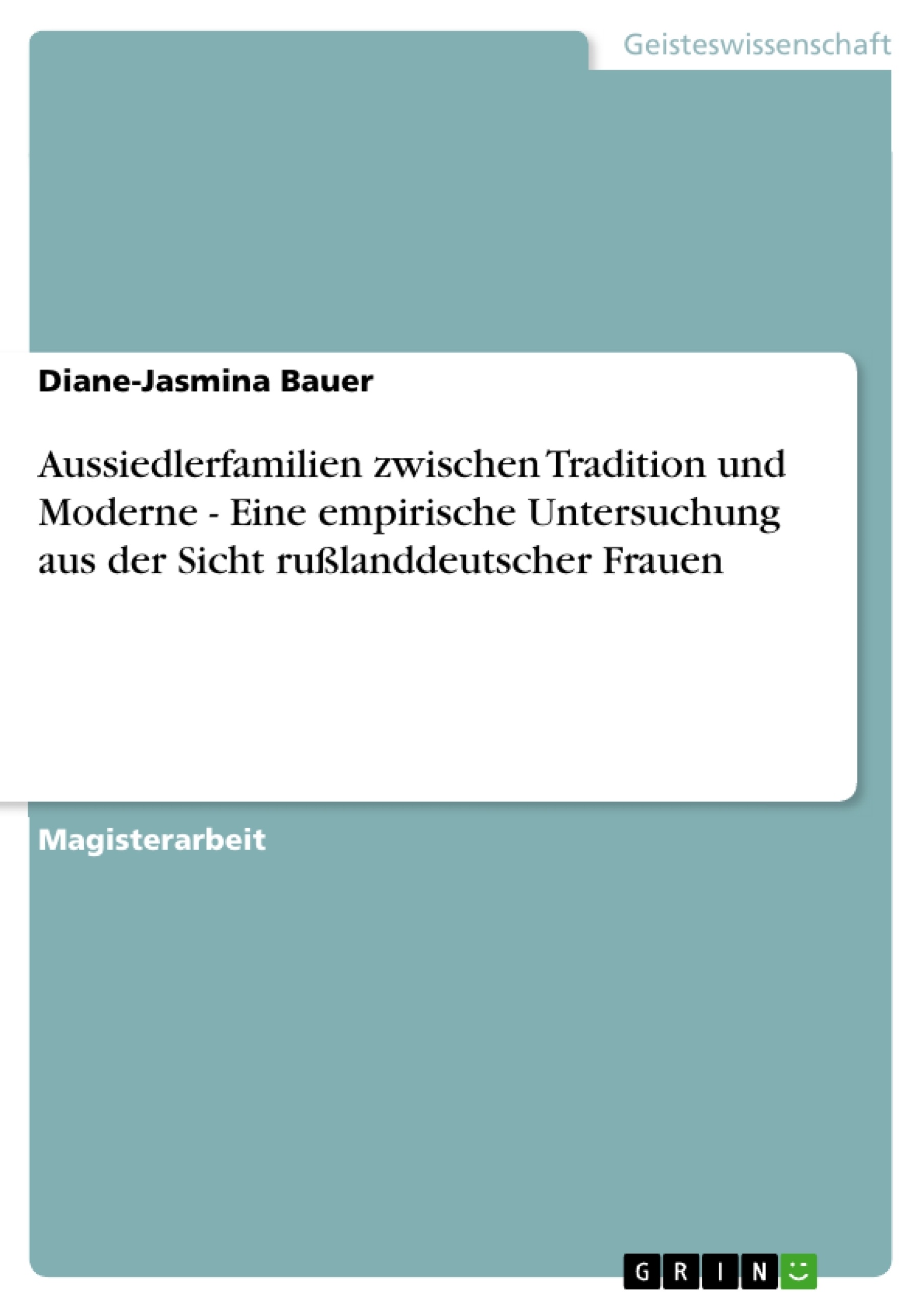Die Bundesrepublik Deutschland hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu einem der wichtigsten Einwanderungsländer in Europa entwickelt. Nachdem Deutsche massenweise über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte hinweg, ihrem Heimatland den Rücken kehrten, um in anderen Ländern und Kontinenten ihr Glück zu suchen, ist Deutschland inzwischen selbst im Zuge der Wohlstandsexplosion zu einem begehrten Ziel für verschiedenste Gruppen von Zuwanderern geworden (Bade 1983; 1992; Bade/Oltmer 1999). Die Entwicklung unseres Landes von einer monoethnischen zu einer multiethnischen Gesellschaft ist somit ein reales Charakteristikum der Moderne.
Migration als eine globale Tatsache, wird jedoch überwiegend problematisiert, ohne die damit verbundenen Chancen und Potentiale zur Kenntnis zu nehmen. Die historische Erfahrung hat gelehrt, daß Zuwanderung nicht nur mit sozialen und kulturellen Problemstellungen und Herausforderungen korreliert, sondern „vielfach ein Fundament wirtschaftlicher Dynamik und kultureller Vitalität war“ (Kulturpolitische Gesellschaft, 1). Im Kontext des kulturellen Pluralismus zeugen die Zuwanderer vielfach von ihrer interkulturellen und kosmopolitischen Kompetenz, ihrer Arbeitsmotivation und Aufstiegsorientiertheit.
Die explizite Botschaft dieser Magisterarbeit ist somit im Zuge der Moderne, verstärkt zur Kommunikation und Verständigung zwischen Menschen anzuregen, die einen unterschiedlichen soziokulturellen Hintergrund haben; hinsichtlich des multiethnischen Segmentes gilt es Bedingungen zu schaffen, die helfen, „Brücken zur Integration in die „Mehrheitsgesellschaft“ (Kulturpolitische Gesellschaft, 1) zu bauen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort:
- Einleitung...
- 1. Historiographie.
- 1.1. Die Kolonisierung durch die Zaren..
- 1.2. Der erste Weltkrieg (1914 - 1918).
- 1.3. Die Oktoberrevolution.
- 1.4. Der zweite Weltkrieg (1939 - 1945)
- 1.5. Das Ende der UDSSR.
- 1.6. Der Beginn der Aussiedler-Migration in die Bundesrepublik
- 2. Moderne Gesellschaft und Modernisierung..
- 2.1. Modernisierungstheoretische Definitionen.
- 2.2. Ein Rückblick in die Geschichte der Modernisierungstheorie.
- 2.3. Reformierte modernisierungstheoretische Konzeptionen
- 2.4. Modernisierung in Westdeutschland...
- 3. Familiensoziologische theoretische Konzeptionen.
- 3.1. Der Familiendiskurs und die These über die Krise der Familie.
- 3.1.1. Thomas Meyer: Familialer Wandel im Spiegel der Demographie..
- 3.1.2. Hartmann Tyrell: Die Deinstitutionalisierungsformel.
- 3.1.3. Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim (1990): Die Individualisierungsthese.
- 3.1.4. Rosemarie Nave-Herz: Zerfall oder strukturelle Verfestigung der Familie?
- 3.1.5. Beurteilung der wissenschaftlich theoretischen Konzeptionen...
- 3.2. Der Wandel der Geschlechterrollen..
- 4. Empirische Untersuchung..
- 4.1. Forschungsthemen, Hypothese:.
- 4.2. Methodik..
- 4.2.1. Qualitative Sozialforschung „theoretisch-methodische Aspekte“
- 4.2.2. Das qualitative Interview als Methode der Datenerhebung.
- 4.2.3. Das problemzentrierte Interview..
- 4.2.4. Die Gruppendiskussion....
- 4.2.5. Die Erstellung des Kurzfragebogens/Interviewleitfadens.
- 4.2.6. Die Durchführung der Interviews.
- 4.2.6.1. Anmerkungen......
- 4.2.6.2. Verlauf der Interviews.
- 4.3. Auswertung....
- 4.3.1. Transkription.....
- 4.3.2. Sozialprofil der Probandinnen.
- 4.3.3. Zur Auswertung Qualitativer Interviews
- 4.3.4. Die qualitative Inhaltsanalyse.
- 4.3.5. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.
- 4.4. Analyse und Interpretation..
- 4.4.1. Relevanz und Zentriertheit der rußlanddeutschen Familie
- 4.4.1.1. Die Ursprünge des rußlanddeutschen Familienverständnisses
- 4.4.1.2. Das kollektivistisch ausgerichtete Familienkonzept.
- 4.4.1.3. Die ruẞlanddeutsche Familie in der Situation der Einwanderung.
- 4.4.1.4. Die geographische Nähe ihrer Mitglieder.
- 4.4.1.5. Die ruẞlanddeutsche Familie und ihre Wertstellung.
- 4.4.2. Das Eheverständnis innerhalb der ruẞlanddeutschen Ethnie
- 4.4.2.1. Die Bedeutung der Kinder .
- 4.4.2.2. Scheidung – eine legitime Form der Konfliktlösung?
- 4.4.3. Neue Formen der Privatheit - eine Alternative zur Ehe?.
- 4.4.3.1. Nichteheliche Lebensgemeinschaft..
- 4.4.3.2. Single-Dasein.....
- 4.4.3.3. Alleinerziehend...
- 4.4.3.4. Kinderlosigkeit/Kinderlose Ehen….
- 4.4.4. Erziehung und Sozialisation in der rußlanddeutschen Familie
- 4.4.5. Die Rolle der rußlanddeutschen Frau..
- 4.4.5.1. Ihre berufliche Orientierung
- 4.4.5.2. Mutterschaftsvorstellungen....
- 4.4.6. Die Arbeitsteilung in der rußlanddeutschen Familie..
- 4.4.7. Die Wertvorstellungen innerhalb der rußlanddeutschen Familie.
- 4.4.8. Die Bedeutung der Religion für die rußlanddeutsche Familie.
- 5. Resümee
- 5.1. Die Bedeutung der rußlanddeutschen Familie im Migrationsprozeß.
- 5.2. Die ruẞlanddeutsche Familie und die Pluralität der Privatheit
- 5.4. Der Binnenraum der rußlanddeutschen Familie
- 5.4.1. Der Grad ihrer Zentriertheit
- 5.4.2. Erziehung und Sozialisation
- 5.4.3. Der Rollenwandel der rußlanddeutschen Frau.
- 5.4.4. Die Arbeitsteilung in der rußlanddeutschen Familie..
- 5.4.5. Hypothesenprüfung..
- 5.4.6. Schlußwort:.
- Das Familienbild und die Familienstrukturen russlanddeutscher Frauen.
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration in die deutsche Gesellschaft.
- Der Einfluss der Modernisierung auf die Familienstrukturen und Wertevorstellungen.
- Der Wandel der Geschlechterrollen und die Rolle der Frau in der Familie.
- Die Bedeutung der Religion und Kultur im Kontext des Familienlebens.
- Vorwort: Die Einleitung stellt die Thematik der Aussiedlermigration in den Kontext der modernen, multiethnischen Gesellschaft in Deutschland. Es wird auf die Herausforderungen und Chancen der Integration von Migranten in die „Mehrheitsgesellschaft“ eingegangen und die besondere Situation russlanddeutscher Aussiedler beleuchtet.
- Kapitel 1: Historiographie: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der russlanddeutschen Gemeinschaft, von der Kolonisierung durch die Zaren bis zum Ende der UDSSR und dem Beginn der Aussiedlermigration.
- Kapitel 2: Moderne Gesellschaft und Modernisierung: Dieses Kapitel behandelt die Modernisierungstheorie und ihre Bedeutung für die Analyse des sozialen Wandels. Es beleuchtet die Herausforderungen der Modernisierung in Westdeutschland und ihre Auswirkungen auf die Familienstrukturen.
- Kapitel 3: Familiensoziologische theoretische Konzeptionen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen theoretischen Konzeptionen zur Familiensoziologie, die die Entwicklung und den Wandel des Familiendiskurses beleuchten. Es werden verschiedene Ansätze zur Analyse des Familienwandels im Spiegel der Demographie und der Individualisierungsthese vorgestellt.
- Kapitel 4: Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die auf qualitativen Interviews mit russlanddeutschen Frauen basiert. Es wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als Methode zur Auswertung der Interviewdaten vorgestellt. Die Analyse konzentriert sich auf die Relevanz und Zentriertheit der Familie, das Eheverständnis, die Erziehung und Sozialisation in der Familie, die Rolle der Frau und die Arbeitsteilung in der Familie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit den Lebenserfahrungen von russlanddeutschen Frauen im Kontext ihrer Migration in die Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich im Rahmen der Integration in die deutsche Gesellschaft für diese Gruppe ergeben. Der Fokus liegt auf der Rolle der Familie und der Bedeutung des traditionellen Familienverständnisses im Vergleich zu modernen Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Aussiedler, Russlanddeutsche, Familie, Tradition, Moderne, Migration, Integration, Modernisierung, Familiensoziologie, Geschlechterrollen, Integration, Wertvorstellungen, Religion, Kultur.
- Quote paper
- Diane-Jasmina Bauer (Author), 2006, Aussiedlerfamilien zwischen Tradition und Moderne - Eine empirische Untersuchung aus der Sicht rußlanddeutscher Frauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/52390