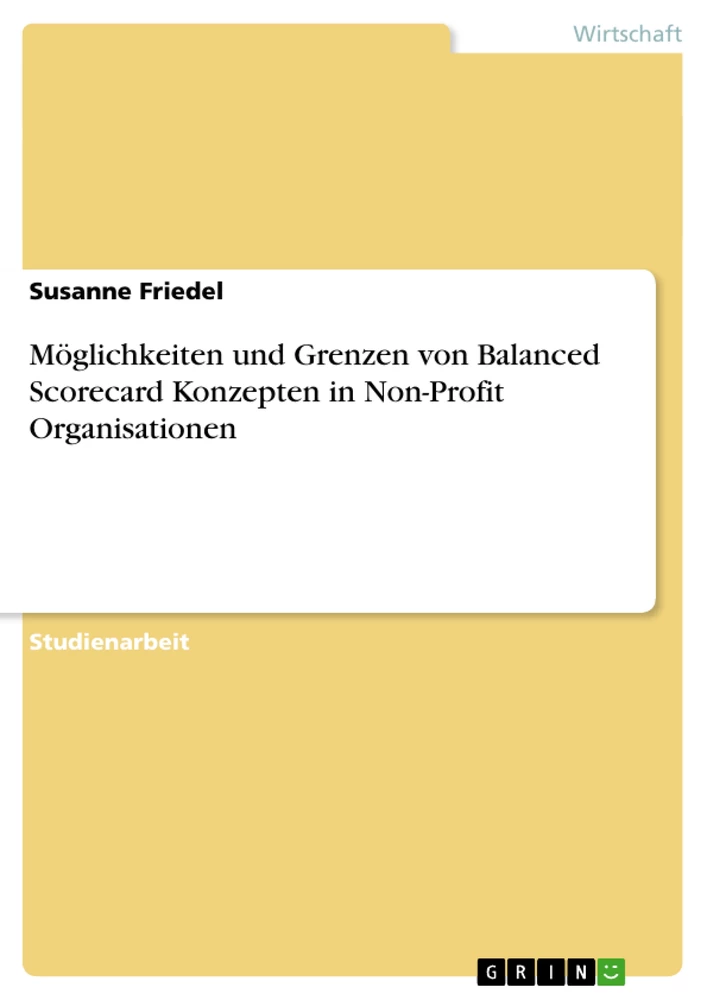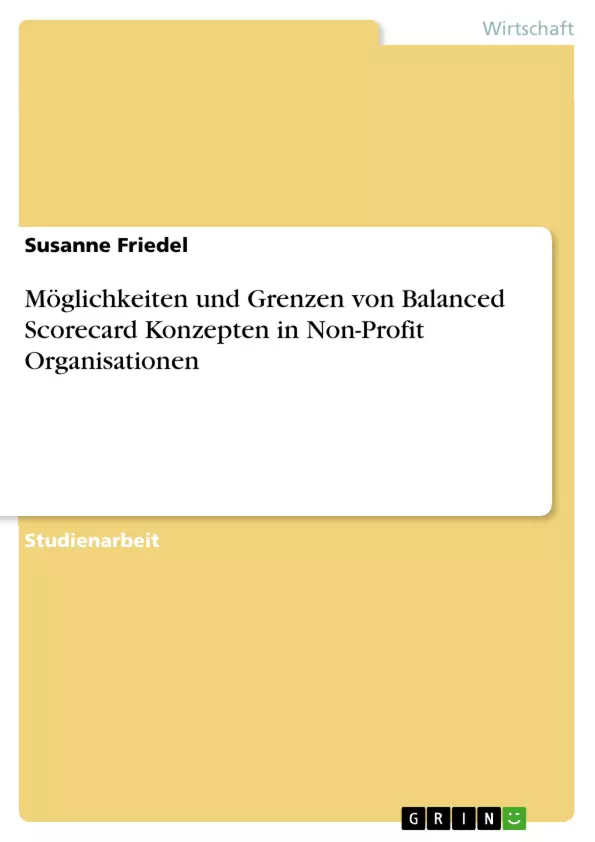Non-Profit Organisationen bewegen sich heutzutage in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld. Dieses ist keinesfalls frei von Konkurrenz, sondern die "Konkurrenzbeziehungen sind oft viel subtiler und für das Management schwieriger erkennbar als in Unternehmen". Auch wird der Erfolgsdruck auf diese Organisationen in Zukunft steigen. Dies macht eine zunehmend betriebswirtschaftliche Betrachtung der Prozesse in Non-Profit Organisationen unabdingbar und führt zu einem erhöhten Bedarf entsprechender Steuerungskonzepte, wie sie in erwerbswirtschaftlichen Unternehmen schon seit langem existieren.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich - ausgehend von den spezifischen Charakteristika von Non-Profit Organisationen - mit den Möglichkeiten der Anwendung der Balanced Scorecard im Non-Profit Bereich, versucht Vorschläge einer Modifikation des Konzeptes aufzuzeigen sowie Grenzen der Anwendbarkeit darzustellen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Non-Profit Organisationen (NPO)
- Begriffsklärung Non-Profit Organisation
- Zielsetzung von Non-Profit Organisationen
- Unterscheidungsmerkmale Profit- / Non-Profit Organisationen
- Anforderungen an das Controlling in Non-Profit Organisationen
- Die Balanced Scorecard (BSC)
- Zur Entstehung des Konzeptes
- Die Perspektiven der Balanced Scorecard
- Die Finanzperspektive
- Die Kunden- und Marktperspektive
- Die Interne Prozessperspektive
- Die Lern- und Entwicklungsperspektive
- Ursache- und Wirkungsbeziehungen
- Anwendungsmöglichkeiten der Balanced Scorecard in Non-Profit Organisationen
- Zur Eignung der Balanced Scorecard als Instrument des Performance Measurement in NPOS
- Die Modifikation der Perspektiven der BSC
- Die Finanzperspektive
- Die Kunden- und Marktperspektive
- Die Interne Prozessperspektive
- Die Lern- und Entwicklungsperspektive
- Erweiterung um die Mitarbeiter-Perspektive
- Grenzen der Anwendbarkeit der BSC im Non-Profit Bereich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von Balanced Scorecard Konzepten in Non-Profit Organisationen. Sie analysiert die spezifischen Charakteristika von NPOs und untersucht, inwiefern die BSC als Instrument des Performance Measurement geeignet ist. Dabei werden Modifikationen des Konzeptes vorgeschlagen und die Grenzen der Anwendbarkeit im Non-Profit Bereich dargestellt.
- Charakteristika und Besonderheiten von Non-Profit Organisationen
- Eignung und Modifikation der Balanced Scorecard für Non-Profit Organisationen
- Grenzen der Anwendbarkeit der BSC im Non-Profit Bereich
- Anwendungsmöglichkeiten und Herausforderungen des Performance Measurement in NPOs
- Entwicklung eines angepassten Steuerungskonzeptes für Non-Profit Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext und die Problematik von Non-Profit Organisationen in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld dar. Sie führt den erhöhten Bedarf an Steuerungskonzepten in NPOs aus und erläutert die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit.
- Non-Profit Organisationen (NPO): Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Begriffsklärung von Non-Profit Organisationen, ihrer Zielsetzung und den Unterschieden zu Profit-Organisationen. Außerdem werden die spezifischen Anforderungen an das Controlling in Non-Profit Organisationen erläutert.
- Die Balanced Scorecard (BSC): Dieses Kapitel präsentiert die Entstehung und die verschiedenen Perspektiven der Balanced Scorecard (BSC). Es werden die einzelnen Perspektiven (Finanzperspektive, Kunden- und Marktperspektive, Interne Prozessperspektive, Lern- und Entwicklungsperspektive) erläutert und die Ursache-Wirkungsbeziehungen innerhalb des Konzeptes dargestellt.
- Anwendungsmöglichkeiten der Balanced Scorecard in Non-Profit Organisationen: Dieses Kapitel untersucht die Eignung der BSC als Instrument des Performance Measurement in NPOs. Es analysiert die Modifikation der BSC-Perspektiven für den Non-Profit Bereich und präsentiert eine Erweiterung um die Mitarbeiter-Perspektive. Des Weiteren werden die Grenzen der Anwendbarkeit der BSC im Non-Profit Bereich dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselwörter Balanced Scorecard, Non-Profit Organisation, Performance Measurement, Steuerungskonzept, Modifikation, Grenzen der Anwendbarkeit, Mitarbeiter-Perspektive und Non-Profit-Controlling.
- Arbeit zitieren
- Susanne Friedel (Autor:in), 2002, Möglichkeiten und Grenzen von Balanced Scorecard Konzepten in Non-Profit Organisationen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/5194