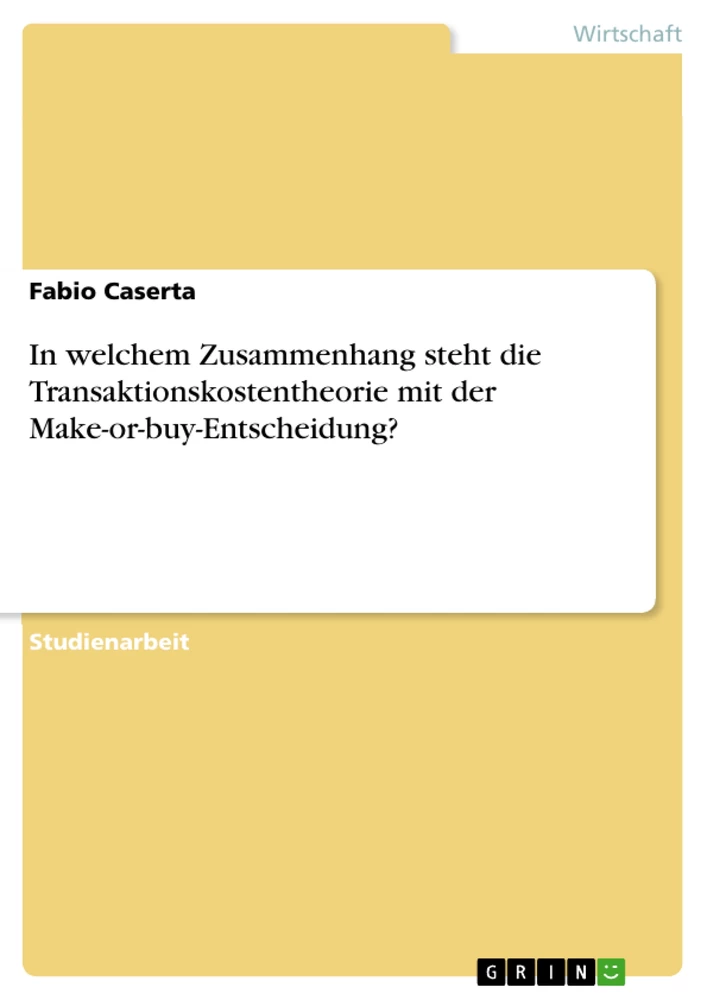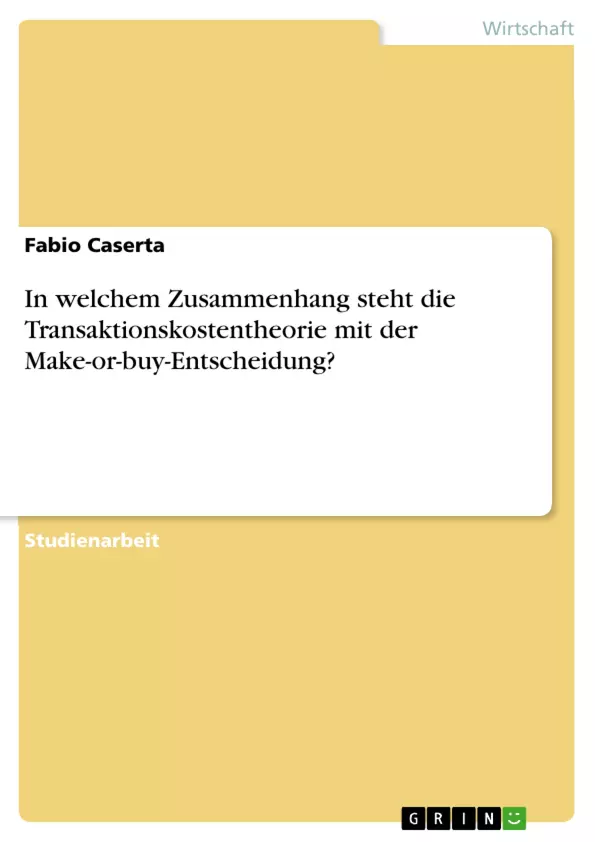In welchem Zusammenhang steht die Transaktionskostentheorie mit der Make-or-buy-Entscheidung? Die Daseinsform von Märkten ist angesichts der vorherrschenden Arbeitsteilung unverzichtbar. Der Mensch ging bereits vor langer Zeit von der Subsistenzwirtschaft, auch Bedarfswirtschaft genannt, zur Marktwirtschaft über. In der Bedarfswirtschaft erwirtschaftet und produziert jedes Individuum die Güter nach Bedarf und vor allem nach eigenem notwendigem Verbrauch. In der Marktwirtschaft hingegen produziert jedes Individuum ein spezifisches Gut oder mehrere Güter und davon produziert es mehr als für den Eigennutzen benötigt wird. Durch die Konzentration auf die Produktion nur eines Gutes oder einer bestimmten Güterreihe werden Spezialisierungen in einzelnen Bereichen geschaffen. Diese Spezialisierungen und der daraus schließende Handel haben zur Folge, dass jeder Marktteilnehmer mehr Güter zur Verfügung hat als in der Subsistenzwirtschaft. Schließlich steigt somit der Wohlstand.
Vertreter der Neoklassik wie Adam Smith gingen davon aus, dass die Benutzung der Handelsmärkte kostenlos sei. Die Transaktionskostentheorie von Ronald Coase besagt Gegenteiliges. Durch die Arbeitsteilung werden Institutionen ebenfalls der Möglichkeit bedient, gesamte Produktionsketten oder Dienstleistungsservices an Dritte zu übergeben. Die Entscheidung, ob ein Unternehmen bestimmte Aufgabenbereiche und dessen Leistungsbringung von anderen Unternehmen kauft, wird Make-or-buy genannt. Das Ziel einer Make-or-buy-Entscheidung ist Kostensenkung. Diese Kostensenkung kann sich bei der Buy-Entscheidung durch nicht vorhandene Kapazitäten für beispielsweise die Produktion eines Gutes kennzeichnen. Die Kosten können aber auch durch Nichtwissen aufkommen und für eine Institution, die sich das Wissen neu aneignen muss, entstehen Kosten. Aus diesem Grund müssen Unternehmen, die Kosten vor einer Make-or-buy-Entscheidung, also die Entscheidung für eine Eigenproduktion oder das Zukaufen dieser, genau kalkulieren. Hiermit stellt sich die Frage, in welchem Kontext die Transaktionskostentheorie mit der Make-or-buy-Entscheidung steht.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Einordnung in die neue Institutionenökonomie
- Grundlagen der neuen Institutionenökonomie
- Ansatz nach Ronald Coase
- Ansatz nach Oliver E. Williamson
- Transaktionskosten
- Ex-ante und ex-post-Transaktionskosten
- Ex-ante Transaktionskosten
- Ex-post Transaktionskosten
- Bestimmungsgrößen
- Transaktionskostenhäufigkeit und -spezifität
- Unsicherheit
- Make-or-buy
- Grundlagen Make-or-buy
- Transaktionskostentheorie und Make-or-buy-Entscheidung
- Diskussion
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Transaktionskostentheorie im Kontext der Make-or-buy-Entscheidung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Transaktionskostentheorie bei der Entscheidung zwischen Eigenproduktion und Fremdbezug zu analysieren und zu bewerten. Das Ziel ist es, die relevanten Faktoren und Einflussgrößen zu identifizieren, die bei der Make-or-buy-Entscheidung eine Rolle spielen.
- Die Grundlagen der neuen Institutionenökonomie und deren Einfluss auf die Transaktionskostentheorie
- Die verschiedenen Arten von Transaktionskosten und deren Bedeutung für die Make-or-buy-Entscheidung
- Die Anwendung der Transaktionskostentheorie auf die Make-or-buy-Entscheidung in der Praxis
- Die Bedeutung von Faktoren wie Transaktionskostenhäufigkeit, -spezifität und Unsicherheit für die Make-or-buy-Entscheidung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Arbeitsteilung für die Entwicklung von Märkten und die Entstehung von Transaktionskosten.
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Grundlagen der neuen Institutionenökonomie. Es werden die beiden wichtigsten Erklärungsansätze der Transaktionskostentheorie, die von Ronald Coase und Oliver Eaton Williamson, vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich der Klassifizierung von Transaktionskosten in Ex-ante und Ex-post-Transaktionskosten. Es werden die verschiedenen Bestimmungsgrößen von Transaktionskosten, insbesondere die Transaktionskostenhäufigkeit, -spezifität und Unsicherheit, erläutert.
Kapitel 4 behandelt die Grundlagen der Make-or-buy-Entscheidung und die Anwendung der Transaktionskostentheorie in diesem Zusammenhang.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Transaktionskostentheorie, Make-or-buy-Entscheidung, neue Institutionenökonomie, Arbeitsteilung, Märkte, Transaktionskostenhäufigkeit, -spezifität, Unsicherheit, Eigenproduktion, Fremdbezug, Kostensenkung.
- Arbeit zitieren
- Fabio Caserta (Autor:in), 2020, In welchem Zusammenhang steht die Transaktionskostentheorie mit der Make-or-buy-Entscheidung?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/518394