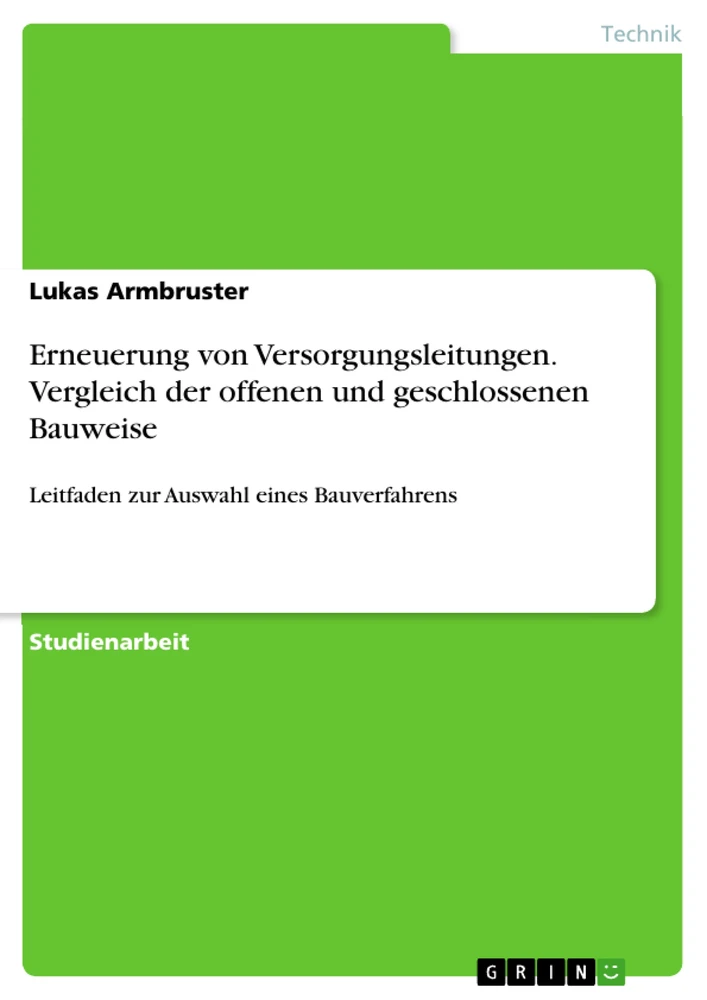Seit vielen Jahren versucht sich die Menschheit möglichst auf einfachem Wege mit Trinkwasser zu versorgen. Schon um 1250 v.Chr. sollen unter Ramses die ersten Aquädukte errichtet worden sein, um große ägyptische Städte mit Wasser zu versorgen. Bekannt wurden diese Aquädukte durch das römische Reich, welches eine Vielzahl dieser Bauwerke nutze, um die Bewohner der großen Städte mit Wasser zu versorgen. Diese Bauwerke waren Ihrer Zeit, aufgrund der Größe und anspruchsvollen Bauweise, weit voraus. Auch heute lassen sich die Bauten, teils sehr gut erhalten, von der Menschheit bestaunen.
Durch die Hohe Bevölkerungsdichte an Menschen in den Städten stieg der Verbrauch von Wasser immer weiter an und es mussten neue Möglichkeiten geschaffen werden, die benötigten Mengen und auch die Qualität des Wassers zu steigern. Zudem nahmen Problematiken wie Berge und Täler an Bedeutung immer weiter zu. Diese sind durch einfache Schwerkraft nutzende Kanäle nicht zu überwinden. Die Lösung des Problems waren Druckrohrleitungen, welche im 19ten Jahrhundert Ihren Aufschwung erlebten. Durch diese damals neuartige Technik wurde es möglich, Wasser über weite Entfernungen zu transportieren. Mit Einbruch der Industrialisierung wurden die Grundsteine der heutigen Versorgung gelegt. Es wurde zum Ziel, jedes Gebäude mit fließendem Trinkwasser zu versorgen. Zugleich bemerkte man den Nutzen von Druckrohrleitungen auch für andere Medien wie Erdgas, Chemikalien, Ölen und anderen Stoffen. Mit den Jahren entwickelten sich komplexe Verteilungsnetze, welche die Versorgung der Bevölkerung sichern sollte.
Heutzutage haben mehr als 99 % aller Bewohner in Deutschland mit einen Trinkwasseranschluss und etwa 37 % einen Erdgasanschluss versorgt. Anhand dieser Zahl wird deutlich, welche Wichtigkeit die Versorgung der Haushalte bekommen hat. Es ist zu einem Standard geworden und steigert deutlich die Lebensqualität. Um die soeben beschriebene Lebensqualität aufrecht zu erhalten und dauerhaft gewährleisten zu können, planen die Versorgungsunternehmen sehr vorrausschauend, welche Leitungen es zu sanieren oder zu erneuern gilt. Ziel eines Trinkwasserunternehmens sollte es sein, pro Jahr 2% seines Leitungsnetzes zu erneuern, da bei der Auswahl der Rohrleitung eine gesicherte
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Versorgung mit Gas und Wasser
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Begriffsdefinition
- 1.4 Zielsetzung der Arbeit
- 2. Bauverfahren zur Erneuerung
- 2.1 Offene Bauweise
- 2.1.1 Konventioneller Rohrgraben
- 2.1.2 Grabenfräse
- 2.1.3 Grabenpflug
- 2.2 Geschlossene Bauweise in vorhandener Trasse
- 2.2.1 Berstlining
- 2.2.2 Inlinerverfahren
- 2.3 Geschlossene Bauweise in neuer Trasse
- 2.3.1 Horizontalspülbohrverfahren
- 2.3.2 Bodendurschlagrakete
- 2.3.3 Pressbohren
- 2.3.4 Rammverfahren
- 3. Qualitätssicherung
- 3.1 Zertifizierungen
- 3.2 Personal
- 3.3 Druckproben und Qualität
- 4. Vergleich der offenen und geschlossenen Bauweisen
- 4.1 Zusammenfassung / Übersicht der Bauverfahren
- 4.2 Bewertungskriterien
- 4.3 Erstellen einer Checkliste zur Auswahl des Bauverfahrens
- 4.4 Erstellung eines Flussdiagramms zur Auswahl des Bauverfahrens
- 5. Praxisbeispiel
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen und vergleicht dabei die offene und geschlossene Bauweise. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile beider Verfahren aufzuzeigen und Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Verfahrens zu entwickeln.
- Vergleich offener und geschlossener Bauweisen
- Bewertungskriterien für die Auswahl des Verfahrens
- Entwicklung einer Checkliste und eines Flussdiagramms zur Entscheidungsfindung
- Analyse der Qualitätssicherung bei der Erneuerung von Leitungen
- Praxisbeispiel zur Veranschaulichung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel liefert einen historischen Überblick über die Entwicklung der Wasser- und Gasversorgung, beginnend mit antiken Aquädukten bis hin zu den modernen, komplexen Verteilungsnetzen. Es wird die Bedeutung der Versorgungssicherheit und die Herausforderungen durch die zunehmende Bevölkerungsdichte und die Topografie hervorgehoben. Die steigende Nachfrage nach Trinkwasser und Erdgas sowie deren Einfluss auf die Infrastruktur wird erläutert und die Notwendigkeit effizienter Erneuerungsverfahren unterstrichen. Der Abschnitt betont den enormen Fortschritt von einfachen Schwerkraft-Systemen zu modernen Druckrohrleitungen und die weitreichenden Auswirkungen der Industrialisierung auf die heutige Versorgungssituation.
2. Bauverfahren zur Erneuerung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert verschiedene Verfahren zur Erneuerung von Versorgungsleitungen, kategorisiert in offene und geschlossene Bauweisen. Die offene Bauweise umfasst den konventionellen Rohrgraben, die Grabenfräse und den Grabenpflug, während die geschlossene Bauweise in vorhandener Trasse Berstlining und Inlinerverfahren beinhaltet und in neuer Trasse Horizontalspülbohrverfahren, Bodendurschlagrakete, Pressbohren und Rammverfahren umfasst. Es werden die jeweiligen Verfahren mit ihren Vor- und Nachteilen im Detail erläutert, die jeweiligen Arbeitsweisen beschrieben und technische Besonderheiten hervorgehoben. Die Kapitel vermittelt ein umfassendes Verständnis der verschiedenen technischen Möglichkeiten zur Leitungserneuerung.
3. Qualitätssicherung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Aspekten der Qualitätssicherung bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen. Es beleuchtet die Rolle von Zertifizierungen, die Bedeutung qualifizierten Personals und die Durchführung von Druckproben zur Qualitätssicherung. Die Kapitel beschreibt wesentliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität und der Langlebigkeit der erneuerten Leitungen und betont die Notwendigkeit von strengen Qualitätskontrollen in jeder Phase des Projekts. Die Bedeutung von Fachwissen und regelmäßigen Prüfungen für die langfristige Funktionalität wird ausführlich behandelt.
4. Vergleich der offenen und geschlossenen Bauweisen: In diesem Kapitel werden die verschiedenen in Kapitel 2 beschriebenen Bauverfahren übersichtlich gegenübergestellt und anhand von Bewertungskriterien verglichen. Es wird eine Checkliste zur Auswahl des optimalen Verfahrens erstellt, die die individuellen Projektbedingungen berücksichtigt. Ein Flussdiagramm visualisiert den Entscheidungsprozess und unterstützt die systematische Auswahl des geeigneten Verfahrens. Das Kapitel fasst die Stärken und Schwächen jeder Methode zusammen und bietet eine praxisorientierte Anleitung zur Entscheidungsfindung.
5. Praxisbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Praxisbeispiel, welches die Anwendung der vorgestellten Methoden und die Auswahl eines geeigneten Verfahrens veranschaulicht. Der Fokus liegt auf der konkreten Umsetzung und der jeweiligen Vorgehensweise, unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen des Beispiels. Anhand des konkreten Fallbeispiels werden die theoretischen Erkenntnisse praktisch angewendet und verdeutlicht.
FAQ: Erneuerung von Versorgungsleitungen - Offene und Geschlossene Bauweisen
Was ist der Inhalt dieser Projektarbeit?
Diese Projektarbeit befasst sich umfassend mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen (Gas und Wasser). Sie vergleicht offene und geschlossene Bauweisen, zeigt deren Vor- und Nachteile auf und entwickelt Kriterien zur Auswahl des geeigneten Verfahrens. Die Arbeit beinhaltet eine Einführung, detaillierte Beschreibungen verschiedener Bauverfahren, einen Abschnitt zur Qualitätssicherung, einen Vergleich der Bauweisen mit Checkliste und Flussdiagramm sowie ein Praxisbeispiel.
Welche Bauverfahren werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Bauverfahren, unterteilt in offene und geschlossene Bauweisen. Zu den offenen Bauweisen gehören der konventionelle Rohrgraben, die Grabenfräse und der Grabenpflug. Geschlossene Bauweisen in vorhandener Trasse umfassen Berstlining und Inlinerverfahren. Geschlossene Bauweisen in neuer Trasse beinhalten Horizontalspülbohrverfahren, Bodendurschlagrakete, Pressbohren und Rammverfahren. Jedes Verfahren wird detailliert erläutert, inklusive Vor- und Nachteile.
Wie werden offene und geschlossene Bauweisen verglichen?
Kapitel 4 vergleicht die verschiedenen Bauverfahren übersichtlich. Es werden Bewertungskriterien definiert, um die optimale Methode für ein gegebenes Projekt auszuwählen. Eine Checkliste und ein Flussdiagramm unterstützen die systematische Entscheidungsfindung, indem sie die Stärken und Schwächen jeder Methode gegenüberstellen und einen praxisorientierten Leitfaden bieten.
Welche Aspekte der Qualitätssicherung werden behandelt?
Die Qualitätssicherung wird in Kapitel 3 behandelt. Es werden Zertifizierungen, qualifiziertes Personal und Druckproben als wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität und Langlebigkeit der erneuerten Leitungen hervorgehoben. Die Notwendigkeit strenger Qualitätskontrollen in allen Projektphasen und die Bedeutung von Fachwissen und regelmäßigen Prüfungen werden ausführlich diskutiert.
Gibt es ein Praxisbeispiel?
Ja, Kapitel 5 präsentiert ein konkretes Praxisbeispiel, das die Anwendung der vorgestellten Methoden und die Auswahl eines geeigneten Verfahrens veranschaulicht. Es zeigt die konkrete Umsetzung und Vorgehensweise unter Berücksichtigung spezifischer Bedingungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Vor- und Nachteile offener und geschlossener Bauweisen bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen aufzuzeigen und Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Verfahrens zu entwickeln. Zusätzlich werden eine Checkliste und ein Flussdiagramm zur Entscheidungsfindung erstellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Vergleich offener und geschlossener Bauweisen, die Entwicklung von Bewertungskriterien, die Erstellung einer Checkliste und eines Flussdiagramms zur Entscheidungsfindung, die Analyse der Qualitätssicherung und die Präsentation eines Praxisbeispiels.
- Quote paper
- Lukas Armbruster (Author), 2019, Erneuerung von Versorgungsleitungen. Vergleich der offenen und geschlossenen Bauweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/518333