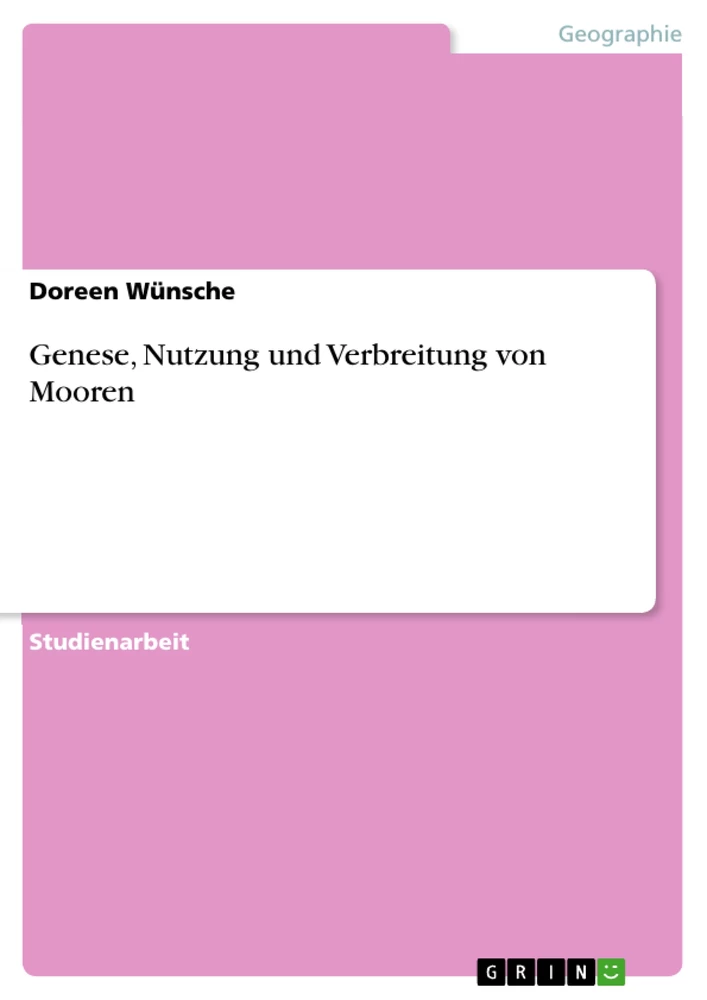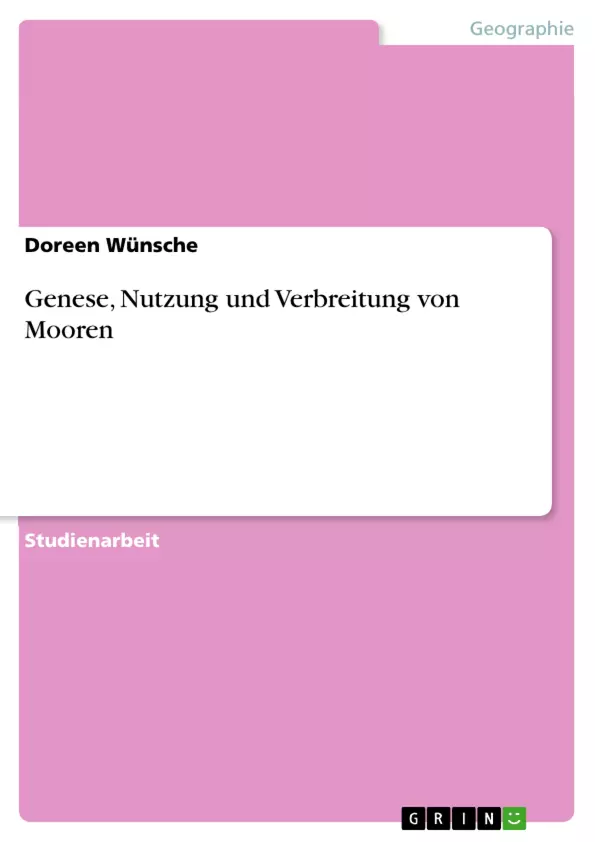Gegenwärtig sind durch zahlreiche anthropogene Eingriffe in den Naturhaushalt kaum noch naturnahe, geschweige denn natürliche Ökosysteme vorzufinden. Moore zählen zu den wenigen naturnahen Ökosystemen, die nach wie vor existent sind und eine Besonderheit hinsichtlich ihrer Entstehung und ihrer pflanzlichen sowie tierischen Artenzusamensetzung bilden. Je nach geographischer Lage und daran gekoppelter klimatischer Gegebenheiten lassen sich zahlreiche Klassifikationen und Typen unterscheiden, die in der vorliegenden Arbeit vorgestellt werden sollen. Neben Eigenschaften der Moore und einer daraus abgeleiteten Auswahl an Nutzungsmöglichkeiten wird auf mögliche Schutzmaßnahmen eingegangen, die in Bezug auf den drastischen Rückgang der Verbreitungsgebiete zwingend notwendig sind. Die vorliegende Arbeit zur Genese, Nutzung und Verbreitung von Mooren besitzt lediglich einen Überblicks-Charakter und soll zur intensiveren Befassung mit diesem Ökosystem anregen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 3 Genese der Moore
- 3.1 Niedermoor
- 3.2 Übergangsmoor
- 3.3 Hochmoor
- 4 Klassifikation der Moore
- 4.1 Die hydrologischen Moortypen
- 4.1.1 primäre Moorformen
- 4.1.1.1 Verlandungsmoore
- 4.1.1.2 Versumpfungsmoore
- 4.1.1.3 Überflutungsmoore
- 4.1.1.4 Hangmoore
- 4.1.1.5 Quellmoore
- 4.1.2 sekundäre Moorformen
- 4.1.2.1 Durchströmungsmoore
- 4.1.2.2 Kesselmoore
- 4.1.3 tertiäre Moorform
- 4.1.3.1 Regenmoore
- 4.1.3.2 Klassische Hochmoore
- 4.1.1 primäre Moorformen
- 4.2 Die ökologischen Moortypen
- 4.2.1 Reichmoore
- 4.2.2 Kalk-Zwischenmoore
- 4.2.3 Basen-Zwischenmoore
- 4.2.4 Sauer-Zwischenmoore
- 4.2.5 Sauer-Armmoore
- 4.1 Die hydrologischen Moortypen
- 5 Eigenschaften der Moore
- 6 Nutzung und Kultivierung von Mooren
- 6.1 Kurzer historischer Abriss über die verschiedenen Nutzungsformen
- 6.2 Beschreibung der Nutzungs- und Kultivierungsformen
- 6.2.1 Raseneisenerznutzung
- 6.2.2 Wiesenkalknutzung
- 6.2.3 Torfnutzung
- 6.2.4 Kultivierung von Mooren
- 6.2.4.1 Moorbrandkultur
- 6.2.4.2 Schwarzkulturen (Niedermoorschwarzkultur)
- 6.2.4.3 Deutsche Hochmoorkultur
- 6.2.4.4 Sanddeckkultur
- 6.2.4.5 Sandmischkultur
- 6.2.4.6 Fehnkultur
- 7 Schutz der Moore
- 8 Verbreitung
- 8.1 Deutschland
- 8.1.1 Moore im Hochharz
- 8.1.1.1 Rotes Moor
- 8.1.1.2 Königsmoor
- 8.1.2 Norddeutsche Moore
- 8.1.3 Moore in den Kammlagen des Thüringer Waldes
- 8.1.4 Moore des Alpenvorlandes
- 8.1.1 Moore im Hochharz
- 8.2 globale Verbreitung
- 8.2.1 Verteilung der Moorzonen in Europa
- 8.2.2 Verteilung der Moore auf der Erde
- 8.1 Deutschland
- 9 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Entstehung, Nutzung und Verbreitung von Mooren zu geben. Es werden die Genese verschiedener Moortypen, ihre Klassifizierung nach hydrologischen und ökologischen Kriterien sowie ihre historische und aktuelle Nutzung beleuchtet.
- Genese und Entwicklung von Mooren
- Klassifizierung von Mooren nach verschiedenen Kriterien
- Historische und moderne Nutzung von Mooren
- Ökologische Bedeutung und Schutz von Mooren
- Globale Verbreitung von Mooren
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Moore als einzigartige Ökosysteme ein. Sie hebt deren besondere Flora und Fauna hervor und betont die Bedeutung des Torfs für die landwirtschaftliche Nutzung und den damit verbundenen Verlust an natürlichen Lebensräumen. Die Arbeit kündigt die detaillierte Auseinandersetzung mit Entstehung, Bedeutung und Nutzung von Mooren an.
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt die Begriffe Moor, Anmoor, Gley und Torf. Es definiert Moore als Ökosysteme mit schnellerer Produktion als Abbau organischer Substanz unter anaeroben Bedingungen. Anmoor wird als saurer Mineralbodentyp zwischen Gley und Moorboden beschrieben, Gley als vernäßter mineralischer Bodentyp, und Torf als Zersetzungsprodukt pflanzlicher Substanzen, das die erste Stufe der Inkohlung darstellt. Die Bedeutung des Torfprofils für die Rekonstruktion der Moorgeschichte wird hervorgehoben, ebenso wie die Bedingungen für Torfbildung (feucht-kühles Klima, Nährstoffmangel).
3 Genese der Moore: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung mitteleuropäischer Moore nach dem Ende der letzten Eiszeit. Es beschreibt den Ausgangspunkt in subhydrischen Böden in Toteisseen und Schmelzwasserrinnen und erklärt den Prozess der Torfbildung durch verlangsamten Abbau organischer Substanz aufgrund von Sauerstoffmangel und niedrigen Temperaturen. Die Bildung von schwer zersetzbaren Huminsäuren, die dem Torf seine typische Färbung und seinen sauren Charakter verleihen, wird erläutert.
Schlüsselwörter
Moore, Torf, Genese, Klassifikation, Nutzung, Kultivierung, Hochmoor, Niedermoor, Ökologie, Schutz, Verbreitung, Hydromorphe Böden, Anaerobe Zersetzung, Huminsäuren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Ein umfassender Überblick über Moore
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über Moore, von ihrer Entstehung und Klassifizierung bis hin zu ihrer Nutzung und Verbreitung. Er behandelt die Genese verschiedener Moortypen, ihre hydrologische und ökologische Einteilung, historische und aktuelle Nutzungsformen sowie den Schutz von Mooren.
Welche Moortypen werden im Text behandelt?
Der Text beschreibt verschiedene Moortypen, unterteilt nach ihrer Genese (Niedermoor, Übergangsmoor, Hochmoor) und ihrer Klassifizierung nach hydrologischen (primäre, sekundäre und tertiäre Moorformen wie Verlandungs-, Versumpfungs-, Überflutungs-, Hang-, Quell-, Durchströmungs-, Kessel-, Regen- und klassische Hochmoore) und ökologischen Kriterien (Reichmoore, Kalk-Zwischenmoore, Basen-Zwischenmoore, Sauer-Zwischenmoore, Sauer-Armmoore).
Wie werden Moore im Text klassifiziert?
Die Klassifizierung der Moore erfolgt nach zwei Hauptkriterien: hydrologischen (basierend auf der Wasserversorgung) und ökologischen (basierend auf Nährstoffgehalt und pH-Wert). Die hydrologische Klassifizierung unterscheidet primäre, sekundäre und tertiäre Moorformen, während die ökologische Klassifizierung Reichmoore, Zwischenmoore und Armmoore umfasst.
Welche historischen und modernen Nutzungsformen von Mooren werden beschrieben?
Der Text beleuchtet die historische Nutzung von Mooren, einschließlich der Raseneisenerz-, Wiesenkalk- und Torfnutzung. Die modernen Nutzungs- und Kultivierungsformen werden ebenfalls detailliert beschrieben, darunter Moorbrandkultur, Schwarzkulturen, deutsche Hochmoorkultur, Sanddeckkultur, Sandmischkultur und Fehnkultur.
Welche Bedeutung haben die Schlüsselbegriffe im Text?
Schlüsselbegriffe wie "Moor", "Torf", "Genese", "Klassifikation", "Nutzung", "Kultivierung", "Hochmoor", "Niedermoor", "Ökologie", "Schutz" und "Verbreitung" bilden das Kernvokabular des Textes und sind essentiell für das Verständnis der behandelten Thematik. Zusätzlich werden Begriffe wie "hydromorphe Böden", "anaerobe Zersetzung" und "Huminsäuren" im Detail erklärt.
Welche Kapitel enthält der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text ist in mehrere Kapitel gegliedert, die jeweils spezifische Aspekte der Moorforschung behandeln. Dies umfasst eine Einleitung, Begriffsklärungen, die Genese der Moore, ihre Klassifizierung, Eigenschaften, Nutzung und Kultivierung, den Schutz von Mooren, ihre Verbreitung (in Deutschland und global) und abschließend eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel baut auf den vorhergehenden auf und liefert detaillierte Informationen zu den jeweiligen Themen.
Wo liegen die Schwerpunkte des Textes?
Die Schwerpunkte des Textes liegen auf der umfassenden Darstellung der Entstehung, Nutzung und Verbreitung von Mooren. Die Genese verschiedener Moortypen, ihre Klassifizierung nach hydrologischen und ökologischen Kriterien sowie ihre historische und aktuelle Nutzung werden detailliert beleuchtet. Die ökologische Bedeutung und der Schutz von Mooren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Beispiele für Moore werden genannt?
Als Beispiele für Moore werden unter anderem das Rote Moor und das Königsmoor im Hochharz genannt. Der Text erwähnt auch die norddeutschen Moore, die Moore in den Kammlagen des Thüringer Waldes und die Moore des Alpenvorlandes. Darüber hinaus wird die globale Verbreitung der Moorzonen in Europa und auf der Erde behandelt.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text eignet sich für Personen, die sich umfassend über Moore informieren möchten, beispielsweise Studierende der Geographie, Biologie oder Umweltwissenschaften. Er ist auch für alle anderen Interessierten geeignet, die ein tiefes Verständnis der Entstehung, Nutzung und ökologischen Bedeutung von Mooren erlangen wollen.
- Quote paper
- Doreen Wünsche (Author), 2004, Genese, Nutzung und Verbreitung von Mooren, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/51607