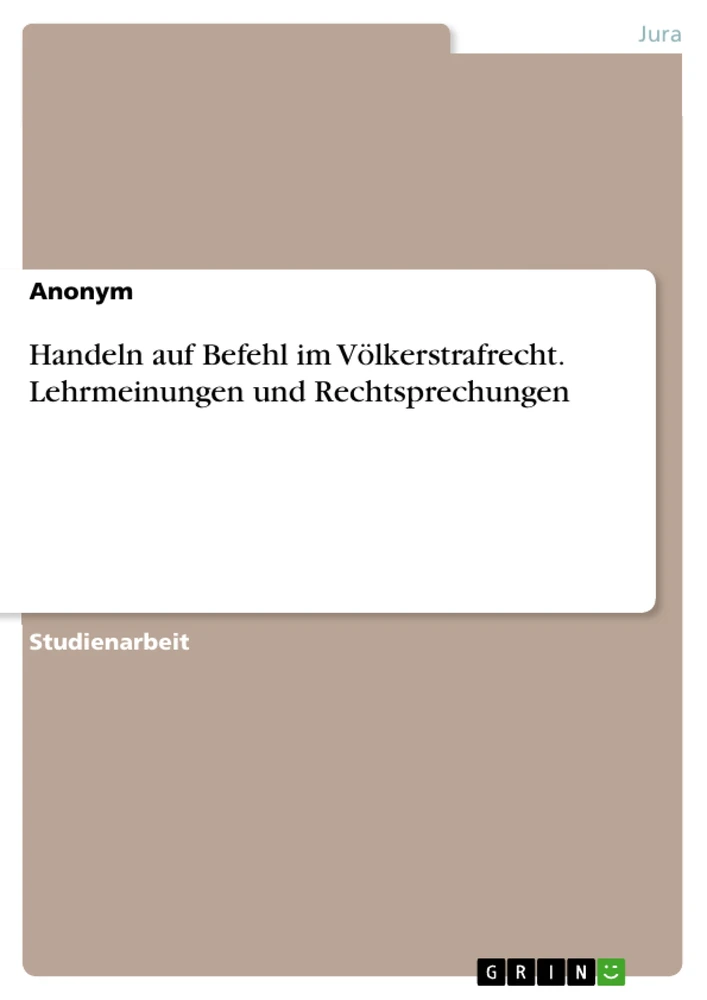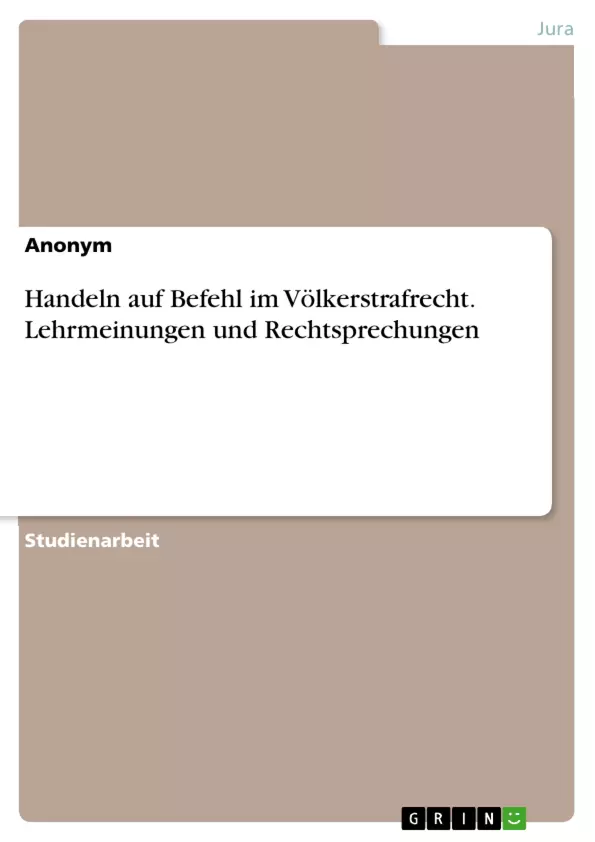Die vorliegende Untersuchung soll die Entwicklung der Befehlsproblematik erläutern. Primär soll erörtert werden, ob das Handeln auf Befehl als selsbtständiger Strafausschlussgrund anerkannt wurde, oder ob es nur als strafmildern in Betracht fallen konnte.
Ausschlaggebend zur Beantwortung der Frage ist, welchen Theorien jeweils gefolgt wird. Der Fokus liegt in dieser Arbeit auf den Nürnberger- und Nachfolgeprozessen. In einem ersten Teil sollen die grundlegenden Lehrmeinungen dargelegt werden. Sie kategorisieren die möglichen Lösungen zum Umgang mit der Befehsproblematik und sind von elementarer Bedeutung für die Judikatur. In einem zweiten Teil sollen die völkerrechtlichen Quellen untersucht werden. Zudem soll erörtert werden, ob eine gewohnheitsrechtliche Praxis bestand.
In einem dritten Teil soll die wichtigsten Entscheide zur Befehlsproblematik aufgeführt werden. Im vierten Teil sollen dann die Problemfelder erörtert werden, die sich aus der Rechtsprechung ergeben. Ein Eklärungsversuch soll darlegen, woher diese Unstimmigkeiten stammen. Als Ausblick soll im letzten Teil aufgeführt werden, inwiefern die heutigen Regelung im römischen Statut eine vermittelnde Lösung darstellen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Befehlsproblematik
- Abgrenzung des Handelns auf Befehl
- Befehlscharakter der Anordnung
- Rechtswidrigkeit des Befehls
- Abgrenzung von anderen Verteidigungseinwänden
- Handeln auf Befehl als „Defence"
- Teil I: Völkerrechtliche Lehrmeinungen
- Handeln auf Befehl als Strafausschlussgrund – Respondeat Superior
- Prinzip der Unbedingten Verantwortlichkeit - Absolute- oder Strict Liability Principle
- Prinzipien der Bedingten Verantwortlichkeit - Conditional Liability Principles
- Prinzip der Offensichtlichen Rechtswidrigkeit - Manifest IllegalitY- und Personal Knowledge Principle
- Mens Rea Prinzip
- Fazit
- Teil II: Schaffung einer Norm zum Handeln auf Befehl
- Nach dem Ersten Weltkrieg
- Nach dem Zweiten Weltkrieg
- Zwischenfazit
- Bildung von Völkergewohnheitsrecht durch Art. 8 IMT-Statut
- Fazit
- Teil III: Völkerrechtliche Rechtsprechung zum Befehlshandeln
- Die Leipziger Prozesse
- Entscheidungsgrundlage der Leipziger Prozesse
- Dover- und Llandovery Castle
- Nürnberger- und Deutsche Nachfolgeprozesse
- Der Prozess vor dem Internationalen Militärtribunal
- Einwände der Verteidigung und Vorbringen des Tribunals
- Moral Choice Test
- Nachfolgeprozesse unter Kontrollratsgesetz Nr. 10
- Prozess gegen die Südost-Generäle (Geisel-Prozess)
- Einsatzgruppen-Prozess
- Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht (OKW-Prozess)
- Tokioter Prozesse
- Ad-hoc Tribunale von Ruanda und dem ehemaligen Jugoslawien
- Fall Erdemovic
- Zusammenfassung
- Ergebnis und Bewertung
- Teil IV: Analyse der Unstimmigkeiten
- Moral Choice Test von Nürnberg
- Uneinheitliche Rechtsprechung
- Befehlsnotstand
- Irrtum und Befehlshandeln
- Prüfungspflicht
- Fazit
- Ursachen
- Betrachtung der Urteile
- Teil V: Das Römische Statut als Mittelweg
- Inhalt von Art. 33 IStGH-Statut
- Mischlösung zwischen den Prinzipien der Unbedingten Verantwortlichkeit und der Offensichtlichen Rechtswidrigkeit
- Schlussfolgerund und Ausblick
- Entwicklung des Rechtsbegriffs des Handelns auf Befehl im Völkerstrafrecht
- Unterscheidung der verschiedenen Lehrmeinungen und Prinzipien zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Kontext von Befehlen
- Analyse der Rechtsprechung im Hinblick auf das Handeln auf Befehl in den Nürnberger Prozessen und anderen internationalen Gerichtsverfahren
- Bewertung der aktuellen Rechtslage und der Herausforderungen der Rechtsanwendung im Kontext von Befehlshandeln
- Einordnung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs im Kontext der Diskussion um die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Befehlshandeln
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Untersuchung verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Rechtsprechung zum Handeln auf Befehl im Völkerstrafrecht zu erforschen und dabei die verschiedenen Lehrmeinungen und Prinzipien, die in diesem Bereich Anwendung finden, zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf den Nürnberger Prozessen und ihren Nachfolgeprozessen, wobei die Entwicklung von völkerrechtlichen Normen und die Herausforderungen der Rechtsanwendung im Wandel der Zeit beleuchtet werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Bedeutung des Problems des Handelns auf Befehl und stellt die Fragestellung der Untersuchung dar. Sie skizziert die zentralen Themenbereiche und erläutert die Relevanz des Themas für die völkerrechtliche Ordnung.
Der erste Teil befasst sich mit verschiedenen völkerrechtlichen Lehrmeinungen zum Handeln auf Befehl. Er behandelt die Prinzipien der unbedingten und der bedingten Verantwortlichkeit und geht auf die entsprechenden Rechtsgrundlagen und -konzepte ein.
Im zweiten Teil werden die völkerrechtlichen Quellen des Handelns auf Befehl beleuchtet, insbesondere die Entwicklung von Normen nach den Weltkriegen und die Rolle von Art. 8 des IMT-Statuts.
Der dritte Teil analysiert die völkerrechtliche Rechtsprechung zum Befehlshandeln, insbesondere im Kontext der Leipziger und Nürnberger Prozesse. Er beleuchtet die Argumente der Verteidigung und des Tribunals, die Anwendung des "Moral Choice Test" und weitere relevante Gerichtsentscheidungen.
Der vierte Teil untersucht die Unstimmigkeiten in der Rechtsprechung zum Handeln auf Befehl und beleuchtet die Ursachen für diese Diskrepanzen. Er analysiert die verschiedenen Rechtskonzepte und die Probleme der Anwendung des "Moral Choice Test".
Schlüsselwörter
Handeln auf Befehl, Völkerstrafrecht, Rechtswidrigkeit, Nürnberger Prozesse, Tokioter Prozesse, internationales Strafrecht, Römisches Statut, Verantwortlichkeit, Strafmilderung, Strafausschlussgrund, "Moral Choice Test", Lehrmeinungen, Prinzipien, Rechtsprechung, Rechtsquellen, Völkergewohnheitsrecht.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Handeln auf Befehl im Völkerstrafrecht. Lehrmeinungen und Rechtsprechungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/513877