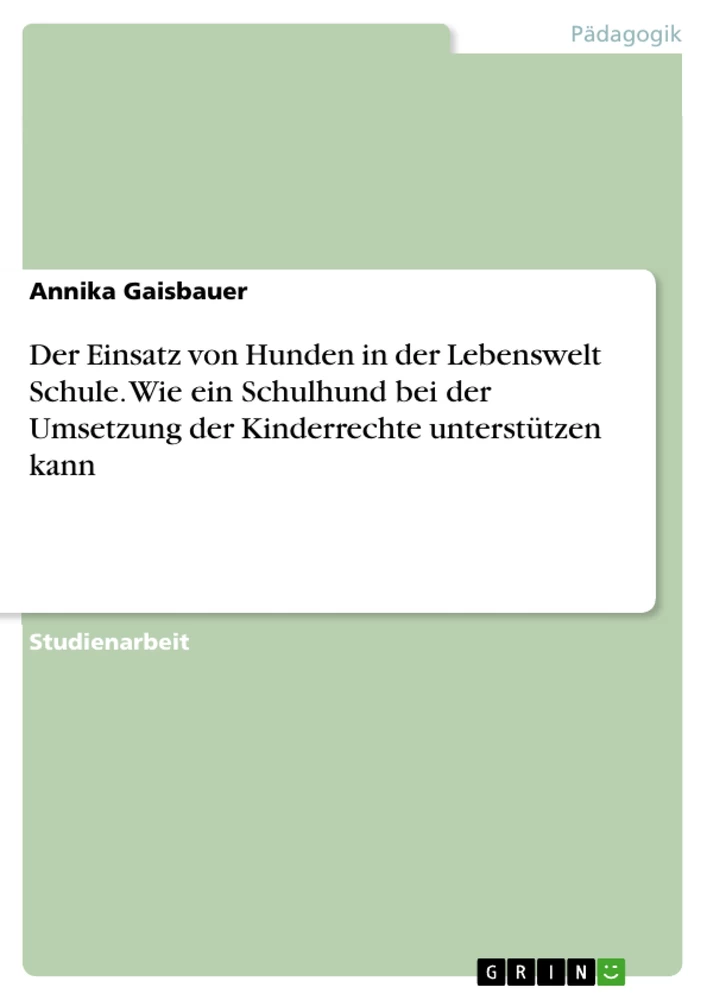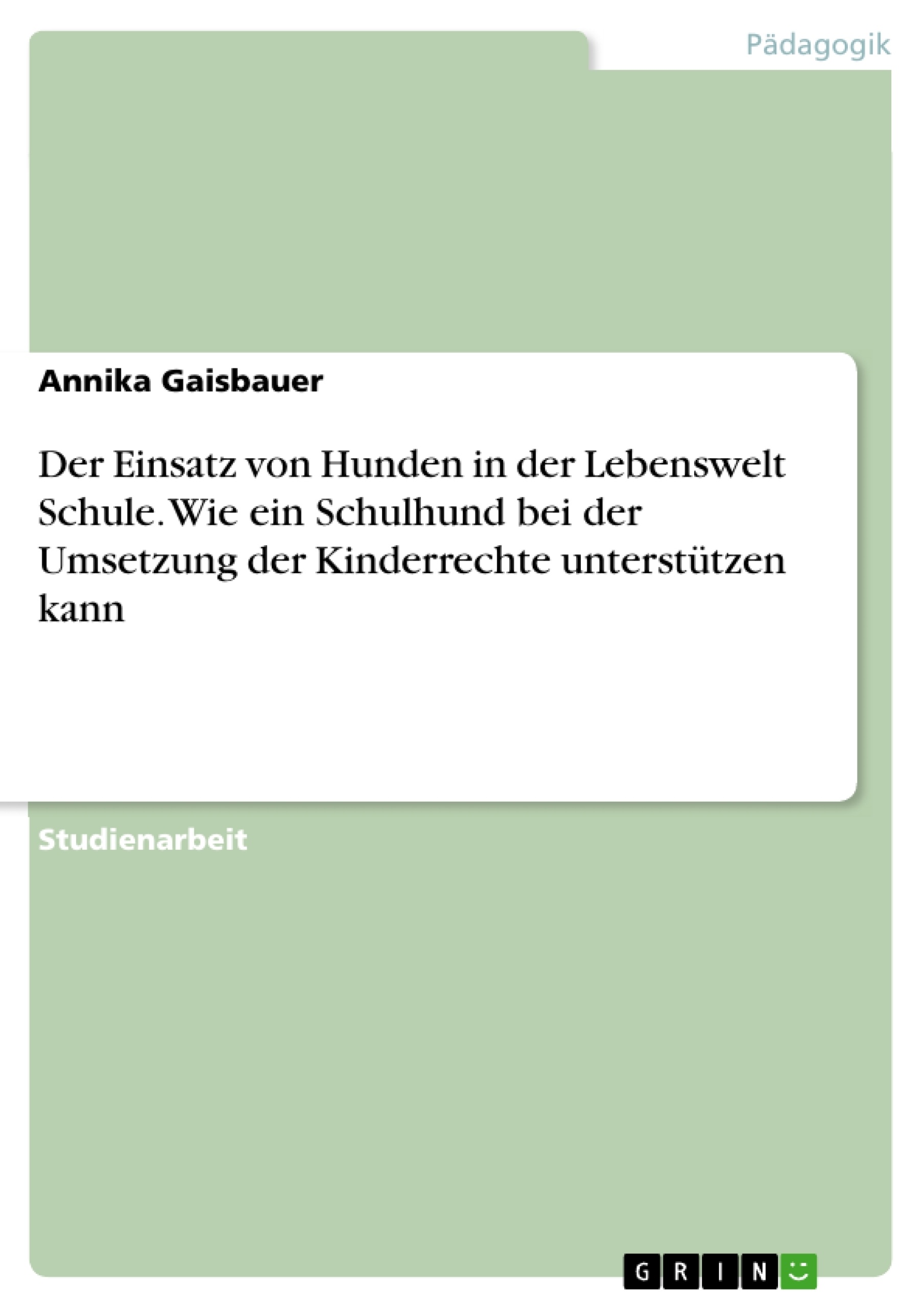In dieser Arbeit soll geklärt werden, ob der Einsatz eines Schulhundes die Lebenswelt Schule der Kinder verbessern und helfen kann, ihre Rechte umzusetzen. Zunächst wird hierzu die Lebenswelt Schule und ihre Problematiken genauer betrachtet. Es folgt ein Einblick in die UN-Kinderrechtskonvention, von welcher Artikel 28 - Das Recht auf Bildung - genauer analysiert wird. Auch geht es darum, ob und wie Kinderrechte in der Schule konkret umgesetzt werden. Als Letztes wird in die Thematik der hundegestützten Intervention eingeführt. Es wird die Frage geklärt, welche pädagogischen Ziele ein Schulhund verfolgt und wie Hunde auf den Menschen wirken.
Im ersten Moment stehen viele Menschen dieser Art der Pädagogik skeptisch gegenüber. Dass ein Hund den Unterricht nicht stört, die SchülerInnen nicht aufwühlt, sondern diese beruhigt und fördert, kann schwer zu begreifen sein. Jedoch sind Hunde in der Schule, sogenannte "Schulhunde", Teil eines ausgearbeiteten Konzepts und werden gezielt eingesetzt, um das Klassenklima zu verbessern und das Wohlbefinden der Kinder in der Lebenswelt Schule zu fördern.
In jeder Lebenswelt existieren spezifische Umgangsformen, Drehbücher und Handlungsannahmen. Da sich diese Merkmale in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich äußern, spricht man von einer Vielzahl an Lebenswelten und nicht von einer allumfassenden. Beispiele für Lebenswelten von Kindern sind Familie, Schule oder Freizeit. Diese verschiedenen Lebenswelten eines Kindes existieren nicht ohne Beziehung nebeneinander, sondern beeinflussen sich permanent gegenseitig. Eine solche Beeinflussung kann sich sowohl positiv, als auch negativ auf die anderen Lebenswelten auswirken. Dieser Einfluss lässt sich am Beispiel einer Handlungsannahme erklären.
Eine Handlung kann in einer bestimmten Lebenswelt erfolgreich sein; ist dies der Fall, so wird meist auch in den anderen Lebenswelten auf diese Art gehandelt. Es wird angenommen, dass diese Handlung für alle Lebenswelten die richtige ist. So kann ein Kind, welches in der Familie einen offenen und herzlichen Umgang mit den Familienmitgliedern erfährt und lebt, dies an die Lebenswelt Schule anknüpfen und wird dort offen auf MitschülerInnen zugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schule als Lebenswelt
- Kinderrechte
- Kinderrechte im Überblick
- Das Recht auf Bildung in Deutschland
- Kinderrechte in der schulischen Umsetzung
- Schulhunde
- Hundegestützte Intervention und Allgemeines
- Pädagogische Ziele
- Wirkfaktoren von Schulhunden
- Physische und psychische Stressreduktion
- Förderung positiver sozialer Interaktionen
- Rückmeldungen von SchülerInnen und Lehrkräften
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Einsatz von Schulhunden die Lebenswelt Schule für Kinder verbessern und ihnen helfen kann, ihre Rechte umzusetzen. Dazu werden zunächst die Lebenswelt Schule und ihre Problematiken untersucht, die UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere Artikel 28 (Das Recht auf Bildung), und die Umsetzung von Kinderrechten in der Schule analysiert. Schließlich wird das Konzept der hundegestützten Intervention eingeführt und die pädagogischen Ziele sowie die Auswirkungen von Schulhunden auf den Menschen untersucht.
- Lebenswelt Schule und ihre Herausforderungen
- Kinderrechte und ihre Bedeutung in der schulischen Praxis
- Das Recht auf Bildung und seine Umsetzung in Deutschland
- Hundegestützte Intervention und ihre pädagogischen Ziele
- Die Auswirkungen von Schulhunden auf das Wohlbefinden von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Einsatzes von Schulhunden vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Lebenswelt Schule, ihren Merkmalen, den Herausforderungen und ihrer Bedeutung für die Entwicklung von Kindern. Es wird untersucht, wie die Schule als Lebenswelt mit anderen Lebenswelten interagiert und wie diese Wechselwirkungen die Entwicklung von Kindern beeinflussen können.
Im dritten Kapitel wird die UN-Kinderrechtskonvention und ihre Bedeutung für das Wohlergehen von Kindern dargestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird Artikel 28 (Das Recht auf Bildung) gewidmet. Weiterhin wird analysiert, wie die Kinderrechte in der Schule konkret umgesetzt werden.
Das vierte Kapitel führt in die Thematik der hundegestützten Intervention ein. Es wird untersucht, welche pädagogischen Ziele ein Schulhund verfolgt und welche Auswirkungen Hunde auf den Menschen haben. Die Auswirkungen von Schulhunden auf die Stressreduktion und die Förderung positiver sozialer Interaktionen werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Schulhunde, Lebenswelt Schule, Kinderrechte, UN-Kinderrechtskonvention, Recht auf Bildung, hundegestützte Intervention, Pädagogik, Sozialisation, Wohlbefinden, Stressreduktion, soziale Interaktionen.
- Arbeit zitieren
- Annika Gaisbauer (Autor:in), 2017, Der Einsatz von Hunden in der Lebenswelt Schule. Wie ein Schulhund bei der Umsetzung der Kinderrechte unterstützen kann, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/511694