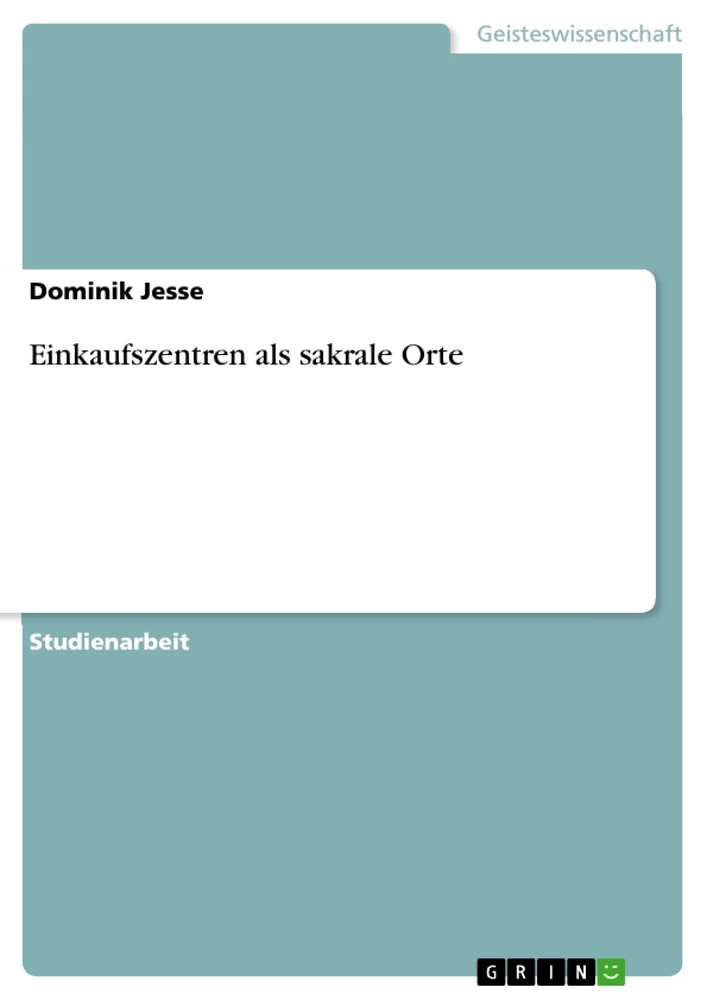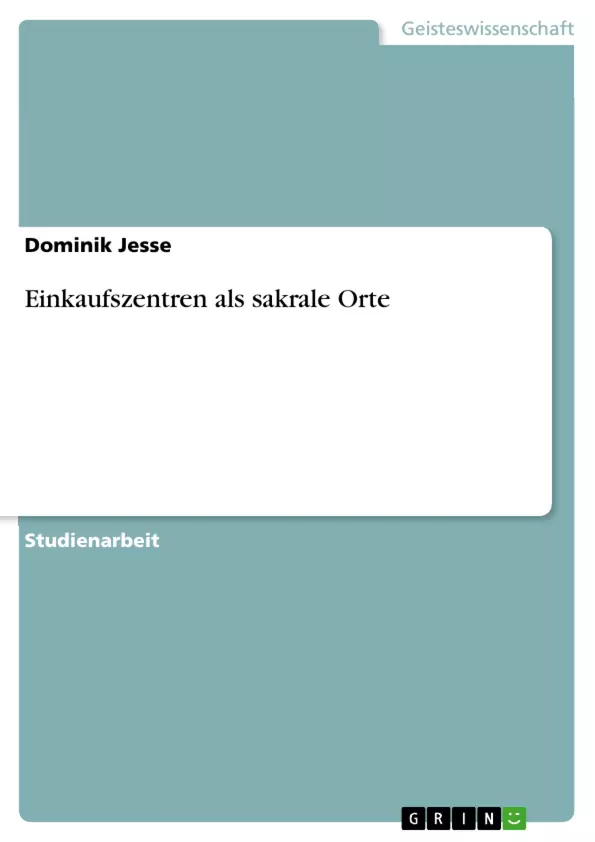Einkaufszentren sind sakrale Orte, weil sie als in Stein gehauene Tempel eine „heilige Ordnung“ repräsentieren, der sich nicht entziehen darf, wer zu dieser Ordnung dazugehören will. Sie erfüllen Funktionen, die noch vor etwa 150 Jahren vornehmlich den Kirchen und staatlichen Institutionen zugeschrieben wurden. Waren es in archaischer Zeit die Heiligtümer und noch im Mittelalter die Klöster, um die herum sich städtisches Leben zu entwickeln begann, so sind es heute die Shopping Center, Einkaufs-Passagen und Malls mit ihrer Gigantomanie des konzentrierten Einzelhandels, die v.a. in Nordamerika so genannte Suburbs erklären. Diese Center waren indes nirgends und niemals als reine Verkaufsmaschinen angelegt worden, sondern übernahmen als öffentliche Räume immer auch soziale Funktionen. Mittlerweile stellen sie ein nicht mehr wegzudenkendes Element der postmodernen Konsumkultur dar, einen Gegenpool quasi zur Unsicherheit des täglichen Lebens, einen Ort zur Selbstverwirklichung und eine freizeitliche Gegenwelt zum „tristen“ Alltag. Sie sind in dem Maße zu Heiligtümern geworden, in dem das Einkaufen, das Shopping, zum Erlebnis wurde. Sie sind die „Kathedralen des Konsums“, die „Konsumtempel“, die „pleasure domes“, und ihre religiös gefärbte Titulatur ist nicht übertrieben, denn sie stellen Orte „eines Glaubensbekenntnisses“ dar, „in dem die Innerlichkeit säkularisiert und in den Bann des glitzernden Tauschwerts gerissen wurde“ (Strohmeyer). Im Folgenden soll sich diesem Phänomen gewidmet und untersucht werden, was genau Einkaufszentrum zu sakralen Orten macht. Dabei sind verschiedene Blickwinkel zu berücksichtigen, deren erster eine allgemeine Definition des sakralen Ortes darstellt, der nur in Abgrenzung zum Pro-fanum zu einem solchen werden kann (Durkheim) und über moderne Mythen und Rituale Rechtfertigung erfährt. Über eine kurze Betrachtung der Warenhäuser des 19. und 20. Jahrhunderts sollen Muster einer v.a. architektonischen „Sakralisierung des Konsums“ herausgestellt werden, bevor sich eine Charakterisierung des modernen „Konsumtempels“ anschließt. Des besseren Verständnisses muss zudem eine Einschätzung des postmodernen Konsums erfolgen und die Klärung der Frage, inwiefern dieser religiöse Züge gewonnen hat bzw. schon immer besaß. Abschließend wird ein (freilich sehr extremes) Beispiel des „perfekten sakralen Ortes“ gegeben: Heritage Village in den USA.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Definition vom sakralen Ort: Zur Unterscheidung von sakral und profan
- Definition von Mythos und Ritual
- Das Einkaufszentrum als sakraler Ort
- Die Architektur des sakralen Ortes
- Warenhäuser des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
- Die Architektur der Einkaufszentren
- Der postmoderne „Konsumtempel“
- Konsum als Religion?
- Heritage Village als Perfektion des sakralen Ortes
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung untersucht die These, dass moderne Einkaufszentren als sakrale Orte betrachtet werden können. Die Arbeit analysiert die Architektur, die sozialen Funktionen und den rituellen Charakter von Einkaufszentren, um deren Ähnlichkeiten mit traditionellen sakralen Räumen aufzuzeigen. Die Betrachtungsweise stützt sich auf soziologische Theorien, insbesondere Durkheims Religionstheorie.
- Definition des sakralen Raums im Vergleich zum Profanen
- Architekturhistorische Parallelen zwischen Warenhäusern und Sakralbauten
- Der Konsum als modernes Ritual und seine religiösen Züge
- Die Rolle von Einkaufszentren in der postmodernen Konsumkultur
- Das Beispiel Heritage Village als idealtypischer „sakraler Ort“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die These, dass Einkaufszentren als moderne, sakrale Orte fungieren, indem sie soziale Funktionen übernehmen, die früher Kirchen und staatlichen Institutionen vorbehalten waren. Kowinskis ironische Beschreibung eines Lebens, das komplett in einem Einkaufszentrum ablaufen könnte, veranschaulicht die omnipräsente Rolle dieser Orte in der modernen Gesellschaft. Die Einleitung skizziert die zentralen Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit.
Definitionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „sakraler Ort“ auf der Grundlage von Durkheims Religionstheorie. Es wird die strikte Trennung zwischen dem Sakralen und Profanen hervorgehoben, wobei die Andersartigkeit und die gegenseitige Exklusivität beider Sphären betont werden. Initiationsriten und die Notwendigkeit einer Metamorphose, um vom Profanen ins Sakrale zu gelangen, werden erläutert. Die kollektive Natur der Sakralität und die Bedeutung von Symbolen und kollektivem Bewusstsein werden ebenfalls diskutiert.
Das Einkaufszentrum als sakraler Ort: Dieser Abschnitt vertieft die These, dass Einkaufszentren als sakrale Orte verstanden werden können. Er argumentiert, dass die Integration von Kirchenräumen in manche Einkaufszentren, die architektonischen Parallelen zu Kathedralen bei frühen Warenhäusern und der Warenfetischismus mit kultischen Zügen auf eine sakrale Funktion der Einkaufszentren hindeuten. Der rituelle Charakter des Einkaufens und die Bedeutung des Zentrums als Ort sakraler Handlungen werden als weitere Argumente angeführt.
Die Architektur des sakralen Ortes: Dieses Kapitel untersucht die Architektur von Warenhäusern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sowie die Architektur moderner Einkaufszentren, um architektonische Parallelen zu traditionellen Sakralbauten aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf die Gestaltungsmerkmale, die eine „Sakralisierung des Konsums“ bezeugen, und untersucht, wie architektonische Elemente dazu beitragen, eine Atmosphäre von Ehrfurcht, Heiligung und Besonderheit zu schaffen.
Der postmoderne „Konsumtempel“: Dieser Abschnitt charakterisiert das moderne und postmoderne Einkaufszentrum als „Konsumtempel“. Er analysiert die Transformation des Konsums in ein Erlebnis und untersucht die religiösen Züge des modernen Konsums. Die Diskussion beleuchtet, inwieweit der Konsum ein Glaubenssystem darstellt, das die Innerlichkeit säkularisiert und in den Bann des Tauschwerts reißt.
Konsum als Religion?: Dieses Kapitel vertieft die Frage, inwieweit der Konsum religiöse Züge aufweist oder immer schon besessen hat. Es analysiert die Ähnlichkeiten zwischen Konsumverhalten und religiösen Praktiken und hinterfragt die Funktionalität von Einkaufszentren als Orte des Glaubens und der Gemeinschaft. Die Diskussion umfasst die rituellen Aspekte des Einkaufens, den Warenfetischismus und die Bedeutung von Marken als moderne Idole.
Heritage Village als Perfektion des sakralen Ortes: Dieser Abschnitt analysiert Heritage Village als ein extremes Beispiel eines „perfekten sakralen Ortes“, wobei die spezifischen Merkmale und die Ausprägung der sakralen Aspekte dieses Ortes eingehend untersucht und im Kontext der vorherigen Kapitel diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Einkaufszentren, sakraler Ort, Profan, Durkheim, Religion, Ritual, Konsum, Warenfetischismus, Postmoderne, Architektur, Warenhäuser, Heritage Village, Mythos, kollektives Bewusstsein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Sakralisierung des Konsums - Einkaufszentren als moderne Kultstätten
Was ist das zentrale Thema dieser Abhandlung?
Die Abhandlung untersucht die These, dass moderne Einkaufszentren als sakrale Orte betrachtet werden können. Sie analysiert Architektur, soziale Funktionen und rituelle Aspekte von Einkaufszentren, um deren Ähnlichkeiten mit traditionellen sakralen Räumen aufzuzeigen und stützt sich dabei auf soziologische Theorien, insbesondere Durkheims Religionstheorie.
Welche Definitionen werden im Text verwendet?
Der Text definiert „sakraler Ort“ im Vergleich zum „Profanen“ basierend auf Durkheims Religionstheorie. Es wird die strikte Trennung zwischen beiden Sphären und die Bedeutung von Ritualen, Symbolen und kollektivem Bewusstsein für die Sakralität herausgearbeitet. „Mythos“ und „Ritual“ werden ebenfalls definiert, um den Kontext der Analyse zu klären.
Welche Aspekte der Architektur von Einkaufszentren werden untersucht?
Die Abhandlung vergleicht die Architektur von Warenhäusern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit der moderner Einkaufszentren und sucht nach Parallelen zu traditionellen Sakralbauten. Im Fokus stehen Gestaltungsmerkmale, die eine „Sakralisierung des Konsums“ bezeugen und eine Atmosphäre von Ehrfurcht und Besonderheit schaffen.
Wie wird der Konsum im Kontext der Sakralität betrachtet?
Der Konsum wird als modernes Ritual mit religiösen Zügen analysiert. Es wird untersucht, inwieweit der Konsum ein Glaubenssystem darstellt, das die Innerlichkeit säkularisiert und in den Bann des Tauschwerts reißt. Der Warenfetischismus und die Bedeutung von Marken als moderne Idole werden ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielt Heritage Village in der Argumentation?
Heritage Village dient als extremes Beispiel eines „perfekten sakralen Ortes“. Die spezifischen Merkmale und die Ausprägung der sakralen Aspekte dieses Ortes werden eingehend untersucht und im Kontext der vorherigen Kapitel diskutiert, um die These der Sakralisierung des Konsums zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Einkaufszentren, sakraler Ort, Profan, Durkheim, Religion, Ritual, Konsum, Warenfetischismus, Postmoderne, Architektur, Warenhäuser, Heritage Village, Mythos und kollektives Bewusstsein.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Definitionen, dem Einkaufszentrum als sakraler Ort, der Architektur sakraler Orte, dem postmodernen „Konsumtempel“, Konsum als Religion, Heritage Village als perfekter sakraler Ort und Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel fasst seine zentralen Punkte zusammen.
Welche These wird in der Einleitung präsentiert?
Die Einleitung präsentiert die These, dass Einkaufszentren als moderne, sakrale Orte fungieren, indem sie soziale Funktionen übernehmen, die früher Kirchen und staatlichen Institutionen vorbehalten waren. Kowinskis ironische Beschreibung eines Lebens, das komplett in einem Einkaufszentrum ablaufen könnte, veranschaulicht die omnipräsente Rolle dieser Orte in der modernen Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Dominik Jesse (Autor:in), 2004, Einkaufszentren als sakrale Orte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/51129