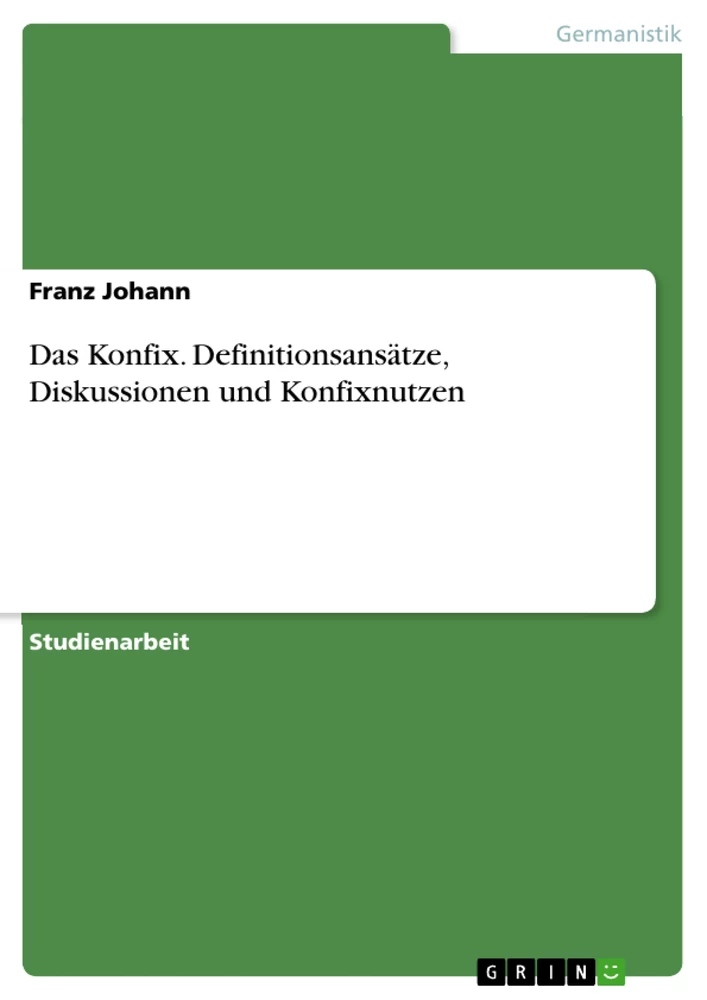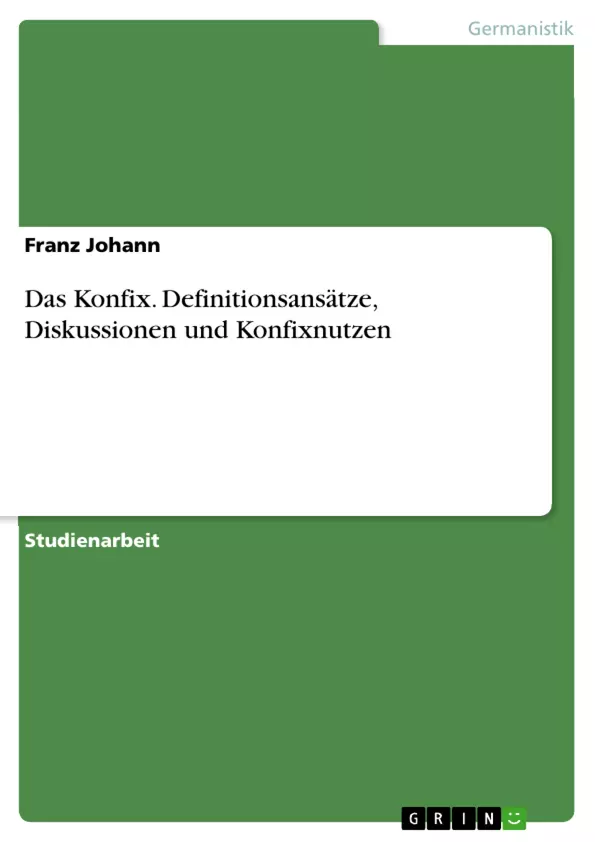2010 wählte die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort Cyberkrieg unter die zehn Wörter des Jahres. Diese Wörter des Jahres sind jedes Mal welche, die auf verschiedene Weise das wirtschaftliche, politische und soziale Leben beeinflusst haben. In den häufigsten Fällen handelt es sich dabei um Wortneuschöpfungen. Ich habe das Wort Cyberkrieg gewählt, da es unter Beweis stellt, wie wichtig Konfixe bei der Wortschatzerweiterung sind.
Krieg ist Stamm des Wortes und kann ebenfalls alleine stehen. [Cyber-] ist ein „exogenes Konfix“ aus dem Englischen und bedeutet so viel wie etwas aus der virtuellen Computerwelt. Die Sprache hat einen hohen Bedarf sich stets in ihrem Vokabular zu vergrößern und der Außenwelt anzupassen. Das Konfix [cyber-] ist erst entstanden, als die virtuelle Computerwelt und ein Bedürfnis Vorgänge und Abläufe in ihr zu benennen entstanden ist. Nach ERBEN besteht immer „die kommunikative Notwendigkeit […], alles, was man kennen lernt oder lehrt, auch nennen zu müssen.“ Es sind aber nicht nur Novitäten, die betitelt werden müssen. In der Wortbildung entstehen auch Synonyme, die ausdrückstärker, zeitgemäßer oder anders konnotiert sind. Wortbildung ist aber nicht die einzige Option das Vokabular einer Sprache zu erweitern. Entlehnung gilt mitunter der Bedeutungsveränderung zu weiteren Mitteln der Wortschatzerweiterung.
Konfixe, die den Wortschatz erweitern, sind überwiegend Gräzismen, Latinismen und Anglizismen. Heimische Konfixe wie zum Beispiel [schwieger-] sind in den meisten Fällen nicht produktiv, es gibt jedoch wenige Ausnahmen (z.B.: [lotter-]).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konfix: Definitionsansätze und Diskussionen
- Allgemeine gegenwärtige Definition
- Entwicklung der Definitionsansätze
- Konfixcharakteristika
- Lexikalische Bedeutung
- Gebundenheit
- Basisfähigkeit
- Kompositionsgliedfähigkeit
- Abgrenzung von Konfixen
- Abgrenzung von Affixen
- Abgrenzung von Wörtern
- Abgrenzung von Affixoiden
- Abgrenzung von unikalen Morphemen
- Abgrenzung von Kürzungen
- Zwischenfazit
- Konfixnutzen
- Sind Konfixe im Sprachgebrauch nötig?
- Warum entstehen Konfixe?
- Kann die Linguistik auf das Konfix verzichten?
- Das Konfix in verschiedenen Wörterbüchern
- WAHRIG Deutsches Wörterbuch
- DUDEN. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache
- Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache
- Wortfamilienwörterbuch der deutschen Gegenwartsprache
- Deutsches Neologismenwörterbuch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das linguistische Phänomen des Konfixes. Ziel ist es, die Definition und Charakteristika des Konfixes zu beleuchten, seine Bedeutung für die Wortbildung zu analysieren und seine Behandlung in verschiedenen Wörterbüchern zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet den Forschungsstand zur Konfixbildung und diskutiert dessen Relevanz für die Sprachwissenschaft.
- Definition und Abgrenzung des Konfixes
- Entwicklung der Definitionsansätze im Laufe der Forschung
- Charakteristika von Konfixen (z.B. Gebundenheit, Basisfähigkeit)
- Der Nutzen und die Entstehung von Konfixen
- Darstellung des Konfixes in verschiedenen Wörterbüchern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie anhand des Wortes „Cyberkrieg“ die Bedeutung von Konfixen für die Wortschatzerweiterung verdeutlicht. Sie hebt die Notwendigkeit der sprachlichen Anpassung an die sich verändernde Welt hervor und benennt die Forschungslücke bezüglich des Konfixes, welche erst in den 1980er Jahren in den Fokus der Sprachwissenschaft gerückt ist. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Forschungsfrage, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden soll.
Konfix: Definitionsansätze und Diskussionen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen des Konfixes und deren Entwicklung. Es beginnt mit einer aktuellen Definition von Donalies und erläutert dann die unterschiedlichen Ansätze in der Forschungsliteratur, angefangen bei Schmidt über Fleischer bis hin zu Plath. Die unterschiedlichen Auffassungen zur Abgrenzung des Konfixes von anderen Einheiten wie Affixen, Wörtern, Affixoiden und Kürzungen werden diskutiert und systematisiert. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der zentralen Charakteristika und der schwierigen Abgrenzung des Konfixes von anderen linguistischen Einheiten.
Konfixnutzen: Dieses Kapitel widmet sich der Frage nach dem Nutzen und der Entstehung von Konfixen. Es diskutiert kritisch, ob Konfixe im Sprachgebrauch notwendig sind, warum sie entstehen, obwohl schon bedeutungsgleiche Wörter existieren und ob die Linguistik auf ihre Beschreibung verzichten könnte. Die Argumentation stützt sich auf die Analyse der Wortbildungsprozesse und der kommunikativen Notwendigkeit, neue Begriffe zu schaffen. Es werden sowohl sprachökonomische als auch semantische Aspekte beleuchtet.
Das Konfix in verschiedenen Wörterbüchern: In diesem Kapitel werden die Einträge zu verschiedenen Konfixen in unterschiedlichen Wörterbüchern (WAHRIG, DUDEN, Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Wortfamilienwörterbuch, Deutsches Neologismenwörterbuch) verglichen und deren Lücken und Unterschiede analysiert. Dies dient der Illustration der weiterhin bestehenden Uneinigkeit über den Konfixbegriff und dessen unterschiedliche Behandlung in der lexikographischen Praxis. Der Vergleich zeigt die Herausforderungen der Beschreibung des Konfixes in Wörterbüchern auf.
Schlüsselwörter
Konfix, Wortbildung, Affixe, Lexikologie, Wortneuschöpfung, Definitionsansatz, Gebundenheit, Basisfähigkeit, Kompositionsgliedfähigkeit, Sprachwandel, Wörterbücher, Linguistik
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Konfixe in der deutschen Sprache"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem linguistischen Phänomen der Konfixe in der deutschen Sprache. Sie untersucht Definition, Charakteristika, Nutzen, Entstehung und die Darstellung von Konfixen in verschiedenen Wörterbüchern.
Was sind Konfixe?
Konfixe sind gebundene Morpheme, die eine lexikalische Bedeutung besitzen, aber im Gegensatz zu Affixen nicht selbstständig als Wörter auftreten können. Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionsansätze und die Abgrenzung von Konfixen zu Affixen, Wörtern, Affixoiden und Kürzungen.
Welche Charakteristika haben Konfixe?
Die Arbeit beschreibt zentrale Charakteristika von Konfixen, darunter ihre lexikalische Bedeutung, ihre Gebundenheit, ihre Basisfähigkeit und ihre Kompositionsgliedfähigkeit. Diese Eigenschaften werden im Detail erläutert und anhand von Beispielen illustriert.
Warum sind Konfixe wichtig für die Sprachwissenschaft?
Konfixe spielen eine wichtige Rolle in der Wortbildung und der Wortschatzerweiterung. Die Arbeit untersucht den Nutzen von Konfixen und die Frage, ob die Linguistik auf ihre Beschreibung verzichten könnte. Es werden sprachökonomische und semantische Aspekte beleuchtet.
Wie werden Konfixe in Wörterbüchern dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Behandlung von Konfixen in verschiedenen bekannten deutschen Wörterbüchern (WAHRIG, DUDEN, Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Wortfamilienwörterbuch, Deutsches Neologismenwörterbuch). Der Vergleich zeigt Unterschiede und Lücken in der lexikographischen Praxis auf.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Definitionsansätzen und Diskussionen um Konfixe, ein Kapitel zum Nutzen von Konfixen, ein Kapitel zum Auftreten von Konfixen in verschiedenen Wörterbüchern und ein Fazit. Jedes Kapitel fasst seine Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konfix, Wortbildung, Affixe, Lexikologie, Wortneuschöpfung, Definitionsansatz, Gebundenheit, Basisfähigkeit, Kompositionsgliedfähigkeit, Sprachwandel, Wörterbücher, Linguistik.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit untersucht die Definition und Charakteristika des Konfixes, analysiert seine Bedeutung für die Wortbildung und vergleicht seine Behandlung in verschiedenen Wörterbüchern. Sie beleuchtet den Forschungsstand und diskutiert die Relevanz des Konfixbegriffs für die Sprachwissenschaft.
Wie wird die Bedeutung der Konfixe verdeutlicht?
Die Bedeutung der Konfixe wird anhand des Beispiels "Cyberkrieg" in der Einleitung veranschaulicht, um die Rolle von Konfixen bei der Wortschatzerweiterung und Anpassung an den Sprachwandel zu zeigen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Ergebnisse und Diskussionen jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfasst.
- Arbeit zitieren
- Franz Johann (Autor:in), 2018, Das Konfix. Definitionsansätze, Diskussionen und Konfixnutzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/509840