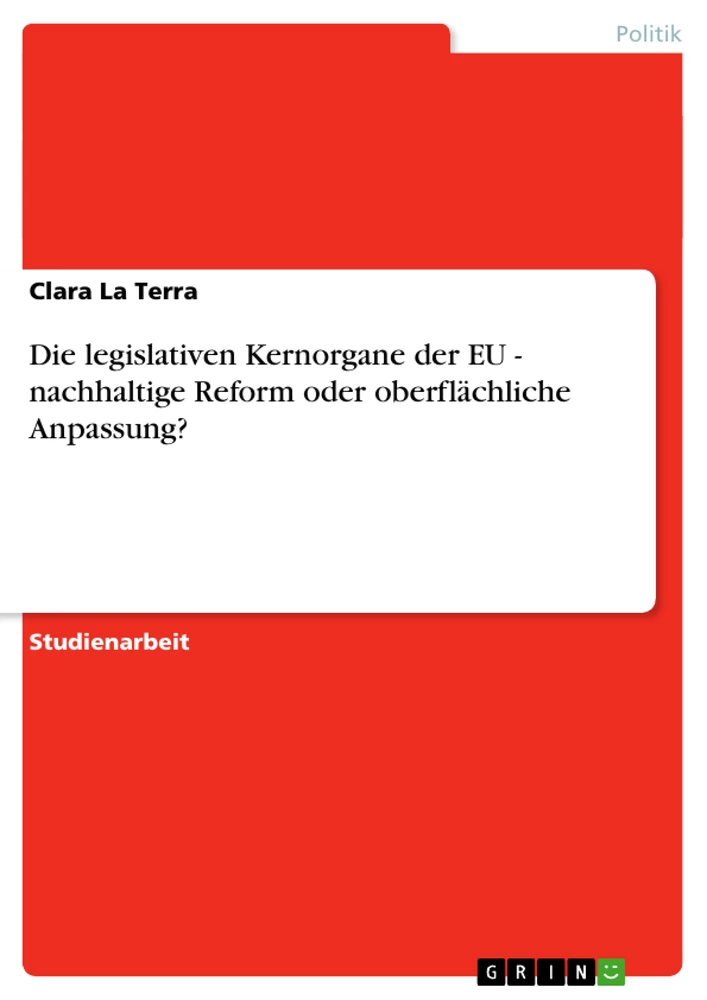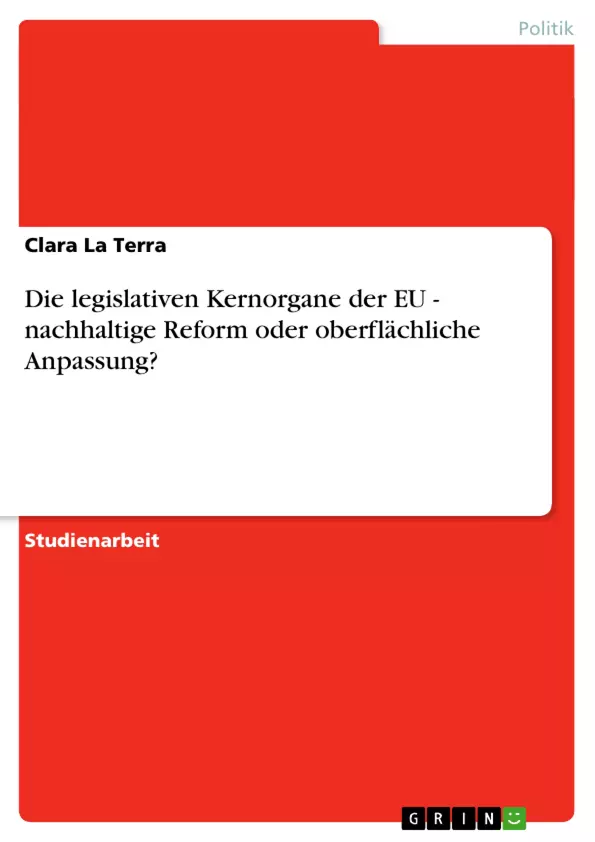Die institutionellen Reformen der Europäischen Union stellen schon seit den Anfängen des europäischen Integrationsprozesses ein Dauerthema in den wissenschaftlichen Debatten dar. Seit dem Vertrag von Maastricht wurde die Europäische Union mit ihren Institutionen als ein immer mehr technokratisches und bürgerfernes Gebilde angesehen. Die einzelnen Vertragsveränderungen haben jedes Mal zu einer Zunahme der Instrumente geführt, darüber hinaus vermischten sich politische Zuständigkeiten immer mehr zwischen den EU-Organen als auch zwischen der nationalen und europäischen Ebene. Der komplexe und oft diffuse Prozess des politischen Macht- und Entscheidungsgefüges war besonders für die Bürger schwierig zu verstehen und ließ auch keine eindeutige Zuweisung von politischer Verantwortung zu.
Spätestens seit der Entscheidung die Europäische Union erneut beträchtlich zu erweitern, sind die institutionellen Reformen zu einer äußersten Notwendigkeit der europäischen Integration geworden. Die Institutionen und Entscheidungsverfahren eigneten sich wenig für ein Europa von 25 und mehr Mitgliedstaaten, weil sie seit ihrer Schaffung in 1951 und 1957 nicht wesentlich geändert worden sind. Trotz der allgemein anerkannten Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Europäischen Union war es auf den Regierungskonferenzen von Amsterdam und Nizza nicht gelungen, wesentliche Fortschritte zu erzielen. Zuletzt scheiterten alle umfassenden Reformschritte in Nizza und der unterzeichnete Vertrag vermochte es nicht, die institutionellen Kernprobleme besonders im Lichte der großen Erweiterung zu lösen.
In einem erweiterten Europa könnte die Folge der verpassten Chancen von Nizza eine unwirksame Gestaltung supranationaler Politik bedeuten und somit ein Bedeutungsverlust der Institutionen selbst. Angesichts dieser Ausgangslage galt es im Vertrag über eine Verfassung für Europa die Transparenz zu verbessern, die Effizienz und Effektivität der Organe der Europäischen Union zu stärken sowie die demokratische Legitimation euro-päischer Politik zu erhöhen.
Diese Arbeit versucht einen Einblick in die Ergebnisse der Reformen zu vermitteln. Dabei sollen die Regeln des Europäischen Verfassungsvertrags auf ihre Auswirkungen für das institutionelle Dreieck der Union, Europäisches Parlament (EP), Ministerrat (MR) und Kommission (EK), untersucht werden, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob diese Änderungen einer nachhaltigen Reform oder nur einer oberflächlichen Anpassung entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
- IEinleitung
- 1. Das Mandat von Nizza und Laeken
- 2. Die Reform der Kernorgane
- 2.1 Das Europäische Parlament
- 2.1.1 Bestimmungen zu Größe und Zusammensetzung
- 2.1.2 Die Befugnisse des Europäischen Parlaments
- 2.2 Der Ministerrat
- 2.2.1 Bestimmungen zu Struktur und Arbeitsweise
- 2.2.2. Die Beschlussfassung im Ministerrat
- 2.3 Die Europäische Kommission
- 2.3.1 Bestimmungen zu Größe und Zusammensetzung
- 2.3.2 Die Wahl des Kommissionspräsidenten und seine Rolle
- 2.3.3 Die Kernfunktionen der Kommission
- 3. Der „,,Sprung nach vorn“ – die bessere Lösung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den institutionellen Reformen der Europäischen Union im Kontext des Vertrags über eine Verfassung für Europa. Ziel ist es, die Auswirkungen der neuen Regeln auf das institutionelle Dreieck der EU - Europäisches Parlament, Ministerrat und Kommission - zu analysieren, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob diese Änderungen einer nachhaltigen Reform oder nur einer oberflächlichen Anpassung entsprechen.
- Analyse der institutionellen Reformen im Vertrags über eine Verfassung für Europa
- Bewertung der Auswirkungen der Reformen auf das institutionelle Dreieck der EU
- Untersuchung der Frage nach einer nachhaltigen Reform oder nur einer oberflächlichen Anpassung
- Beurteilung der Rolle von Nizza und Laeken im Reformprozess
- Diskussion verschiedener möglicher Reformansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel eins beleuchtet das Mandat von Nizza und Laeken als Ausgangspunkt der Reformen. Dabei wird der Fokus auf die Hintergründe des Reformprozesses gelegt und die Notwendigkeit der Anpassung der EU-Institutionen an die Herausforderungen der Erweiterung erläutert. Kapitel zwei untersucht die Kernorgane der EU im Detail, analysiert die Veränderungen des Verfassungsvertrags und bewertet deren Auswirkungen auf die jeweiligen Organe. In Kapitel drei werden verschiedene Reformansätze aus der Verfassungsdebatte vorgestellt und diskutiert, um die Auswirkungen der Reformen auf die Funktionsfähigkeit und die demokratische Legitimität der EU zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Institutionelle Reformen, Europäische Union, Verfassungsvertrag, Europäisches Parlament, Ministerrat, Kommission, Nizza, Laeken, Erweiterung, demokratische Legitimität, Handlungsfähigkeit, Transparenz, Effizienz.
- Arbeit zitieren
- Clara La Terra (Autor:in), 2005, Die legislativen Kernorgane der EU - nachhaltige Reform oder oberflächliche Anpassung?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50904