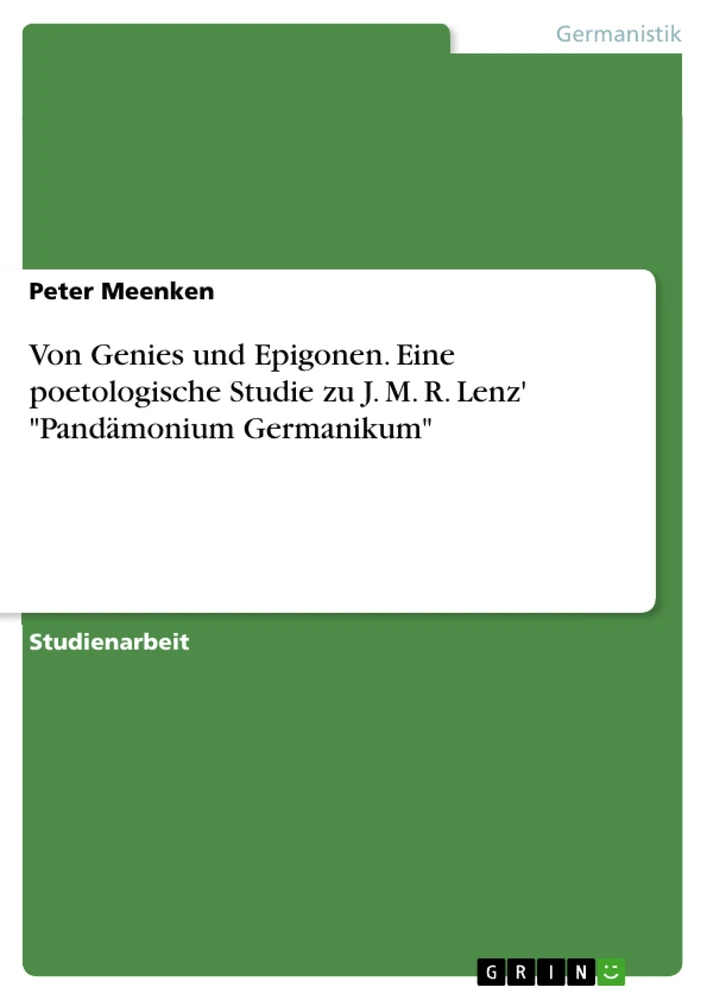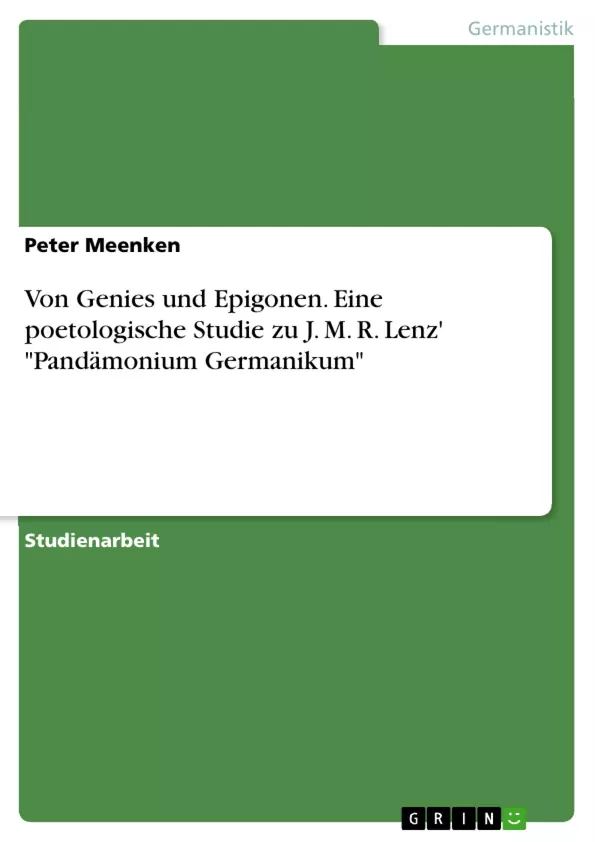Folgende Hausarbeit widmet sich einem von Jakob Michael Reinhold Lenz‘ Dramen, welchem in der Forschungsliteratur in Relation zu seinen anderen Werken weniger Beachtung zuteilwurde. Die Rede ist vom "Pandämonium Germanikum". Hierbei handelt es sich um ein Werk, welches viele zeitgenössische Literaten Lenz‘ als Figuren auftreten lässt.
In der Art und Weise wie sie auftreten, ihren Sprechakten und den Kommentaren und Bewertungen anderer Figuren werden im Laufe des Werks Wertungen vorgenommen, welche aufgrund des realen Äquivalents der Figuren poetologische Aussagen über die Literatur und Schriftsteller treffen. Eben diese so verarbeitete Poetologie fungiert auch als Fragestellung dieser Arbeit, es gilt aufzuzeigen, welche poetologischen Topoi im "Pandämonium Germanikum" verarbeitet werden und welche Literaturbewertungen des Autors sich so rekonstruieren lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wichtige Voranmerkungen
- Die Poetologie, eine Arbeitsdefinition
- Handlung und dramatis personae
- Zur formalen Gestaltung des Werks
- Gattungs- und Genreverortung
- Poetologische Topoi
- Topos I: Die Genieästhetik des Sturm und Drang
- Die Genieästhetik im Pandämonium Germanikum
- Topos II: Emanzipation vom französischen Klassizismus
- Travestie als poetologisches Verfahren
- Der geistesgeschichtliche Diskurs als poetologische Grundlage
- Resümee
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Primärtexte
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Jakob Michael Reinhold Lenz' Drama „Pandämonium Germanikum“ und untersucht die darin enthaltenen poetologischen Aussagen. Ziel der Arbeit ist es, die im Drama verarbeiteten Topoi zu identifizieren und die Literaturbewertungen des Autors zu rekonstruieren. Die Arbeit verfolgt einen teleologischen Ansatz, wobei zunächst grundlegende Charakteristika des Werks beleuchtet werden.
- Die Poetologie als Analysekriterium
- Die Rolle des Geniebegriffs in der Literatur des Sturm und Drang
- Die Kritik am französischen Klassizismus
- Die Bedeutung von Travestie als literarisches Verfahren
- Der geistesgeschichtliche Kontext der Poetologie des Pandämonium Germanikum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das „Pandämonium Germanikum“ als ein Werk vor, das in der Literaturforschung weniger Aufmerksamkeit erfahren hat als andere Werke Lenz'. Das Drama wird als ein Werk beschrieben, in dem zeitgenössische Literaten als Figuren auftreten und durch ihre Sprechakte und die Kommentare anderer Figuren poetologische Aussagen über Literatur und Schriftsteller getroffen werden.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Poetologie als Analysekriterium. Die Poetologie wird als „Dichtungstheorie“ definiert, die sowohl „normative praktische Anweisungen“ als auch „Dichtungskritik“ umfasst. Im Rahmen der Arbeit soll herauskristallisiert werden, welche Kriterien für angemessene Literatur im „Pandämonium Germanikum“ gelten und welche Werke bzw. Literaten positive oder negative Bewertungen erfahren.
Die Kapitel über Handlung und dramatis personae sowie die formale Gestaltung des Werks beleuchten wichtige Charakteristika des „Pandämonium Germanikum“. Es wird die Handlung des Dramas kurz skizziert, die dramatis personae vorgestellt und die fragmentierte Struktur des Werks analysiert. Die Kapitel beleuchten bereits einige poetologische Topoi, die im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Poetologie, Sturm und Drang, Genieästhetik, französischer Klassizismus, Travestie, geistesgeschichtlicher Diskurs, Pandämonium Germanikum, Jakob Michael Reinhold Lenz, Literaturbewertung.
- Arbeit zitieren
- Peter Meenken (Autor:in), 2017, Von Genies und Epigonen. Eine poetologische Studie zu J. M. R. Lenz' "Pandämonium Germanikum", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/508899