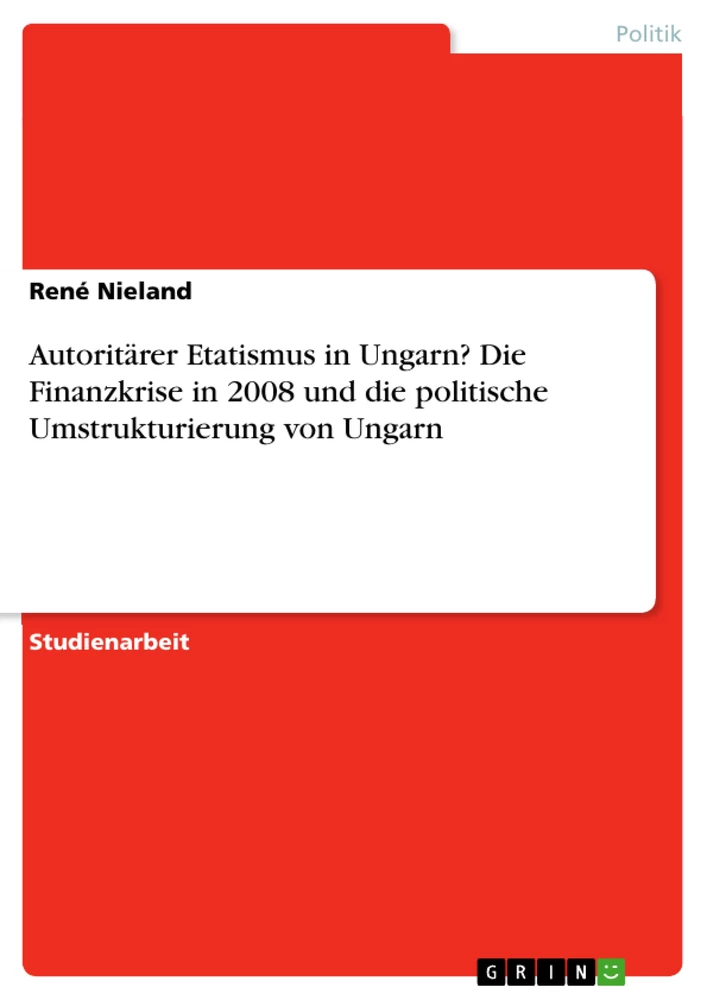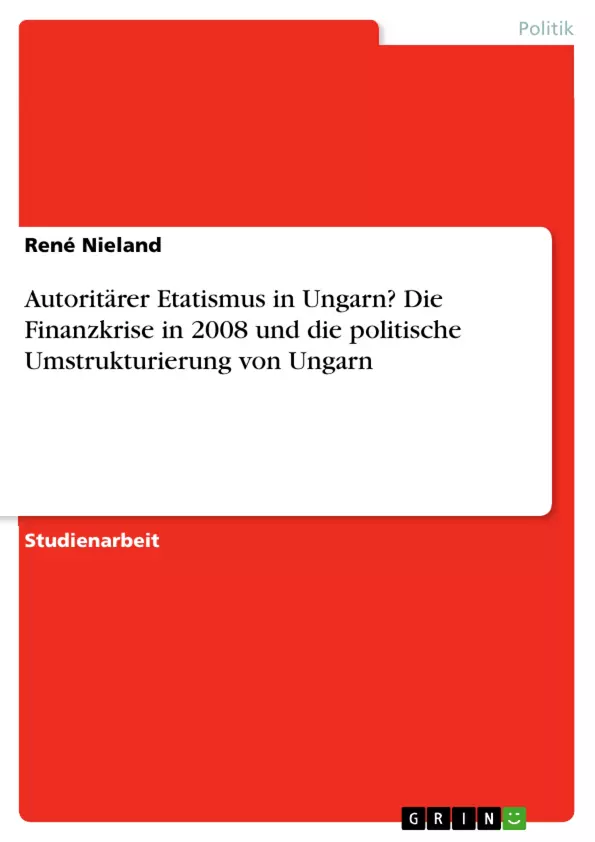In dieser Arbeit versucht der Autor anhand von Nicos Poulantzas‘ Konzept des Autoritären Etatismus (AE) zu untersuchen, inwiefern Ungarn unter Orbán das politische System so verändert hat, dass von einem Wandel in den AE gesprochen werden kann. Deutlich wurde, dass es diverse Momente im ungarischen System gibt, bei denen es sich scheinbar von der Demokratie des Europäischen Typs entfernt. Die Wirtschaftsweise per se jedoch, die sich durch den eingebetteten Neoliberalismus auszeichnet, blieb nahezu unverändert. Auch wenn Korruption und Demokratiekontroversen ("Illiberaler Staat") unter der Fidesz-Regierung zunahmen, blieb das Wirtschaften und die de facto Abhängigkeit von der EU und von den geschmiedeten Netzwerken fast unberührt.
Die Forschungsfrage der Arbeit lautet: "Inwiefern trug die Finanzkrise ab 2009 zur politischen Umstrukturierung Ungarns bei und können wir von einem autoritären Etatismus in der EU sprechen?"
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Zugang
- Methodologischer Zugang
- Institutionelle Umstrukturierung und die Veränderung des politischen Systems
- Ökonomische Veränderungen im System Orbán
- Veränderungen unter Orbán im sozialen Bereich
- Das Schaffen einer ungarischen Identität
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss der Finanzkrise ab 2009 auf die politische Umstrukturierung Ungarns und die Frage, ob von einem autoritären Etatismus in der EU gesprochen werden kann. Die Arbeit stützt sich auf die Staatstheorie von Nicos Poulantzas und analysiert die institutionellen, ökonomischen und sozialen Veränderungen unter der Regierung Viktor Orbáns.
- Der Einfluss der Finanzkrise auf Ungarn
- Institutionelle Veränderungen unter Orbán
- Ökonomische Entwicklungen und Auswirkungen auf die politische Stabilität
- Soziale Veränderungen und die Rolle des Staates
- Das Konzept des autoritären Etatismus im Kontext Ungarns
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Finanzkrise ab 2009 auf die politische Umstrukturierung Ungarns und der Frage nach einem autoritären Etatismus in der EU. Sie verweist auf die vorherige positive Wahrnehmung Ungarns als Musterschüler der Transformation und kontrastiert dies mit den wirtschaftlichen Einbußen während der Krise. Die hohen Schulden Ungarns gegenüber ausländischen Gläubigern werden als ein wichtiger Aspekt für die politische Sicherheit des Landes hervorgehoben. Der Begriff des autoritären Etatismus nach Poulantzas wird eingeführt, und die Bedeutung von Identität und kollektiven Narrativen wird angesprochen.
Theoretischer Zugang: Dieses Kapitel erläutert das Konzept des autoritären Etatismus nach Nicos Poulantzas. Es beschreibt vier zentrale Krisenpunkte, die zu einem autoritären Etatismus führen können: Brüche im Machtblock, Politisierung peripherer Politikfelder, Einfluss ausländischen Kapitals und die Übernahme von Funktionen, die zuvor von unkontrollierten ökonomischen Kräften erfüllt wurden. Poulantzas' Aussage, dass autoritärer Etatismus nicht nur eine Antwort auf eine Krise, sondern auch eine mitverursachte Krise darstellt, wird hervorgehoben.
Methodologischer Zugang: (Annahme: Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Arbeit. Da der Text keine Details liefert, wird eine generische Zusammenfassung erstellt.) Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit. Es wird voraussichtlich die verwendeten Forschungsmethoden, Datengrundlage und die analytischen Ansätze erläutern, die zur Beantwortung der Forschungsfrage eingesetzt wurden. Die gewählte Methodik wird im Detail dargestellt und begründet.
Institutionelle Umstrukturierung und die Veränderung des politischen Systems: (Annahme: Kapitel 4 beschreibt institutionelle Veränderungen. Da der Text keine Details liefert, wird eine generische Zusammenfassung erstellt.) Dieses Kapitel analysiert die institutionellen Veränderungen in Ungarn unter der Regierung Orbán. Es wird voraussichtlich auf die Veränderungen der Machtstrukturen, der Gesetzgebung und der staatlichen Institutionen eingehen und diese im Kontext des autoritären Etatismus interpretieren. Die Analyse wird wahrscheinlich zeigen, wie diese Veränderungen die politische Landschaft Ungarns geprägt und möglicherweise die demokratischen Prozesse beeinflusst haben.
Ökonomische Veränderungen im System Orbán: (Annahme: Kapitel 5 beschreibt ökonomische Veränderungen. Da der Text keine Details liefert, wird eine generische Zusammenfassung erstellt.) Dieses Kapitel befasst sich mit den ökonomischen Veränderungen unter der Führung Orbáns. Es wird wahrscheinlich die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung, ihre Auswirkungen auf die ungarische Wirtschaft und den Einfluss auf die politische Stabilität analysieren. Der Zusammenhang zwischen den ökonomischen Entwicklungen und dem Konzept des autoritären Etatismus wird hier vermutlich untersucht.
Veränderungen unter Orbán im sozialen Bereich: (Annahme: Kapitel 6 beschreibt soziale Veränderungen. Da der Text keine Details liefert, wird eine generische Zusammenfassung erstellt.) Dieses Kapitel konzentriert sich auf die sozialen Veränderungen in Ungarn unter Orbán. Es wird wahrscheinlich die Auswirkungen der Regierungspolitik auf verschiedene soziale Gruppen analysieren und den Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen und die soziale Gerechtigkeit untersuchen. Der Zusammenhang zwischen diesen sozialen Entwicklungen und dem politischen System wird wahrscheinlich herausgearbeitet.
Das Schaffen einer ungarischen Identität: (Annahme: Kapitel 7 beschreibt die Konstruktion einer nationalen Identität. Da der Text keine Details liefert, wird eine generische Zusammenfassung erstellt.) Dieses Kapitel analysiert die von der Regierung Orbán geförderte Konstruktion einer ungarischen Identität. Es wird voraussichtlich auf die Rolle von Nationalismus, Geschichtspolitik und Medien in diesem Prozess eingehen und die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Kohäsion und den Umgang mit Minderheiten untersuchen. Die Analyse wird wahrscheinlich die Strategien der Regierung beleuchten, um eine spezifische nationale Identität zu formen und deren Funktion im Kontext des autoritären Etatismus bewerten.
Schlüsselwörter
Autoritärer Etatismus, Finanzkrise 2008, Ungarn, Viktor Orbán, politische Umstrukturierung, ökonomische Veränderungen, soziale Veränderungen, nationale Identität, Visegrád-Staaten, Poulantzas.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Autoritärer Etatismus in Ungarn unter Viktor Orbán
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss der Finanzkrise ab 2009 auf die politische Umstrukturierung Ungarns unter Viktor Orbán und die Frage, ob von einem autoritären Etatismus im Sinne von Nicos Poulantzas gesprochen werden kann. Sie analysiert institutionelle, ökonomische und soziale Veränderungen in Ungarn.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Staatstheorie von Nicos Poulantzas und seinem Konzept des autoritären Etatismus. Poulantzas' vier Krisenpunkte (Brüche im Machtblock, Politisierung peripherer Politikfelder, Einfluss ausländischen Kapitals und Übernahme von Funktionen zuvor unkontrollierter ökonomischer Kräfte) werden zur Analyse herangezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss der Finanzkrise auf Ungarn, institutionelle Veränderungen unter Orbán, ökonomische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die politische Stabilität, soziale Veränderungen und die Rolle des Staates, sowie das Konzept des autoritären Etatismus im Kontext Ungarns.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Zugang (Poulantzas), ein methodologisches Kapitel, Kapitel zur institutionellen Umstrukturierung, zu ökonomischen Veränderungen, zu sozialen Veränderungen unter Orbán, ein Kapitel zum Schaffen einer ungarischen Identität und eine Conclusio.
Wie wird die Methodik beschrieben?
Das methodologische Kapitel beschreibt die verwendeten Forschungsmethoden, die Datengrundlage und die analytischen Ansätze zur Beantwortung der Forschungsfrage. Die gewählte Methodik wird detailliert dargestellt und begründet. Leider liefert der Text keine konkreten Details zur Methodik.
Was wird in den einzelnen Kapiteln analysiert?
Die einzelnen Kapitel analysieren jeweils einen Aspekt der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in Ungarn unter Orbán: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen vor. Die weiteren Kapitel untersuchen die institutionellen, ökonomischen und sozialen Veränderungen sowie die Konstruktion einer ungarischen Identität im Kontext des autoritären Etatismus.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Autoritärer Etatismus, Finanzkrise 2008, Ungarn, Viktor Orbán, politische Umstrukturierung, ökonomische Veränderungen, soziale Veränderungen, nationale Identität, Visegrád-Staaten, Poulantzas.
Welche Schlussfolgerung wird angestrebt?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einfluss der Finanzkrise auf die politische Umstrukturierung Ungarns zu untersuchen und die Frage zu beantworten, ob von einem autoritären Etatismus in Ungarn gesprochen werden kann. Die Conclusio fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen daraus.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, der Text bietet eine Zusammenfassung der Einleitung und des Kapitels zum theoretischen Zugang. Für die restlichen Kapitel werden generische Zusammenfassungen angeboten, da der Text keine detaillierten Informationen liefert.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und dient der Analyse der Thematik im Rahmen einer Seminararbeit.
- Arbeit zitieren
- René Nieland (Autor:in), 2019, Autoritärer Etatismus in Ungarn? Die Finanzkrise in 2008 und die politische Umstrukturierung von Ungarn, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/507566