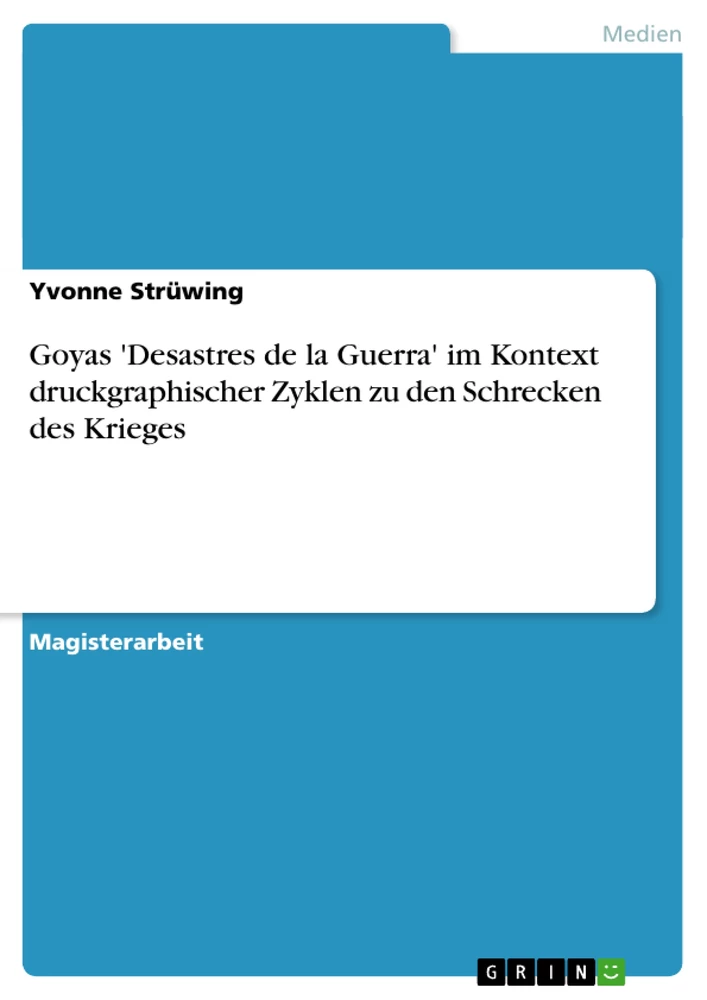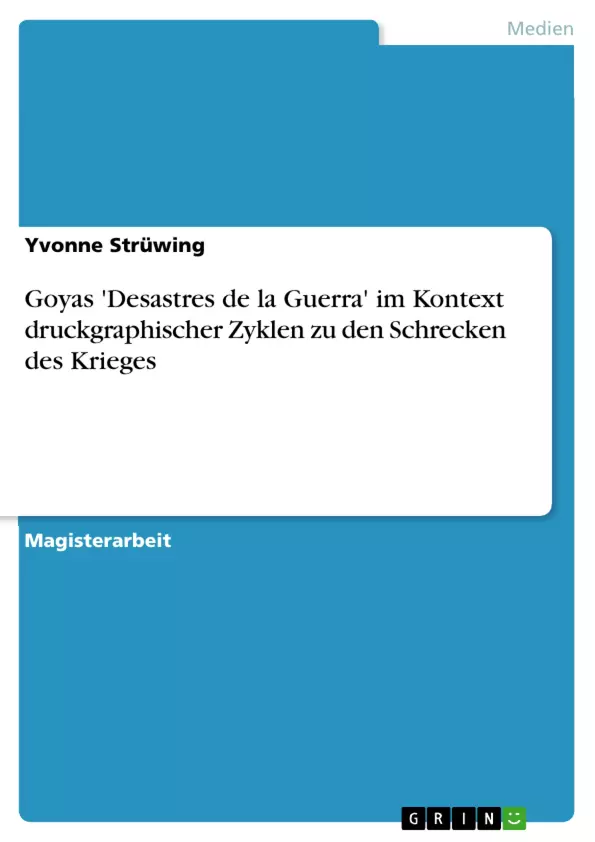1 Einleitung
No hay remedio. Diese Aussage untertitelt eine Szene der Desastres de la Guerra von Francisco de Goya. Sie drückt sie aus, was Krieg nimmt: alles. Krieg ist ein Zustand, der alles Positive in der Welt negiert, ein Zustand, der nahezu kompletten Destruktion. Es gibt keinen Halt, keinen Trost und keine Hoffnung mehr. Danach ist nichts mehr so, wie es einmal war: die, die überlebt haben, sind nicht nur physisch gebrandmarkt, sondern tragen auch tiefe Wunden in sich. Man versteht nicht, was Menschen sich gegenseitig im kriegerischen Wahnsinn antun können, wie der Mensch zu einer gefühlskalten Mordmaschine mutieren kann. Wo Worte versagen, Krieg zu beschreiben, bedarf es der Kunst.
Wie kann diese Grausamkeit dargestellt werden? Welche Motive hat der Krieg; kann man sie verallgemeinern, oder muss man sie als unterschiedliche zeittypische Umgänge mit Krieg klar differenzieren? Was kann und soll dem Betrachter vermittelt werden? Macht sich nicht jeder Künstler mit der Darstellung des Krieges schuldig, die Sensationslust des Betrachters zu wecken und auszunutzen? Ist es Künstlern gelungen, diesem Vorwurf zu entgehen? Bezieht der Künstler Stellung; ergreift er Partei; prangert er an?
Goya hat mit seinem Zyklus Desastres de la Guerra die Kriegsdarstellung revolutioniert. Er gibt in seiner Kunst neue Antworten auf die aufgeworfenen Fragen und schafft es insbesondere durch die Konzentration auf einzelne grausame Szenen, dass der Betrachter sich dem Schrecken aussetzen muss. Goyas Desastres sind ein Wendepunkt der Kriegsdarstellung und gelten als „das bedeutendste Mahnmal der bildenden Kunst gegen den Krieg“(1) , das sich durch Goyas spezifische Formensprache auszeichnet, die dem Betrachter schonungslos die Greuel des Krieges darbietet. In dem Buch Das Leiden anderer betrachten(2) behauptet Susan Sontag, dass es Goya gelingt, sich dem Vorwurf des Voyeurismus zu entziehen.
Die vorliegende Magisterarbeit stellt diesen Zyklus in einen epochenübergreifenden Kontext. Dies ist in diesem Umfang in der Kunsthistorik bisher noch nicht unternommen worden. Indem weitere druckgraphische Zyklen miteinbezogen werden, wird untersucht, ob Goyas Desastres tatsächlich einzigartig sind und ob sie die erste schonungslose Anklage gegen den Krieg sind.
[...]
______
(1) Biedermann 1984, S. 12.
(2) Sontag 2003, S. 9 ff.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Quellenbericht und kritischer Literaturüberblick
- 3 Entwicklung der druckgraphischen Kriegszyklen
- 4 Goyas Desastres de la Guerra
- 4.1 Goya, der Spanische Bürgerkrieg und die Restauration der spanischen Monarchie
- 4.1.1 Die spanische Monarchie und Napoleon - ein historischer Abriss
- 4.1.2 Goya als Zeuge des spanischen Unabhängigkeitskrieges und der Restauration
- 4.2 Allgemeine Angaben zu den Desastres de la Guerra
- 4.2.1 Datierung, Provenienz, Titel, Auflagen, Aufbewahrungsorte
- 4.2.2 Thematische Unterteilung der Desastres de la Guerra
- 4.2.3 Stellung der Desastres de la Guerra in Goyas druckgraphischem Œuvre
- 4.2.4 Stil der Desastres de la Guerra
- 4.3 Bildbeschreibungen
- 4.3.1 Schrecken des Krieges
- 4.3.2 Allegorische Szenen
- 4.3.3 Folgen des Krieges
- 4.4 Goyas Stellungnahme in den Desastres de la Guerra
- 4.5 Zusammenfassung
- 4.1 Goya, der Spanische Bürgerkrieg und die Restauration der spanischen Monarchie
- 5 Vorreiter aus dem 17. Jahrhundert
- 5.1 Jacques Callot
- 5.1.1 Callot und der Dreißigjährige Krieg: Frankreich und Lothringen um 1630
- 5.1.2 Les Misères et les Malheures de la Guerre im Vergleich mit den Desastres de la Guerra
- 5.1.3 Callot und Goya: vergleichende Bildbetrachtungen
- 5.1.4 Zusammenfassung
- 5.2 Hans Ulrich Franck
- 5.2.1 Franck und der Dreißigjährige Krieg: Augsburg 1635-1648
- 5.2.2 Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges im Vergleich mit den Misères et les Malheures de la Guerre und den Desastres de la Guerra
- 5.2.3 Franck und Goya: vergleichende Bildbetrachtungen
- 5.2.4 Zusammenfassung
- 5.1 Jacques Callot
- 6 Nachfolger aus dem 20. Jahrhundert
- 6.1 Otto Dix
- 6.1.1 Yo lo vi - Ich habe es gesehen: Dix und der Erste Weltkrieg
- 6.1.2 Der Krieg im Vergleich mit den Desastres de la Guerra
- 6.1.3 Dix und Goya: vergleichende Bildbetrachtungen
- 6.1.4 Zusammenfassung
- 6.2 Pablo Picasso
- 6.2.1 Picasso und der Spanische Bürgerkrieg
- 6.2.2 Sueño y mentira de Franco im Vergleich mit den Desastres de la Guerra
- 6.2.3 Picasso und Goya: Bildbetrachtungen
- 6.2.4 Zusammenfassung
- 6.1 Otto Dix
- 7 Ausblick: Die Brüder Jake und Dinos Chapman und Goya
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Goyas "Desastres de la Guerra" im Kontext anderer druckgraphischer Kriegszyklen. Das Hauptziel ist die Einordnung von Goyas Werk in die Geschichte der Kriegsdarstellung und die Analyse seiner Einzigartigkeit. Die Arbeit prüft, ob Goyas Zyklus tatsächlich eine einzigartige und schonungslose Anklage gegen den Krieg darstellt und untersucht den Einfluss anderer Künstler und den Einfluss Goyas auf nachfolgende Künstler.
- Die Entwicklung der druckgraphischen Darstellung des Krieges
- Der Vergleich von Goyas "Desastres de la Guerra" mit Werken anderer Künstler
- Die Frage nach Goyas Stellungnahme und der Überwindung des Voyeurismus in der Kriegsdarstellung
- Der Einfluss von Goyas Werk auf spätere Künstler
- Die Analyse der Bildsprache und der Motive in Goyas "Desastres de la Guerra"
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kriegsdarstellung in der Kunst ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Einzigartigkeit von Goyas "Desastres de la Guerra". Sie hebt die Bedeutung des Werkes als Mahnmal gegen den Krieg hervor und skizziert den Ansatz der Arbeit, der den Zyklus in einen epochenübergreifenden Kontext stellt, um dessen Innovation und Einfluss zu analysieren. Die Einleitung benennt die zu vergleichenden Künstler und skizziert die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit.
3 Entwicklung der druckgraphischen Kriegszyklen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung der druckgraphischen Kriegszyklen, die als historischer Kontext für Goyas Werk dient. Es beleuchtet die Veränderungen in der Darstellung von Krieg und Gewalt über die Jahrhunderte und legt die Grundlage für die anschließende detaillierte Analyse der "Desastres de la Guerra".
4 Goyas Desastres de la Guerra: Dieses Kapitel analysiert Goyas "Desastres de la Guerra" umfassend. Es beleuchtet den historischen Kontext des spanischen Unabhängigkeitskrieges und Goyas Rolle als Zeitzeuge. Die Analyse umfasst die Datierung, die thematische Struktur, den Stil und die Bildsprache des Zyklus. Es wird auf die einzelnen Bildmotive eingegangen und Goyas Stellungnahme zum Krieg diskutiert. Das Kapitel analysiert die Wirkung der Bilder auf den Betrachter und die Frage des Voyeurismus.
5 Vorreiter aus dem 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die Werke von Jacques Callot ("Les Misères et les Malheures de la Guerre") und Hans Ulrich Franck ("Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges") als Vorläufer von Goyas "Desastres de la Guerra". Der Vergleich konzentriert sich auf stilistische und thematische Gemeinsamkeiten und Unterschiede und untersucht, inwiefern diese Künstler den Weg für Goyas innovative Kriegsdarstellung ebneten.
6 Nachfolger aus dem 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel widmet sich den Kriegsdarstellungen von Otto Dix ("Der Krieg") und Pablo Picasso ("Sueño y mentira de Franco") als Nachfolgewerken zu Goyas "Desastres de la Guerra". Es untersucht, wie diese Künstler Goyas Erbe aufgreifen und weiterentwickeln, sowie wie sie selbst mit dem Thema Krieg umgehen und welche Einflüsse sie aufweisen.
Schlüsselwörter
Goya, Desastres de la Guerra, Kriegsdarstellung, Druckgraphik, Jacques Callot, Hans Ulrich Franck, Otto Dix, Pablo Picasso, Spanischer Unabhängigkeitskrieg, Dreißigjähriger Krieg, Erster Weltkrieg, Spanischer Bürgerkrieg, Voyeurismus, Realismus, Bildanalyse, Vergleichende Kunstgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Goyas Desastres de la Guerra und vergleichende Kriegszyklen"
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Diese Magisterarbeit analysiert Goyas "Desastres de la Guerra" im Kontext anderer druckgraphischer Kriegszyklen. Sie untersucht die Einzigartigkeit von Goyas Werk, seine Stellung in der Geschichte der Kriegsdarstellung und seinen Einfluss auf nachfolgende Künstler.
Welche Künstler werden neben Goya untersucht?
Neben Goya werden Jacques Callot (17. Jahrhundert), Hans Ulrich Franck (17. Jahrhundert), Otto Dix (20. Jahrhundert) und Pablo Picasso (20. Jahrhundert) untersucht. Die Arbeit vergleicht deren Darstellungen des Krieges mit Goyas Werk.
Welche Kriege werden in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit behandelt den Spanischen Unabhängigkeitskrieg (im Zusammenhang mit Goyas Werk), den Dreißigjährigen Krieg (Callot und Franck), den Ersten Weltkrieg (Dix) und den Spanischen Bürgerkrieg (Picasso).
Welche Aspekte von Goyas "Desastres de la Guerra" werden analysiert?
Die Analyse umfasst den historischen Kontext, die Datierung, die thematische Struktur, den Stil, die Bildsprache, die einzelnen Bildmotive und Goyas Stellungnahme zum Krieg. Die Arbeit befasst sich auch mit der Wirkung der Bilder auf den Betrachter und der Frage des Voyeurismus.
Wie werden die ausgewählten Künstler mit Goya verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf stilistische und thematische Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Arbeit untersucht, inwiefern die ausgewählten Künstler den Weg für Goyas innovative Kriegsdarstellung ebneten (im Falle von Callot und Franck) oder Goyas Erbe aufgriffen und weiterentwickelten (im Falle von Dix und Picasso).
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende kunstgeschichtliche Methode. Sie setzt Goyas Werk in einen epochenübergreifenden Kontext, um dessen Innovation und Einfluss zu analysieren.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Goyas Zyklus tatsächlich eine einzigartige und schonungslose Anklage gegen den Krieg darstellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der druckgraphischen Darstellung des Krieges, den Vergleich von Goyas "Desastres de la Guerra" mit Werken anderer Künstler, Goyas Stellungnahme und die Überwindung des Voyeurismus in der Kriegsdarstellung, den Einfluss von Goyas Werk auf spätere Künstler und die Analyse der Bildsprache und der Motive in Goyas "Desastres de la Guerra".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Quellenbericht und Literaturüberblick, der Entwicklung druckgraphischer Kriegszyklen, Goyas Desastres de la Guerra (einschließlich detaillierter Bildanalysen), Vorreitern aus dem 17. Jahrhundert (Callot und Franck), Nachfolgern aus dem 20. Jahrhundert (Dix und Picasso) und einem Ausblick auf die Brüder Chapman im Kontext Goyas.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Goya, Desastres de la Guerra, Kriegsdarstellung, Druckgraphik, Jacques Callot, Hans Ulrich Franck, Otto Dix, Pablo Picasso, Spanischer Unabhängigkeitskrieg, Dreißigjähriger Krieg, Erster Weltkrieg, Spanischer Bürgerkrieg, Voyeurismus, Realismus, Bildanalyse, Vergleichende Kunstgeschichte.
- Quote paper
- Yvonne Strüwing (Author), 2005, Goyas 'Desastres de la Guerra' im Kontext druckgraphischer Zyklen zu den Schrecken des Krieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/50348