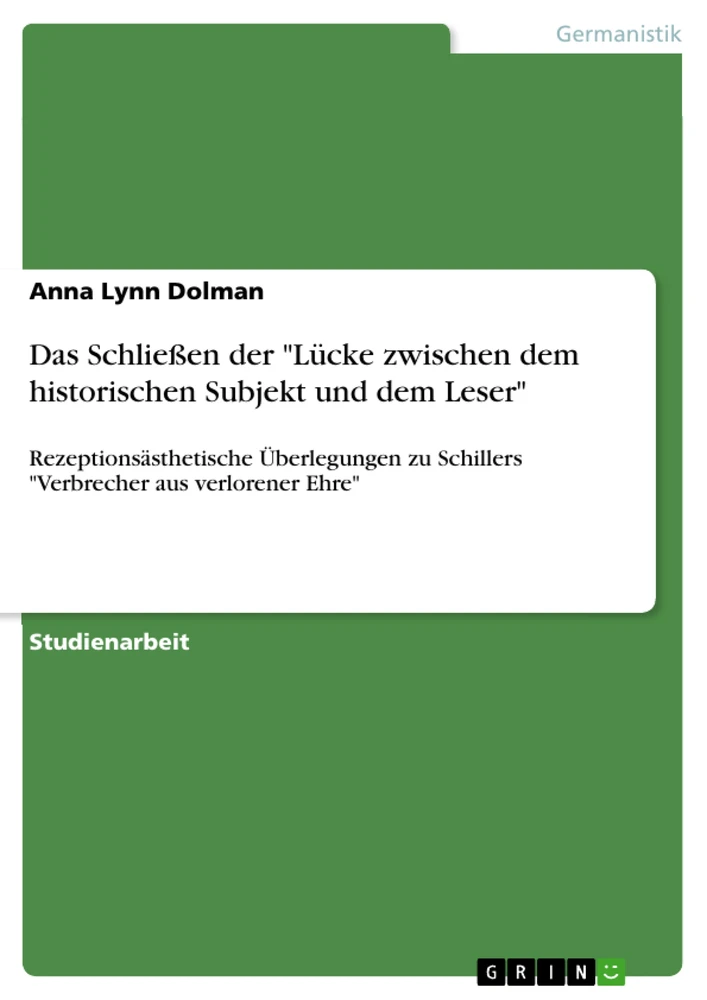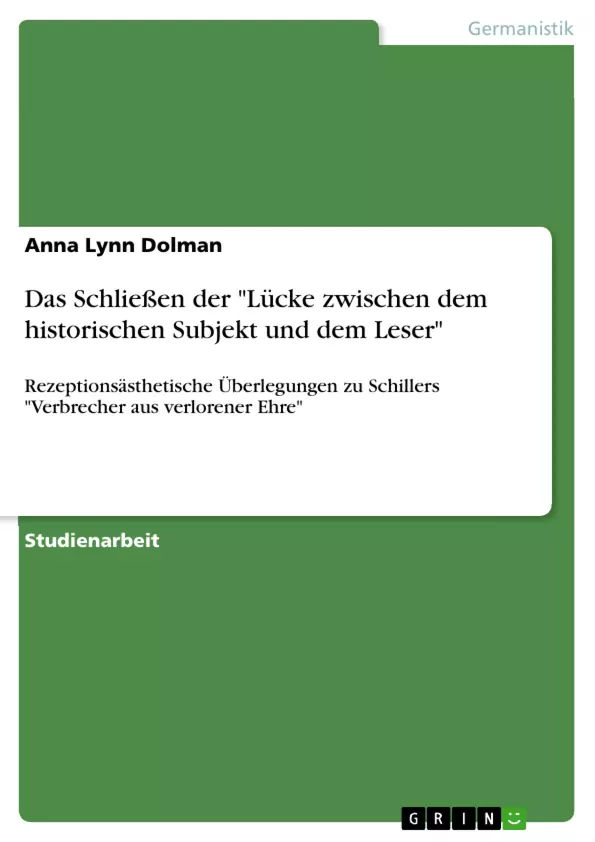Obgleich Friedrich Schillers Prosawerken gemeinhin ein deutlich geringeres Forschungsinteresse zukommt als seinen theoretischen Schriften, so hat sich die neuere deutsche Literaturwissenschaft ausgiebig mit seiner heute unter dem Titel Der Verbrecher aus verlorener Ehre bekannten aufklärerischen Kriminalerzählung, die 1786 anonym in der von Schiller selbst herausgegebenen Zeitschrift Thalia als Verbrecher aus Infamie veröffentlicht wurde, auseinandergesetzt. Die Forschungsliteratur scheint dabei stets um die Analyseschwerpunkte Rezeptionsästhetik, Gattungshistorie, sozialgeschichtliche Studien sowie geistes- und rechtsgeschichtliche Einordnungen zu kreisen, wobei jedoch anzumerken ist, dass zwischen diesen Ansätzen vielfache Interdependenzen bestehen und isolierte Betrachtungen wohl nur schwerlich möglich sind. Eine umfassende rezeptionsästhetische Analyse, wie sie im Folgenden vorgenommen werden soll, wird daher zweifelsohne davon profitieren, eine Vielzahl ebendieser Aspekte in ihre Argumentation miteinzubeziehen und deren Zusammenspiel aufzuzeigen, wenn es herauszustellen gilt, mit welchen Mitteln der Publikumsbezug in der programmatischen Vorrede, die sich aus rezeptionsästhetischer Perspektive wohl als am aufschlussreichsten erweist, hergestellt und im Laufe der Erzählung aufrechterhalten und sogar amplifiziert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Schillers Rhetorik und Narratologie
- 1. Zwischen Fakten und Fiktion: neutraler Geschichtsschreiber oder Rhetorik-affiner Poet?
- 2. Episches Programm und narratologische Elemente: „Engagiertes Erzählen”
- II. Der Blick in die Gemütsverfassung des Beklagten”.
- 1. Die menschliche Doppelnatur: „Laster und Tugend in einer Wiege”
- 2. Identitätskonstitution und Mitleidserregung qua Isolation
- 3. Der Sonnenwirt als Falsifikation der Physiognomik
- 4.,,Gewissensangst\" als Initiator der Entscheidung für die Sittlichkeit
- III. Justiz- und Gesellschaftskritik als Mitleidsevokation
- 1.,,Ja, übers Leben noch geht die Ehr!“: Implikationen des Ehrverlusts
- 2. Schutz- und Vaterlosigkeit: „Lassen Sie Gnade für Recht ergehen, mein Fürst“
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ untersucht die Interaktion zwischen historischem Subjekt und Leser innerhalb der Kriminalerzählung. Der Text strebt danach, die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion zu erforschen und die Rolle des Autors in der Gestaltung des Leserbezugs zu beleuchten. Durch eine rezeptionsästhetische Analyse wird aufgezeigt, wie Schiller die Lesererfahrung mit narratologischen und rhetorischen Mitteln steuert.
- Rezeptionsästhetik und Lesererfahrung in der Kriminalerzählung
- Die Rolle des Autors in der Gestaltung des Leserbezugs
- Schillers Rhetorik und ihre Wirkung auf die Leserrezeption
- Mitleidserregung und die Konstruktion der Figur des Verbrechers
- Justiz- und Gesellschaftskritik in der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ in den Kontext der Forschung und beleuchtet die Relevanz des Werks für die Rezeptionsästhetik. Der Text beleuchtet die Bedeutung der Vorrede als Schlüsselfaktor für den Leserbezug und untersucht die Spannung zwischen faktischer Wahrheit und künstlerischer Gestaltung.
Kapitel I analysiert Schillers Rhetorik und Narratologie im Hinblick auf die Konstruktion der Leserrolle. Es wird diskutiert, inwieweit Schiller seine Leser durch rhetorische Mittel in eine bestimmte Richtung lenkt und die Freiheit des Lesers beeinflusst. Die Spannung zwischen neutralem Geschichtsschreiber und rhetorisch-affinem Dichter wird beleuchtet.
Kapitel II betrachtet die psychologische Gestaltung des Protagonisten und die Evokation von Mitleid beim Leser. Der Text analysiert die menschliche Doppelnatur, die Isolation des Verbrechers und die Rolle des Mitleids in der Identifikationsbildung. Die Beziehung zwischen dem Verbrecher und dem Leser wird im Hinblick auf die Bedeutung des Mitleids analysiert.
Kapitel III untersucht die Bedeutung von Justiz- und Gesellschaftskritik im Kontext der Mitleidserregung. Der Text beleuchtet die Auswirkungen des Ehrverlusts und die Kritik an der Rechtsprechung sowie an den sozialen Bedingungen der Zeit.
Schlüsselwörter
Schiller, „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, Rezeptionsästhetik, Narratologie, Rhetorik, Leserbezug, Mitleidserregung, Justiz- und Gesellschaftskritik, Kriminalerzählung, faktische Wahrheit, künstlerische Gestaltung, menschliche Doppelnatur, Identifikationsbildung, Empathie.
- Arbeit zitieren
- Anna Lynn Dolman (Autor:in), 2019, Das Schließen der "Lücke zwischen dem historischen Subjekt und dem Leser", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/503351