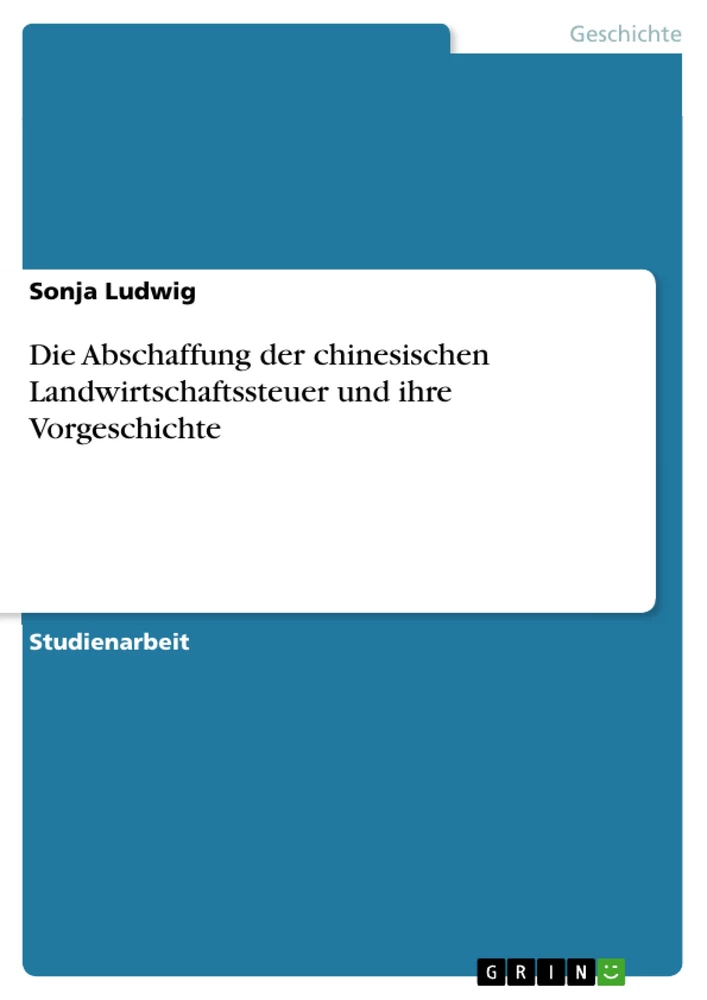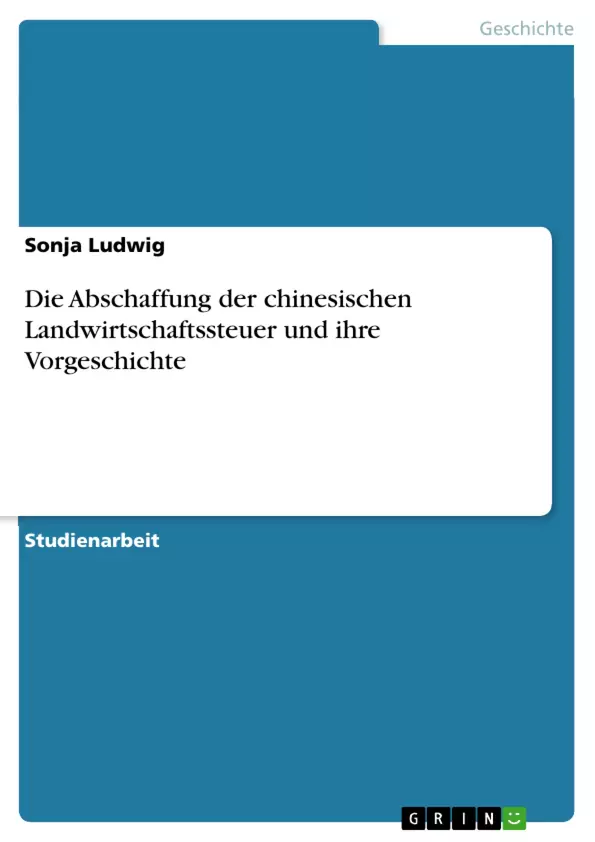Im Januar 2003 kündigte erstmals öffentlich die kommunistische Zentralregierung unter Staatspräsident Hu Jintao und Premierminister Wen Jiabao die Abschaffung der chinesischen Landwirtschaftssteuer an. Innerhalb von fünf Jahren sollte dadurch die finanzielle Last der Bauern gemindert werden.
Um dieses komplexe Thema näher behandeln zu können, werde ich zunächst die historische Entwicklung landwirtschaftlicher Abgaben und die Probleme der landwirtschaftlichen Bevölkerung Chinas vor allem in der Neuzeit erläutern.
Desweiteren werde ich auf eine der wichtigsten Reformen eingehen: der „Tax-for-Fee“ Reform. Dies soll einen guten Überblick über die Lage geben, die letztendlich zu der Abschaffung der chinesischen Landwirtschaftssteuer führte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die historische Entwicklung landwirtschaftlicher Abgaben
- Von der Kopfsteuer zur Grundsteuer
- Die Lage der Bauern zur Kaiserzeit
- Die Entwicklung der Landwirtschaft in der Neuzeit
- Die Lage der Bauern
- Der Beginn neuer Reformen
- Die erste Phase der großen Steuerreformen
- Die „Tax-for-Fee“ Reform
- Die Folgen
- Die Abschaffung der chinesischen Landwirtschaftssteuer
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Abschaffung der chinesischen Landwirtschaftssteuer im Jahr 2003, einschließlich ihrer Vorgeschichte. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der landwirtschaftlichen Abgaben in China zu beleuchten und die Probleme der landwirtschaftlichen Bevölkerung, die zu dieser Reform führten, aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung landwirtschaftlicher Abgaben in China
- Die Lage der Bauern in der Kaiserzeit und in der Neuzeit
- Die „Tax-for-Fee“ Reform als ein wichtiger Schritt zur Abschaffung der Landwirtschaftssteuer
- Die Abschaffung der chinesischen Landwirtschaftssteuer als ein wichtiger Meilenstein in der chinesischen Entwicklung
- Die Auswirkungen der Steuerreform auf die chinesische Landwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Abschaffung der chinesischen Landwirtschaftssteuer im Jahr 2003 als zentralen Gegenstand der Arbeit vor und erklärt den Fokus auf die historische Entwicklung landwirtschaftlicher Abgaben.
- Die historische Entwicklung landwirtschaftlicher Abgaben: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge des Agrarsteuersystems in China und die Entwicklung von der Kopfsteuer zur Grundsteuer. Es beschreibt die Lage der Bauern zur Kaiserzeit und die Herausforderungen, die durch hohe Steuern und Naturkatastrophen entstanden.
- Die Entwicklung der Landwirtschaft in der Neuzeit: Dieses Kapitel untersucht die Lage der Bauern in der Neuzeit und die Einführung neuer Reformen, die auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bauern zielten.
- Die erste Phase der großen Steuerreformen: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die „Tax-for-Fee“ Reform und ihre Folgen für die landwirtschaftliche Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Chinesische Landwirtschaftssteuer, landwirtschaftliche Abgaben, Bauern, Kaiserzeit, Neuzeit, „Tax-for-Fee“ Reform, Reformen, Entwicklung der Landwirtschaft, China
- Arbeit zitieren
- Sonja Ludwig (Autor:in), 2011, Die Abschaffung der chinesischen Landwirtschaftssteuer und ihre Vorgeschichte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/498558