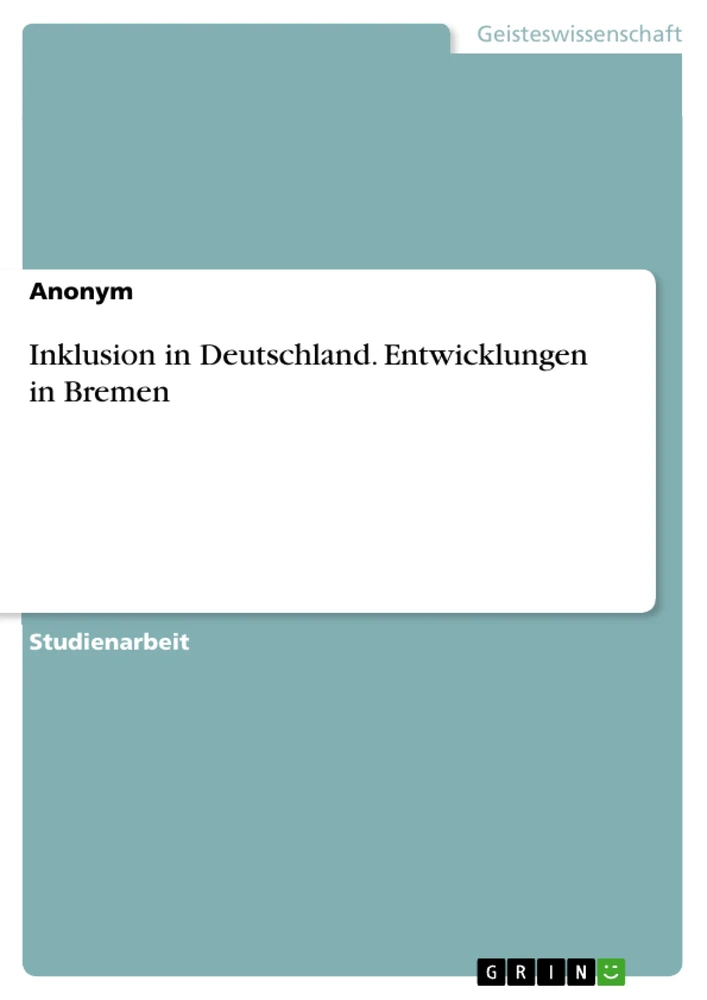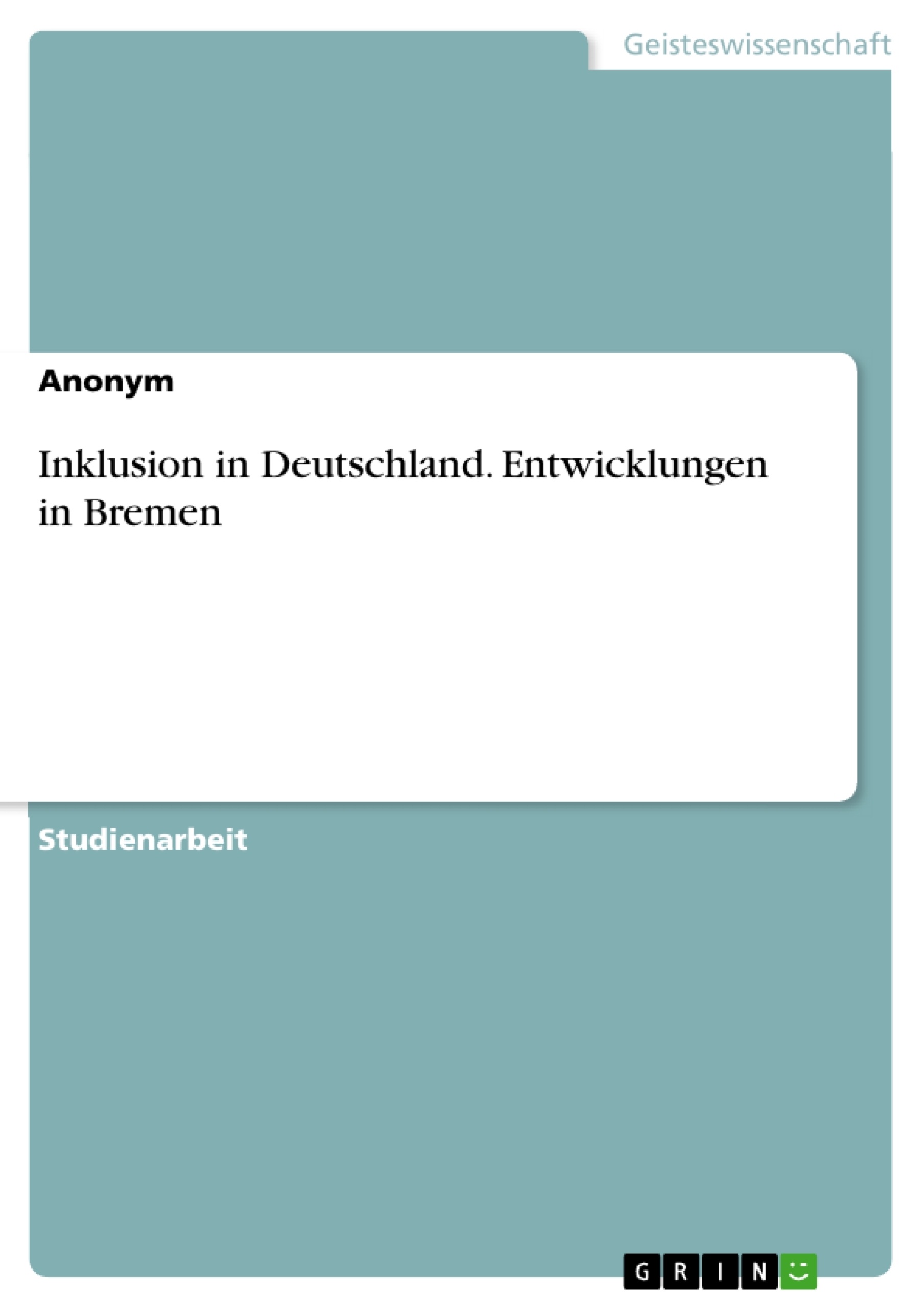Die folgende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob seit dem Inkrafttreten der Forderungen der UN-Konvention tatsächlich versucht wird, diese Barrieren zu beseitigen und inwieweit ein inklusives Schulmodell, wie es in der Konvention verlangt wird, bereits in Deutschland umgesetzt wird. Dabei sollen die beiden Begriffe "Inklusion" und "Integration" kritisch beleuchtet werden, da sie in Bezug auf die Schulpolitik doch des Öfteren in einen gemeinsamen Topf geworfen werden. Auf dieser Differenzierung aufbauend soll dann in einer makrostrukturellen Untersuchung die Entwicklung von Inklusion in Deutschland im Allgemeinen illustriert werden und daraufhin anhand eines länderspezifischen Beispiels, das sich aus der vorherigen Untersuchung besonders hervorhebt, mikrostrukturelle Faktoren für ein erfolgreiches Inklusionsmodell aufgezeigt werden. Dabei gilt zu beachten, inwieweit Inklusion und Integration einhergehen und inwieweit sie sich von einander abgrenzen.
In einer sich immer weiter entwickelnden Gesellschaft, die mehr und mehr darauf abzielt, tolerant und politisch korrekt zu handeln, stößt man immer öfter auf den Begriff der Inklusion. Seit dem Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von Behinderten in Deutschland wird vorausgesetzt, dass behinderte Menschen in Schule und Gesellschaft inkludiert werden sollen und nicht mehr nur integriert. Die Konvention verlangt, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen auf Bildung haben sollen wie Menschen ohne Behinderungen. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit sich diese Forderung als realistisch in ihrer Umsetzung erweist. Gemäß Artikel 1 der UN-Konvention gilt ein Mensch als behindert, wenn er körperlich, geistig oder seelisch langfristig durch verschiedene Barrieren in seinem Handeln eingeschränkt ist. Deshalb wird verlangt, diese Barrieren aus dem Weg zu räumen, sodass alle Menschen möglichst frei in ihrem Handeln sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Inklusion
- Voraussetzungen für ein funktionierendes Inklusionsmodell
- Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen
- Entwicklung auf Bundesebene
- Entwicklung auf Landesebene
- Inklusion anhand des Beispiels Bremen
- Paradebeispiel OSK
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Inklusion in Deutschland, insbesondere im Kontext der Schulpolitik. Sie untersucht, ob die Forderungen der UN-Konvention über die Rechte von Behinderten, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Schule und Gesellschaft fordern, in Deutschland tatsächlich umgesetzt werden. Dabei werden die Begriffe „Inklusion“ und „Integration“ kritisch beleuchtet und die Entwicklung von Inklusion in Deutschland sowohl auf makrostruktureller als auch mikrostruktureller Ebene untersucht.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Inklusion“ und „Integration“
- Voraussetzungen für ein funktionierendes Inklusionsmodell in der Schule
- Entwicklung von Inklusion in Deutschland auf Bundes- und Landesebene
- Mikrostrukturelle Faktoren für ein erfolgreiches Inklusionsmodell am Beispiel Bremen
- Analyse des Paradebeispiels OSK
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Begriff der Inklusion in den Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und erläutert die Bedeutung der UN-Konvention über die Rechte von Behinderten für die Schulpolitik in Deutschland. Sie stellt die Fragestellung der Arbeit und den methodischen Ansatz vor.
- Definition Inklusion: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Inklusion“ und grenzt ihn von „Integration“ ab. Es wird auf die unterschiedlichen Bedeutungen der beiden Begriffe und die Anforderungen der UN-Konvention eingegangen.
- Voraussetzungen für ein funktionierendes Inklusionsmodell: Dieses Kapitel behandelt die notwendigen Rahmenbedingungen für ein inklusives Schulmodell. Es analysiert die Herausforderungen, die sich durch die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen ergeben, und stellt die verschiedenen Maßnahmen vor, die erforderlich sind, um eine erfolgreiche Inklusion zu gewährleisten.
- Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf an allgemeinen Schulen auf Bundes- und Landesebene. Es zeigt die Herausforderungen und Chancen auf, die sich aus der Inklusion ergeben, und analysiert die verschiedenen Ansätze, die in den Bundesländern verfolgt werden.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, UN-Konvention über die Rechte von Behinderten, Schulpolitik, Sonderpädagogik, Förderbedarf, inklusive Schulmodelle, Barrierefreiheit, gemeinsames Lernen, Leistungsspannen, gesellschaftliche Entwicklungen, inklusive Gesellschaft, inklusive Bildung, Paradebeispiel Bremen, OSK
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Inklusion in Deutschland. Entwicklungen in Bremen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/497713