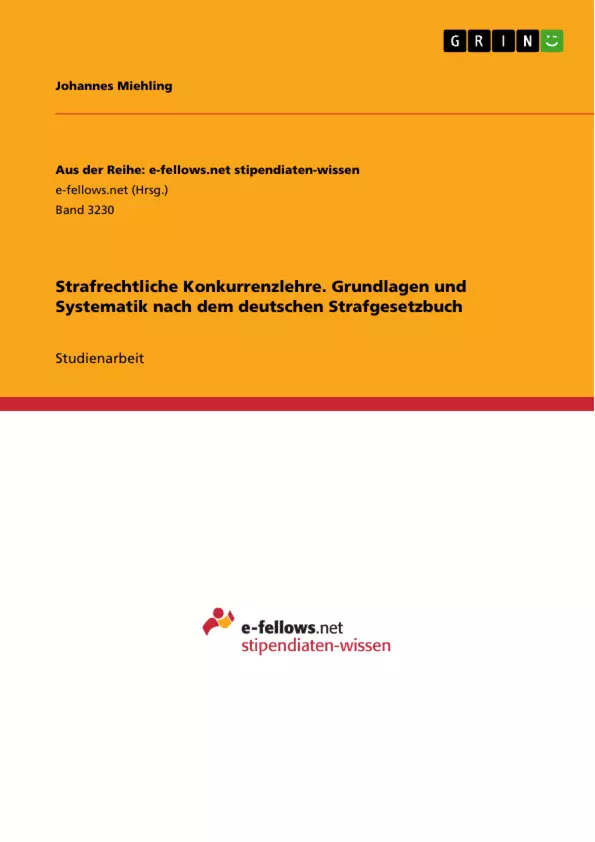Thema dieser Arbeit ist sowohl der Sinn und die praktische Relevanz der Konkurrenzen, als auch die Struktur der Konkurrenzen nach dem StGB.
Die Lehre von den Konkurrenzen gilt wegen der beinahe unüberschaubaren Zahl kontroverser Lehrmeinungen, einer erheblich divergierenden Terminologie und einer nicht immer konsequenten Rechtspraxis als eines der umstrittensten und komplexesten Institute des gesamten Strafrechts.
Dies ist umso misslicher, als eine Konkurrenz einerseits den absoluten Regelfall darstellt und andererseits von größter Bedeutung für die Rechtsfolgen strafbaren Verhaltens ist. Um die bestehende Rechtsunsicherheit in den Griff zu bekommen, bedarf es neben einer rein systematischen Erschließung auch einer Rückbesinnung auf die Grundüberlegungen, denn die Konkurrenzfrage ist nicht selten mehr eine wertende, als eine rein logische.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einordnung
- B. Sinn und praktische Relevanz der Konkurrenzen
- I. Anwendungsfall
- II. Mögliches Vorgehen
- 1. Kumulation
- a) Kritik
- b) Exkurs: Weitere Mechanismen gegen unverhältnismäßig hohe Strafen
- (1) Höchststrafen
- (2) Grundrechte
- 2. Asperation
- 3. Absorption
- 4. Verdrängung
- III. Bedeutung der Konkurrenzen
- 1. Anklagesatz, Belehrung und Urteilsformel
- 2. Materieller Tatbegriff
- 3. Prozessualer Tatbegriff
- C. Struktur der Konkurrenzen nach dem StGB
- I. Rechtsgrundlagen
- II. Handlungseinheit oder Handlungsmehrheit
- 1. Die natürliche Handlung
- 2. Rechtliche Handlungseinheit
- a) Mehraktige und zusammengesetzte Delikte
- b) Dauerdelikte
- c) Teilidentische Ausführungshandlungen
- d) Klammerwirkung „dritter“ Delikte
- (1) Grundkonstrukt
- (2) Restriktion
- 3. Natürliche Handlungseinheit
- a) Verklammerung zu einer Gesetzesverletzung
- (1) Iterative Tatbestandsverwirklichung
- (2) Sukzessive Tatbestandsverwirklichung
- (3) Unterschiedliche Geschädigte
- b) Verklammerung zu einer Handlungseinheit
- (1) Problemaufriss
- (2) Kritik
- 4. Unterlassen und Fahrlässigkeit
- III. Gesetzeskonkurrenz
- 1. Bei Handlungseinheit
- a) Spezialität
- b) Subsidiarität
- c) Konsumtion
- 2. Bei Handlungsmehrheit
- 3. Rechtsfolgen der Gesetzeskonkurrenz
- IV. Konkurrenzbildung und Rechtsfolgen
- 1. Tateinheit
- a) Eingeschränkte Absorption
- b) Klarstellungsfunktion
- 2. Tatmehrheit
- a) Asperation
- b) Tenorierung und Differenzierungsprinzip
- V. Bedeutung verdrängter Tatbestände
- 1. Aufleben
- 2. Sperrwirkung milderer Gesetze
- 3. Anknüpfungspunkt
- 4. Strafzumessung
- Die Einordnung der Konkurrenzen in das Strafrecht
- Die Bedeutung der Konkurrenzen für die Strafbarkeit
- Die Unterscheidung zwischen Handlungseinheit und Handlungsmehrheit
- Die verschiedenen Arten von Konkurrenzen: Tateinheit, Tatmehrheit und Gesetzeskonkurrenz
- Die Rechtsfolgen der verschiedenen Konkurrenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Konkurrenzlehre im Strafrecht. Das Ziel ist es, die verschiedenen Arten von Konkurrenzen im Strafgesetzbuch (StGB) zu erläutern und deren Bedeutung für die Strafbarkeit zu verdeutlichen. Es soll ein umfassendes Verständnis der komplexen Rechtsmaterie vermittelt werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die Einordnung der Konkurrenzen in das Strafrecht. Es werden die unterschiedlichen Ansätze zur Definition des Begriffs der Konkurrenz im Strafrecht dargestellt. Der Sinn und die praktische Relevanz der Konkurrenzen werden aufgezeigt, indem verschiedene Anwendungsfälle beleuchtet werden.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Konzept der Handlungseinheit und Handlungsmehrheit. Es wird erläutert, wann mehrere Delikte als eine Handlungseinheit anzusehen sind und wann mehrere Delikte als Handlungsmehrheit gelten. Hierbei werden verschiedene Deliktsformen wie mehraktige und zusammengesetzte Delikte, Dauerdelikte und Teilidentische Ausführungshandlungen beleuchtet. Die Klammerwirkung „dritter“ Delikte wird ebenfalls erörtert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Gesetzeskonkurrenz. Hierbei geht es um die Frage, wie sich mehrere Delikte zueinander verhalten, wenn sie verschiedene Straftatbestände erfüllen. Die verschiedenen Formen der Gesetzeskonkurrenz, wie Spezialität, Subsidiarität und Konsumtion, werden analysiert.
Schlüsselwörter
Strafrecht, Konkurrenzlehre, Handlungseinheit, Handlungsmehrheit, Gesetzeskonkurrenz, Tateinheit, Tatmehrheit, Absorption, Asperation, Spezialität, Subsidiarität, Konsumtion, Strafbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt die Konkurrenzlehre im Strafrecht?
Sie regelt, wie verfahren wird, wenn ein Täter durch eine oder mehrere Handlungen mehrere Straftatbestände gleichzeitig erfüllt.
Was ist der Unterschied zwischen Tateinheit und Tatmehrheit?
Tateinheit (§ 52 StGB) liegt vor, wenn eine Handlung mehrere Gesetze verletzt. Tatmehrheit (§ 53 StGB) liegt vor, wenn mehrere Handlungen mehrere Straftaten bilden.
Was bedeutet „Gesetzeskonkurrenz“?
Hierbei verdrängt ein Gesetz das andere (z. B. durch Spezialität oder Konsumtion), sodass der Täter am Ende nur nach einem Tatbestand bestraft wird.
Was versteht man unter „Klammerwirkung“?
Ein drittes Delikt kann zwei eigentlich getrennte Taten zu einer rechtlichen Handlungseinheit „verklammern“, wenn es mit beiden Taten gleichzeitig begangen wird.
Welche Rechtsfolgen haben Konkurrenzen für das Urteil?
Sie bestimmen die Strafzumessung (z. B. Asperationsprinzip bei Tatmehrheit) und wie die Taten in der Urteilsformel (Tenor) bezeichnet werden.
- Arbeit zitieren
- Johannes Miehling (Autor:in), 2019, Strafrechtliche Konkurrenzlehre. Grundlagen und Systematik nach dem deutschen Strafgesetzbuch, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/497499