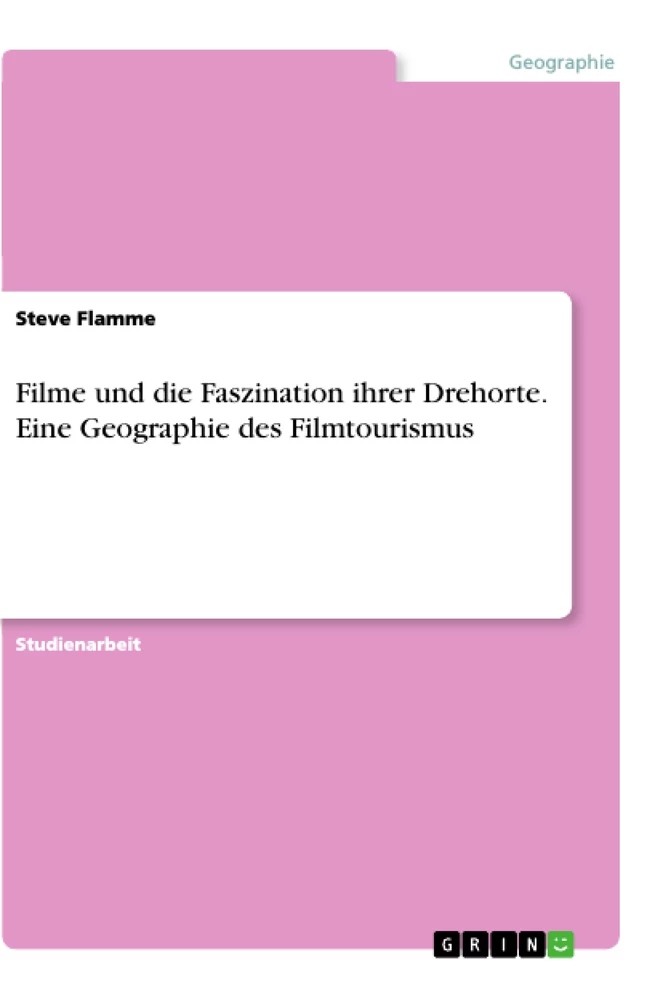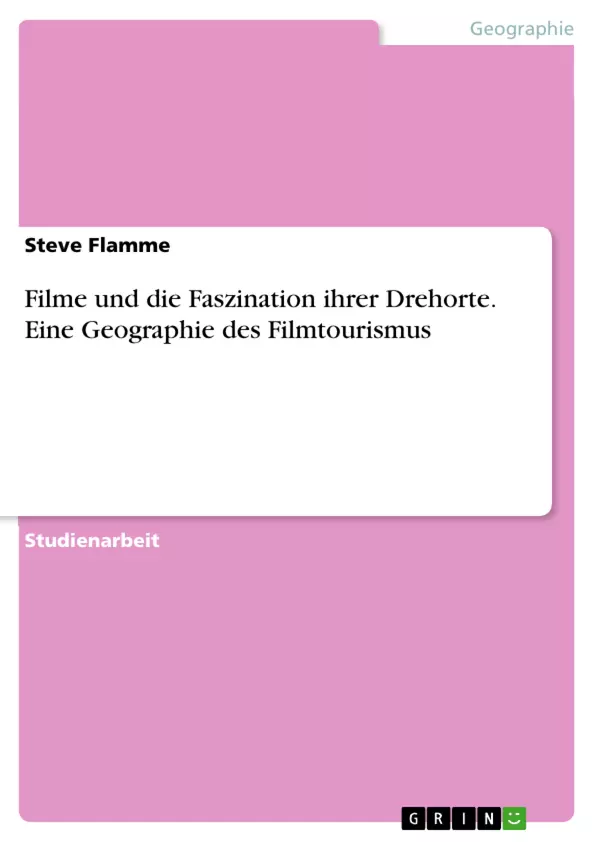Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, welche Folgen und welches Potential der Filmtourismus für die Inwertsetzung von Regionen und Ländern hat. Dafür wird an erster Stelle dargestellt, welche Arten und Unterscheidungsmöglichkeiten von Filmtourismus es gibt und wo potenzielle Grenzen gezogen werden müssen. Für eine argumentative Betrachtung der Vermarktung von Drehorten müssen zusätzlich die intrinsischen Motivationen von Filmtouristen und die daraus folgenden Erwartungen untersucht werden. Denn nur, wenn Destinationen die vorhandenen Erwartungen ihrer Besucher erkennen, können sie Maßnahmen treffen, um eben jene zu erfüllen.
Ein wichtiger Faktor wird bei einer rein wirtschaftsorientierten Analyse meist vernachlässigt, der im Rahmen einer geographischen Betrachtung unter keinen Umständen außer Acht gelassen werden darf. Es handelt sich dabei um die entstehenden ökologischen Probleme und Belastungen, denen sich die Regionen durch den Filmtourismus ausgeliefert sehen. Unter Berücksichtigung all dieser Beschreibungspunkte werden schließlich die wirtschaftlichen Aspekte der Thematik näher betrachtet. Im Fokus stehen dabei die teilhabenden Akteure, Sonderfälle wie Only-Theme-Destinations und schließlich Rahmenbedingungen und Konditionen der filmtouristischen Zusammenarbeit von Destination Managment Organisations und Filmproduzenten.
Schlussendlich sollen all diese Kapitel der wissenschaftlichen Arbeit an zwei konkreten und gleichzeitig sehr unterschiedlichen Beispielen angewendet werden. Es handelt sich dabei um eine genauere Betrachtung der beliebten Drehorte Neuseeland und Island. Ausgehend von allen vorherigen Kapiteln werden die Einflüsse auf jene Destinationen thematisiert und die Umsetzung und die Probleme schlussendlich bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Versuch einer Abgrenzung des Filmtourismus
- 2.1 On Locations
- 2.2 Off Locations
- 2.3 Location Placement am Beispiel von Juzcar
- 3. Motivationen und Erwartungen von Filmtouristen
- 4. Filme als Auslöser ökologischer Belastungen
- 5. Akteure der filminduzierten Tourismuswirtschaft
- 5.1 Grundbedingungen der DMOs an die Filmproduzenten
- 5.2 Vorteile für die Filmproduzenten
- 5.3 Sonderfall Only-Theme-Destinations
- 6. Fallbeispiel Neuseeland
- 7. Fallbeispiel Island
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wirtschaftliche Dynamik des Filmtourismus und dessen Potential für die Inwertsetzung von Regionen. Es werden die verschiedenen Arten von Filmtourismus abgegrenzt, die Motivationen und Erwartungen von Filmtouristen analysiert und die ökologischen Belastungen betrachtet. Schließlich werden die Akteure der filminduzierten Tourismuswirtschaft und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit beleuchtet.
- Abgrenzung des Filmtourismus und dessen Unterteilung
- Motivationen und Erwartungen der Filmtouristen
- Ökologische Auswirkungen des Filmtourismus
- Akteure der filminduzierten Tourismuswirtschaft
- Fallbeispiele Neuseeland und Island
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Filmtourismus ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Folgen und dem Potential des Filmtourismus für die regionale Entwicklung. Sie betont die Parallelen zwischen Tourismus und Filmkunst, die beide neue Seiten und Orte der Welt vermitteln. Der Fokus liegt auf der wirtschaftlichen Dynamik, die aus dem Zusammenwirken von Film und Tourismus entsteht. Es werden die verschiedenen Aspekte der Arbeit skizziert: Abgrenzung des Filmtourismus, Motivationen der Touristen, ökologische Belastungen und wirtschaftliche Aspekte, inklusive der Akteure und Rahmenbedingungen. Abschließend werden die Fallbeispiele Neuseeland und Island angekündigt.
2. Versuch einer Abgrenzung des Filmtourismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der schwierigen Abgrenzung des Filmtourismus als Forschungsfeld. Es wird eine grundlegende Einteilung in Landschaftstourismus (natürliche Räume) und Kulturtourismus (künstlich geschaffene Räume) vorgenommen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Bildes im Kopf des Touristen, das oft wichtiger ist als die Realität vor Ort. Am Beispiel des Mt. Taranaki in Neuseeland wird gezeigt, wie ein Ort durch die Verbindung mit einem Film zum touristischen Ziel wird, wobei der reale Ort austauschbar mit der fiktiven Darstellung wird.
Schlüsselwörter
Filmtourismus, Tourismusgeographie, Landschaftstourismus, Kulturtourismus, Motivationen, Erwartungen, ökologische Belastungen, wirtschaftliche Aspekte, Destination Management Organisationen (DMOs), Filmproduzenten, Only-Theme-Destinations, Neuseeland, Island.
FAQ: Wirtschaftsdynamik des Filmtourismus und dessen Potential für die Inwertsetzung von Regionen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die wirtschaftliche Dynamik des Filmtourismus und sein Potential zur regionalen Entwicklung. Sie analysiert verschiedene Arten von Filmtourismus, die Motivationen und Erwartungen der Touristen, ökologische Auswirkungen und die beteiligten Akteure der filminduzierten Tourismuswirtschaft.
Wie wird Filmtourismus abgegrenzt?
Die Arbeit unternimmt einen Versuch, Filmtourismus abzugrenzen. Es wird zwischen Landschaftstourismus (natürliche Räume) und Kulturtourismus (künstlich geschaffene Räume) unterschieden. Die Bedeutung des vom Touristen im Kopf getragenen Bildes, oft wichtiger als die Realität, wird hervorgehoben. Das Beispiel des Mt. Taranaki in Neuseeland veranschaulicht, wie ein Ort durch einen Film zum touristischen Ziel wird, wobei die fiktive Darstellung den realen Ort ersetzen kann.
Welche Motivationen und Erwartungen haben Filmtouristen?
Die Arbeit analysiert die Motivationen und Erwartungen von Filmtouristen, die jedoch im gegebenen Textfragment nicht explizit benannt werden. Diese Analyse findet sich im Kapitel 3.
Welche ökologischen Belastungen werden durch Filmtourismus verursacht?
Die Arbeit betrachtet die ökologischen Belastungen, die durch Filmtourismus entstehen. Details hierzu finden sich im Kapitel 4.
Welche Akteure sind in der filminduzierten Tourismuswirtschaft beteiligt?
Die Arbeit beleuchtet die Akteure der filminduzierten Tourismuswirtschaft, einschließlich der Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit zwischen Destination Management Organisationen (DMOs) und Filmproduzenten. Der Sonderfall von Only-Theme-Destinations wird ebenfalls behandelt (Kapitel 5).
Welche Fallbeispiele werden untersucht?
Die Arbeit verwendet Neuseeland und Island als Fallbeispiele, um die Auswirkungen des Filmtourismus auf konkrete Destinationen zu analysieren (Kapitel 6 und 7).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Filmtourismus, Tourismusgeographie, Landschaftstourismus, Kulturtourismus, Motivationen, Erwartungen, ökologische Belastungen, wirtschaftliche Aspekte, Destination Management Organisationen (DMOs), Filmproduzenten, Only-Theme-Destinations, Neuseeland, Island.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach den Folgen und dem Potential des Filmtourismus für die regionale Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Versuch einer Abgrenzung des Filmtourismus (mit Unterkapiteln zu On Locations, Off Locations und Location Placement am Beispiel von Juzcar), Motivationen und Erwartungen von Filmtouristen, Filme als Auslöser ökologischer Belastungen, Akteure der filminduzierten Tourismuswirtschaft (mit Unterkapiteln zu Grundbedingungen der DMOs, Vorteilen für Filmproduzenten und Only-Theme-Destinations), Fallbeispiel Neuseeland, Fallbeispiel Island und Fazit.
- Arbeit zitieren
- Steve Flamme (Autor:in), 2018, Filme und die Faszination ihrer Drehorte. Eine Geographie des Filmtourismus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/492975