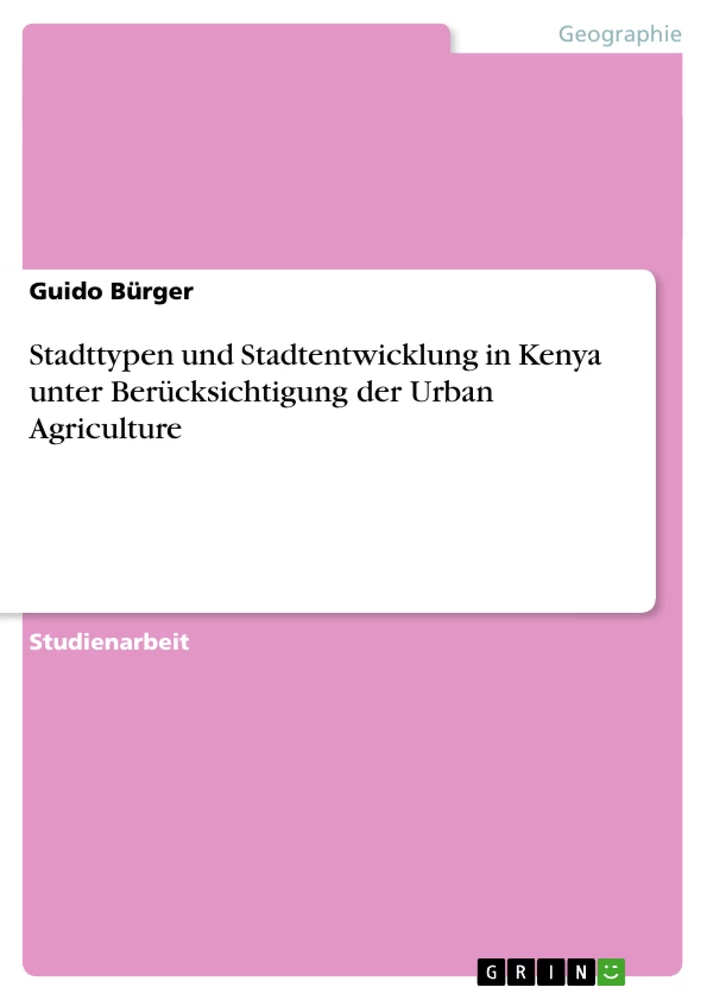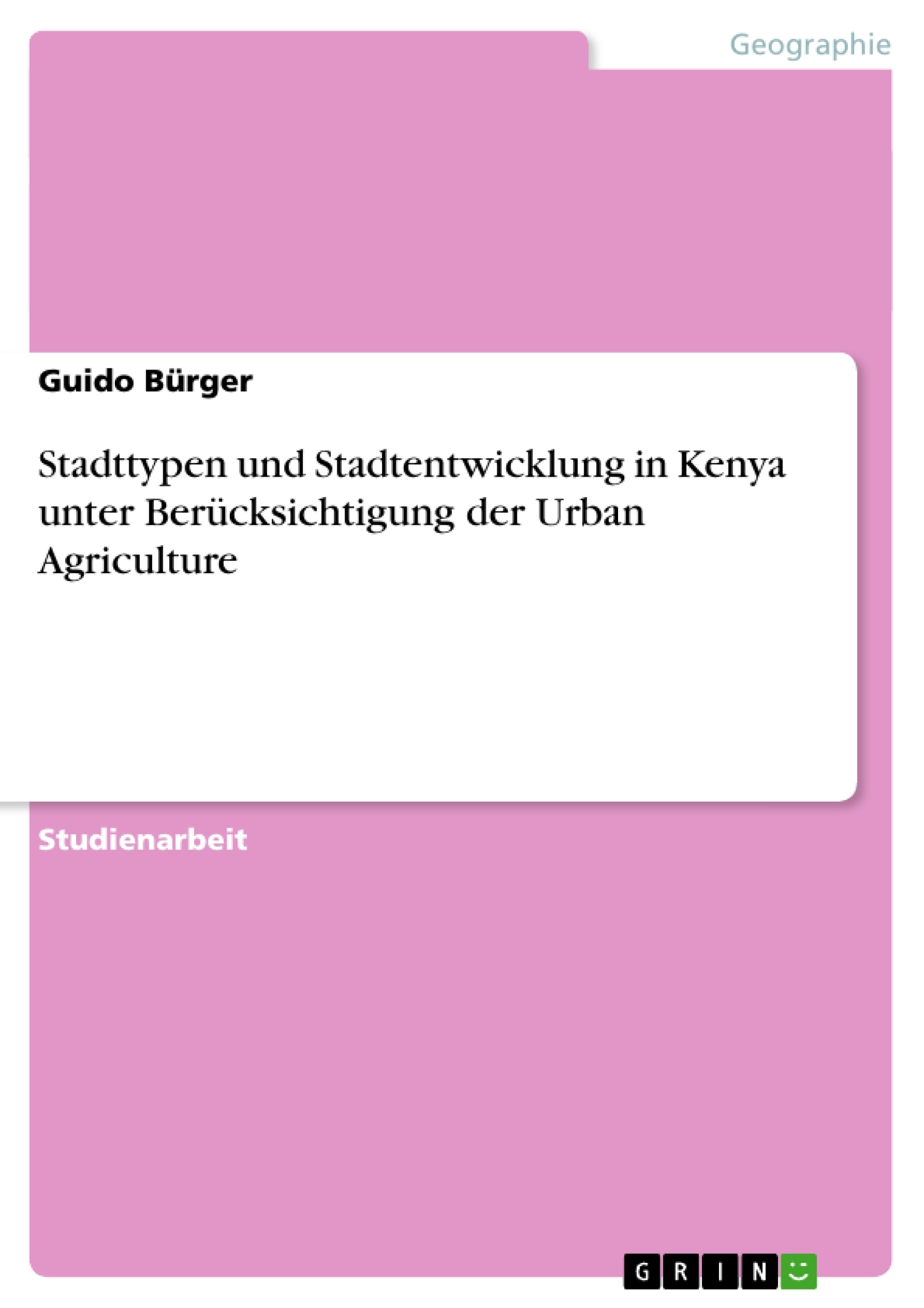In Kenya haben sich aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen verschiedene Städtetypen entwickelt, die nach bestimmten Kriterien definiert werden können. Lamu repräsentiert den am deutlichsten in Afrika verbreiteten Typus der arabisch-islamisch geprägten Küstenstadt. Mit der wichtigste Gesichtspunkt war der frühe Handel, der wesentlich zur Entwicklung der Stadt beigetragen hat. Malindi ist ein Beispiel für eine typische Fremdenverkehrssiedlung mit touristischen Einrichtungen und ausgedehnten Stränden. Gilgil ist ein typisches Landstädtchen in den ehemaligen White Highlands mit wichtigen zentralen Funktionen. Eldoret beschreibt besonders die Merkmale expansiven Wachstums mit bedeutender Industrieansiedlung. Isiolo steht für Grenzstädte, die eine Verknüpfung zwischen den von Hirten und Bauern besiedelten Räumen darstellen. Diese werden als “Gateway Towns“ bezeichnet.
Eine besondere Stellung in der Entwicklung der Städte Kenyas nehmen die beiden Metropolen Nairobi und Mombasa ein. Gerade in den Metropolen steigt die Bedeutung der Versorgung der ärmeren Bevölkerung. Hierbei leistet Urban Agriculture einen besonderen Beitrag, der auch einen hohen Einfluss auf die aktuelle Stadtentwicklung hat. Die Versorgung der armen Bevölkerungsteile mit Nahrungsmitteln durch Umwandlung der im Produktionsprozess der Städte anfallenden Abfallstoffe als bspw. Dünger sichert einen kleinen Grundbetrag an Versorgung. Vielfältige Flächen neben oder zwischen Straßen, Grünanlagen können dafür genutzt werden. Weltweit sind 15% der Bevölkerung auf Produkte der Urban Agriculture angewiesen. Dies ist Grund genug, einen tieferen Blick auf dieses Fragestellung zu werfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stadttypen
- 2.1 Die Arabisch-islamisch beeinflußte Küstenstadt
- 2.2 Landstädte der White Highlands
- 2.3 Expansiver Wachstumspol
- 2.4 Gateway Towns
- 2.5 Die Fremdenverkehrssiedlung
- 3. Urban Agriculture
- 3.1 Allgemeines, “Urban agriculture“ als Teil des informellen Sektors
- 3.2 “Waste is food”
- 4. Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die verschiedenen Stadttypen und die Stadtentwicklung in Kenia, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Urban Agriculture. Ziel ist es, ein Verständnis für die komplexen urbanen Prozesse in Kenia zu entwickeln und die Herausforderungen und Chancen der Stadtentwicklung aufzuzeigen.
- Entwicklung verschiedener Stadttypen in Kenia
- Die Bedeutung des Handels und der Kolonialgeschichte für die Stadtentwicklung
- Urban Agriculture als informeller Sektor und seine Bedeutung für die Ernährungssicherung
- Konflikte zwischen verschiedenen Landnutzungsformen (z.B. Landwirtschaft und Viehhaltung)
- Herausforderungen und Chancen der Stadtentwicklung in Bezug auf Bevölkerungswachstum und Ressourcenmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Kenia als Land mit vielfältigen physischen und gesellschaftlichen Merkmalen. Sie stellt die Frage, inwieweit sich europäische Modelle der Stadtentwicklung auf kenianische Städte übertragen lassen und kündigt die folgenden Ausführungen an, die verschiedene Stadttypen und deren Entwicklung beleuchten.
2. Stadttypen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Stadttypen in Kenia, die sich aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen herausgebildet haben. Es werden Beispiele wie Lamu (arabisch-islamisch geprägte Küstenstadt), Malindi (Fremdenverkehrssiedlung), Gilgil (Landstadt), Eldoret (expansives Wachstum) und Isiolo (Gateway Town) vorgestellt und ihre jeweiligen Merkmale erläutert. Die Metropolen Nairobi und Mombasa erhalten eine besondere Erwähnung aufgrund ihrer herausragenden Stellung in der kenianischen Stadtentwicklung.
2.1 Die Arabisch-islamisch beeinflußte Küstenstadt: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Mombasa und Lamu als Beispiele arabisch-islamisch geprägter Küstenstädte. Er analysiert die Rolle des Handels in ihrer Entstehung und Entwicklung, die Auswirkungen der Kolonialisierung und die räumliche Segregation der Bevölkerung in verschiedene Stadtviertel. Die topographische Lage Mombasas und die Bedeutung des Hafens für den Fernhandel werden hervorgehoben. Die Auswirkungen der Uganda-Bahn auf die Stadtentwicklung werden ebenfalls diskutiert, genauso wie die soziale und räumliche Trennung der Bevölkerungsgruppen.
2.2 Landstädte der White Highlands: Dieser Teil beschreibt die Entwicklung von Landstädten in den White Highlands nach dem Bau der Uganda-Bahn. Die Kapitel beleuchtet die marktwirtschaftliche Inwertsetzung der Region, die Implementierung von Siedlerkolonien und die damit verbundene Landnahme. Es wird der Konflikt zwischen europäischen Siedlern und der afrikanischen Bevölkerung thematisiert, insbesondere die Entstehung von „Squatter“-Siedlungen und die späteren Versuche, die Landknappheit durch Settlement Schemes zu lösen. Die Rolle der Verwaltungseinheiten für die landwirtschaftliche Entwicklung und die Bedeutung des Eisenbahnknotenpunkts für die Versorgung und den Transport werden ebenfalls angesprochen.
2.3 Expansiver Wachstumspol: Dieser Abschnitt beschreibt Eldoret als Beispiel für einen expansiven Wachstumspol, der aus der Entwicklung der Landwirtschaft in der Region hervorgegangen ist. Es werden die Entstehung von marktorientierten Betrieben, die Entwicklung einer entsprechenden Infrastruktur und der europäische Einfluss auf die Stadtstruktur beleuchtet. Die Kapitel thematisiert auch die Versuche, die Konkurrenz durch verschiedene Marktinstrumente vom Markt auszuschließen und die daraus resultierenden Ungleichheiten.
2.4 Gateway Towns: Dieser Teil des Kapitels befasst sich mit den „Gateway Towns“, die den Konflikt zwischen bäuerlicher Landwirtschaft und Hirtenkultur repräsentieren. Es werden die sozioökonomischen und ökologischen Unterschiede der Regionen und die daraus resultierenden Konfliktsituationen, insbesondere der Konflikt zwischen Viehhaltung und Ackerbau, erläutert. Die „Gateway Towns“ werden als Verknüpfungspunkte und Anlaufstationen für beide Seiten beschrieben, um Probleme zu behandeln und zu koordinieren.
2.5 Die Fremdenverkehrssiedlung: Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklung von Fremdenverkehrssiedlungen, insbesondere Malindi, als Beispiel. Die Entwicklung des Tourismus im Kontext der Kolonialgeschichte wird beschrieben und die Entstehung einer multifunktionalen Mittelstadt mit eigener Wachstumsdynamik wird beleuchtet. Die Kapitel thematisiert auch die Herausforderungen der explodierenden Bevölkerungsentwicklung und die Notwendigkeit der Kooperation zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
3. Urban Agriculture: Das Kapitel widmet sich dem Thema „Urban Agriculture“ als Reaktion auf die stetig wachsende urbane Bevölkerung und die damit verbundenen Herausforderungen der Nahrungsmittelversorgung. Es erläutert „Urban Agriculture“ als Teil des informellen Sektors und beschreibt die Vorteile dieser Form der Landwirtschaft in Bezug auf Ressourceneffizienz und den Beitrag zur Stadtökologie. Der Abschnitt “Waste is food” hebt die innovative Nutzung von Abfällen zur Lebensmittelproduktion hervor.
3.1 Allgemeines; “Urban agriculture“ als Teil des informellen Sektors: Dieser Abschnitt beschreibt "Urban Agriculture" im Detail und beleuchtet seine Rolle im informellen Sektor. Die geringe Ressourcenausstattung und die hohe Arbeitsintensität werden ebenso behandelt wie die Vorteile in Bezug auf Umweltschutz und Ernährungssicherheit. Statistiken zum Anteil von Stadtbauern im Vergleich zu konventionellen Landwirten werden präsentiert.
3.2 „Waste is food“: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die innovative Nutzung von organischen und anorganischen Abfällen in der urbanen Landwirtschaft. Die Umwandlung von Abfall in Nahrungsmittel und die damit verbundenen ökologischen Vorteile werden ausführlich beschrieben. Es werden auch die wirtschaftlichen Aspekte, wie die hohe Ertragskraft und die Beschäftigungsdichte, hervorgehoben. Schließlich werden potentielle Konflikte, wie die gesundheitliche Belastung, und die soziale Bedeutung von "Urban Agriculture" beleuchtet.
Kenianische Stadtentwicklung und Urban Agriculture: FAQs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die verschiedenen Stadttypen und die Stadtentwicklung in Kenia, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Urban Agriculture. Es werden verschiedene kenianische Städte und ihre Entwicklung im Kontext der Kolonialgeschichte und des Handels untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen und Chancen der Stadtentwicklung im Hinblick auf Bevölkerungswachstum und Ressourcenmanagement.
Welche Stadttypen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Stadttypen, darunter arabisch-islamisch geprägte Küstenstädte (z.B. Mombasa und Lamu), Landstädte der White Highlands (z.B. Gilgil), expansive Wachstumspolen (z.B. Eldoret), Gateway Towns (z.B. Isiolo) und Fremdenverkehrssiedlungen (z.B. Malindi). Die Metropolen Nairobi und Mombasa werden aufgrund ihrer herausragenden Stellung gesondert betrachtet.
Welche Rolle spielt die Kolonialgeschichte?
Die Kolonialgeschichte spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der kenianischen Städte. Der Bau der Uganda-Bahn, die Implementierung von Siedlerkolonien und die damit verbundene Landnahme haben die Stadtentwicklung maßgeblich beeinflusst. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Kolonialisierung auf die räumliche Segregation der Bevölkerung und die Entstehung von Konflikten zwischen europäischen Siedlern und der afrikanischen Bevölkerung.
Was ist Urban Agriculture und welche Bedeutung hat sie?
Urban Agriculture wird als Teil des informellen Sektors beschrieben und stellt eine Reaktion auf die wachsende urbane Bevölkerung und die damit verbundenen Herausforderungen der Nahrungsmittelversorgung dar. Sie wird als effiziente und umweltfreundliche Form der Landwirtschaft betrachtet, die zur Ernährungssicherung und Stadtökologie beiträgt. Der innovative Aspekt der Abfallverwertung ("Waste is food") wird besonders hervorgehoben.
Welche Konflikte werden thematisiert?
Die Arbeit thematisiert verschiedene Konflikte, darunter den Konflikt zwischen europäischen Siedlern und der afrikanischen Bevölkerung um Land, den Konflikt zwischen Viehhaltung und Ackerbau in den Gateway Towns, und potentielle Konflikte im Zusammenhang mit Urban Agriculture, z.B. gesundheitliche Belastungen durch Abfallverwertung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über verschiedene Stadttypen mit Unterkapiteln zu spezifischen Stadttypen, ein Kapitel über Urban Agriculture mit Unterkapiteln zu allgemeinen Aspekten und "Waste is food", und ein Schlußwort.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Entwicklung verschiedener Stadttypen in Kenia, die Bedeutung des Handels und der Kolonialgeschichte für die Stadtentwicklung, Urban Agriculture als informeller Sektor und seine Bedeutung für die Ernährungssicherung, Konflikte zwischen verschiedenen Landnutzungsformen, und Herausforderungen und Chancen der Stadtentwicklung in Bezug auf Bevölkerungswachstum und Ressourcenmanagement.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Für jedes Kapitel (Einleitung, Stadttypen mit Unterkapiteln, Urban Agriculture und Schlußwort) wird eine detaillierte Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte und Ergebnisse bereitgestellt, die die jeweiligen Schwerpunkte und Argumentationslinien erläutert.
- Quote paper
- Guido Bürger (Author), 2001, Stadttypen und Stadtentwicklung in Kenya unter Berücksichtigung der Urban Agriculture, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/49012