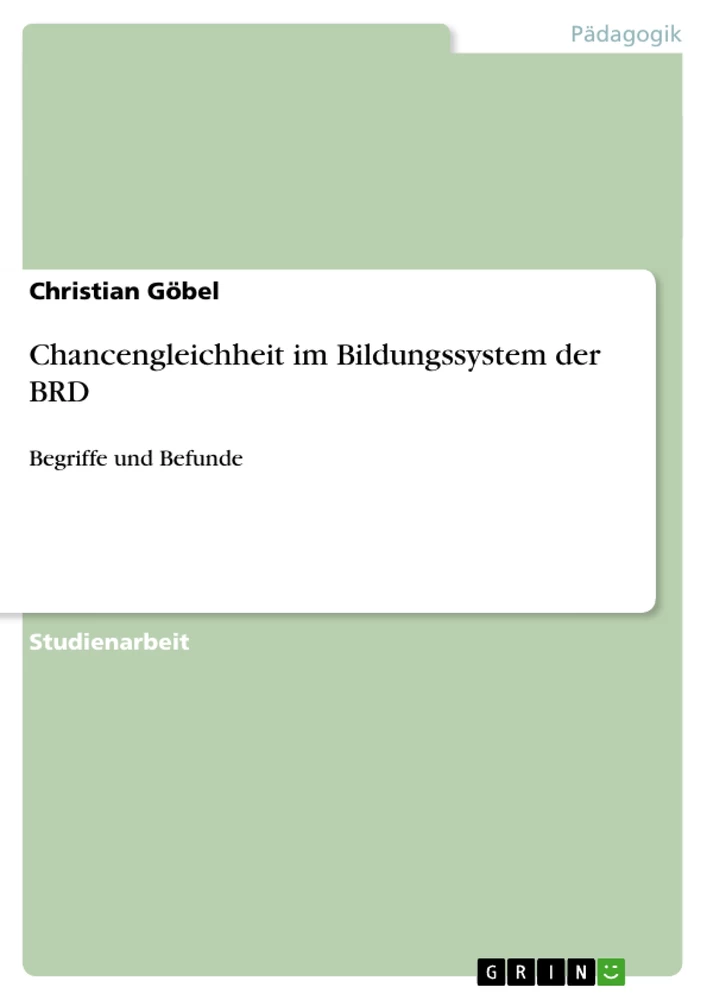Spätestens seit Pisa ist die deutsche Bildungspolitik in aller Munde. Plötzlich ist ein Jeder Experte und Kenner der Szene und weiß genau über die Gründe der Bildungsmisere bescheid. Bildungsmisere? Ist es das, was die Studie der deutschen Politik attestiert? Nun, die Ergebnisse sind deutlich. Deutsche Schüler haben in vielen Disziplinen im internationalen Vergleich recht mäßig abgeschnitten, obwohl Deutschland, zumindest rein wirtschaftlich gesehen, immer noch eine europäische Vormachtsstellung einnimmt. Andere Länder, deren wirtschaftliche Datenlage nicht so verheißungsvoll ausfällt, schaffen es jedoch im Gegenzug ihren Nachwuchs qualitativ besser auszubilden, womit für deutsche Kinder eine Konkurrenz auf dem Bildungsmarkt entsteht, die nicht von der Hand zu weisen ist, und die die zukünftige Entwicklung Deutschlands im internationalen Vergleich negativ beeinflussen wird. Aber warum gelingt es anderen Ländern trotz verhältnismäßig geringerer Etats eine womöglich bessere Bildungspolitik anzubieten? Die Ursachen dafür müssen in den Problemen des deutschen Bildungssystems gesucht werden, die leider vielfältig sind und von denen an dieser Stelle nur einige Wesentliche genannt werden sollen. Zum ersten zu nennen wäre die Tatsache, dass Bildung dezentral geleitet und verwaltet wird. Bund und Länder bilden zwar ein föderatives System, jedoch bedingt Föderalismus immer Kommunikationsprobleme und Ungleichheiten in der Exekutiven aufgrund unterschiedlicher Gewichtung von Prämissen. Zum zweiten zu nennen wäre die mangelnde vorschulische Erziehung des Nachwuchses, der früh angesetzt in der prägenden Phase von Kindern, in der die Lernmotivation immens hoch ist, eine qualitative Steigerung der Lernmöglichkeiten zur Folge hat, jedoch in Deutschland zumeist völlig missachtet wird. Andere Länder zeigen dabei deutlich die positiven Folgen dieser Lehrmethode auf und können erhebliche Erfolge dadurch aufweisen. Eine weitere Problematik, die genannt werden muss, ist die Lage der Lehrkräfte in Deutschland. Dieses Problemfeld ist ein sehr großes und weit reichendes, da die Qualität der schulischen Ausbildung der Zöglinge maßgeblich durch die Lehrkräfte beeinflusst wird...
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsdefinition und Einordnung der Chancengleichheit in das Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland
- Begriffsbestimmung Chancengleichheit
- Bildung als Faktor sozialen Wohlstandes
- Kriterien zur Bemessung von sozialer Gleichheit
- Die Primarstufe, Grundstein der Bildungskarriere in Kritischer Betrachtung
- Chancengleichheit nach der Einschulung
- Übergangsproblematik
- Rechtlicher Rahmen der Elternentscheidung
- Das Lehrerurteil
- Schülerverteilung auf den weiterführenden Schulen hinsichtlich Ihres sozialen Hintergrundes
- Abschlüsse und Kompetenzen
- Herkunftsethnien, Migrantenstatus sowie geschlechtsspezifische Unterschiede
- Zusammenfassender Überblick über die Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob alle Schüler unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit oder ihrem Geschlecht gleiche Chancen auf Bildungserfolg haben. Ziel ist es, die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Chancengleichheit aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
- Definition und Einordnung der Chancengleichheit im Bildungssystem
- Einfluss sozialer Faktoren auf Bildungserfolg
- Die Rolle der Primarstufe und des Übergangs in die Sekundarstufe
- Herausforderungen im Kontext von Migration und Geschlecht
- Mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel definiert den Begriff der Chancengleichheit im Bildungssystem und zeigt die Bedeutung von Bildung als Grundlage für sozialen Wohlstand auf. Es werden zudem Kriterien zur Bemessung von sozialer Gleichheit vorgestellt.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Primarstufe als Grundstein der Bildungskarriere und analysiert die Chancengleichheit nach der Einschulung sowie die Problematik des Übergangs in die Sekundarstufe. Dabei werden auch die Entscheidungsgewalt der Lehrkräfte und deren Einfluss auf den weiteren Bildungsverlauf beleuchtet.
- Das dritte Kapitel widmet sich der Verteilung der Schüler auf die weiterführenden Schulen hinsichtlich ihres sozialen Hintergrundes, den Abschlüssen und Kompetenzen, die im Laufe der Schullaufbahn erworben werden.
- Das vierte Kapitel betrachtet die Auswirkungen von Herkunftslethnien, Migrantenstatus und geschlechtsspezifischen Unterschieden auf den Bildungserfolg.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungssystem, Bundesrepublik Deutschland, soziale Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Bildungserfolg, Primarstufe, Sekundarstufe, Übergangsproblematik, Schülerverteilung, Migrantenstatus, Lehrkraft, Entscheidungsgewalt, Abschlüsse, Kompetenzen.
- Arbeit zitieren
- Christian Göbel (Autor:in), 2004, Chancengleichheit im Bildungssystem der BRD, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/48769