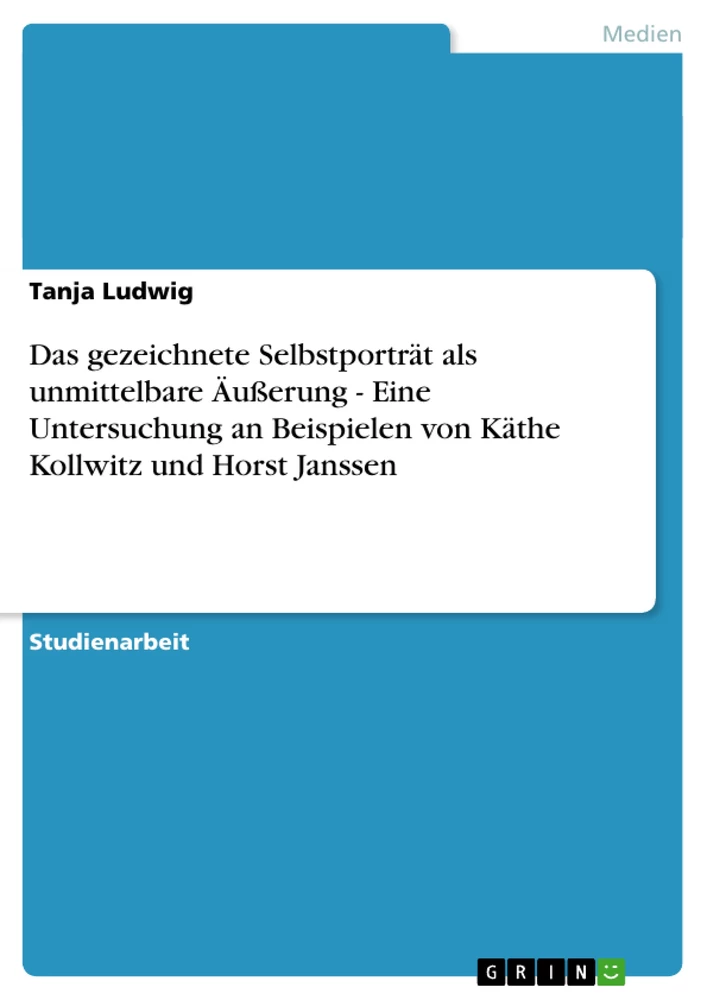„The pictorial conquest of the external visual world had been completed and refined many times and in different ways during the previous half millennium. The more adventurous and original artists had grown bored with painting facts. By a common and powerful impulse they were driven to abandon the imitation of natural appearance.” Alfred H. Barr diagnostiziert hier den Künstlern des 20. Jahrhunderts eine Art Überdruss an naturalistischer Darstellung. Zugespitzt formuliert er: „die wagemutigeren und originelleren langweilte es, Tatsachen zu malen.“
Was sich bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts leise andeutet, hat sich in Rückblick auf das vergangene Jahrhundert längst vollzogen - ja sich selbst beinahe schon wieder überholt: die Hinwendung zur Abstraktion. Ich möchte das Wort „abstrakt“ oder „Abstraktion“ hier im Sinne von Abwendung vom Naturalistischen, Realistischen und vor allem dem Menschen als dem jahrhundertealten zentralen Thema verwenden und in dieser Hinsicht kurz untersuchen. Die Abwendung vom Menschen hat gerade im zwanzigsten Jahrhundert viele mögliche Ursachen, die auch außerhalb der Kunstgeschichte zu suchen sind. Einige möchte ich näher beleuchten.
Auch wenn der Mensch in vielen Kunstrichtungen der klassischen Moderne und des 20. Jahrhunderts noch als Ursprung oder Kürzel auftaucht, als (einziges) Sujet in seiner reinen realistisch abgebildeten Form eignete er sich nicht mehr, etwas vollkommen Neues zu schaffen. So formuliert Jose Ortega Y Gasset in seiner 1925 erstmals erschienen Schrift „Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst“: „Ein gut Teil dessen, was ich „Entmenschlichung“ und Ekel vor der lebenden Form nannte, rührt von dieser Abneigung gegen die traditionelle Interpretation des Wirklichen her.“ Dieser „Ekel vor der lebenden Form“, den Ortega Y Gasset hier in den Raum stellt, möchte ich auf folgenden Aspekt ausweiten: Es liegt durchaus auf der Hand, dass sich der Mensch in einem Zeitalter der Kriege, der grausamen Diktaturen und der unsagbaren Verbrechen, die von Menschenhand begangen wurden, von deren „Verursacher“, also dem Menschen selbst abwenden muss - sozusagen um seines eigenen Seelenheil willens. Während vor der Zeit des Zweiten Weltkriegs die menschliche Darstellung allenfalls als rückschrittlich und zu akademisch angesehen wurde, bekam sie mit der Propaganda-Maschinerie des Nazi-Regimes eine zusätzliche Färbung, die man in den folgenden Jahren um jeden Preis vermeiden wollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Gedanken
- 1.1. Zur Epoche der Abstraktion
- 1.2. Selbstbildnis als möglicher Weg zur Selbsterkenntnis?
- 1.2.1. Zur Entstehung der Bildnisse
- 1.2.2. Von der Außensicht zur Innensicht?
- 2. Käthe Kollwitz
- 2.1. Das Blatt Selbstbildnis zeichnend 1933
- 2.1.1. Linienführung
- 2.1.2. Einordnung in das Gesamtwerk
- 2.2. Künstlerisches Selbstverständnis?
- 2.3. Rezeption
- 3. Horst Janssen
- 3.1. Das Blatt Selbst 14.7.71
- 3.1.1. Linienführung
- 3.2. Sind Janssens Selbstbildnisse Seelenbilder?
- 3.3. Künstlermensch vs. Kunstmensch
- 4. Zur Wahl der Mittel
- 4.1. Käthe Kollwitz und die weichen Zeichenmittel
- 4.2. Horst Janssen und der harte Strich
- 5. Zur Unmittelbarkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das gezeichnete Selbstporträt als unmittelbaren Ausdruck künstlerischer Selbsterfahrung, anhand der Werke von Käthe Kollwitz und Horst Janssen. Die Arbeit analysiert die Wahl der Zeichenmittel und deren Bedeutung für die künstlerische Aussage. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen der künstlerischen Technik und der inneren Welt der Künstler.
- Das gezeichnete Selbstporträt als Ausdruck der künstlerischen Identität
- Der Einfluss der Epoche der Abstraktion auf die Selbstporträts von Kollwitz und Janssen
- Die Rolle der Zeichenmittel (Linienführung, Material) in der Gestaltung des Selbstbildnisses
- Der Vergleich der künstlerischen Strategien von Käthe Kollwitz und Horst Janssen
- Der Aspekt der Unmittelbarkeit im gezeichneten Selbstporträt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Gedanken: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit. Es beginnt mit einer Betrachtung der Epoche der Abstraktion im 20. Jahrhundert und der damit verbundenen Abwendung vom Menschen als zentrales künstlerisches Thema. Es wird die Frage aufgeworfen, warum sich Künstler trotz dieser Entwicklung bewusst für das Selbstporträt als Sujet entscheiden. Der Abschnitt beleuchtet verschiedene gesellschaftliche und künstlerische Faktoren, die zur Entstehung und Verbreitung der Abstraktion beitrugen. Anschließend wird die Frage nach der Entstehung des Bildnisses und des Selbstbildnisses im historischen Kontext diskutiert, wobei der Fokus auf der Entwicklung vom äußeren Abbild zur inneren Selbsterkenntnis liegt. Die Rolle von Nominalismus, Renaissance und dem Werk von Künstlern wie Albrecht Dürer wird hier thematisiert, um einen umfassenden Kontext für die spätere Analyse der Selbstporträts von Kollwitz und Janssen zu schaffen. Der Übergang zur Zeichnung als eigenständiges Medium wird ebenfalls beleuchtet, wobei die Bedeutung der Unmittelbarkeit hervorgehoben wird.
2. Käthe Kollwitz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Werk Käthe Kollwitz, insbesondere auf ihr Selbstbildnis "zeichnend" von 1933. Es analysiert die Linienführung und die Einordnung des Werkes in ihr Gesamtwerk. Des Weiteren wird ihr künstlerisches Selbstverständnis erörtert und die Rezeption ihrer Selbstporträts diskutiert. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Zeichnung als Ausdruck ihrer persönlichen und künstlerischen Identität im Kontext ihrer Lebensumstände und ihres künstlerischen Schaffens. Die Analyse geht auf die spezifischen Eigenschaften von Kollwitz' künstlerischer Sprache und deren Bedeutung für die Darstellung des Selbst ein.
3. Horst Janssen: Ähnlich wie Kapitel 2, konzentriert sich dieses Kapitel auf das Werk Horst Janssens, speziell auf sein Selbstbildnis "Selbst 14.7.71". Es wird die Linienführung im Detail analysiert, und die Frage gestellt, ob Janssens Selbstbildnisse als "Seelenbilder" interpretiert werden können. Der Unterschied zwischen "Künstlermensch" und "Kunstmensch" im Kontext von Janssens Werk wird ebenfalls behandelt. Die Analyse geht tiefer auf die spezifischen Merkmale von Janssens Stil und dessen Beziehung zu seinem Selbstverständnis und seiner künstlerischen Intention ein. Die Interpretation des Selbstporträts als Ausdruck seiner Persönlichkeit wird umfassend diskutiert.
4. Zur Wahl der Mittel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Vergleich der von Käthe Kollwitz und Horst Janssen verwendeten Zeichenmittel. Es werden die weichen Zeichenmittel Kollwitz' und der harte Strich Janssens gegenübergestellt, und deren jeweilige Wirkung auf die künstlerische Aussage untersucht. Die Analyse zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen der Wahl des Mediums und dem Ausdruck des Selbst zu ergründen und die unterschiedlichen künstlerischen Strategien beider Künstler zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Selbstporträt, Zeichnung, Käthe Kollwitz, Horst Janssen, Abstraktion, Linienführung, Zeichenmittel, Künstlerisches Selbstverständnis, Unmittelbarkeit, Selbsterkenntnis, Künstlerische Identität, klassische Moderne, 20. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Selbstporträts von Käthe Kollwitz und Horst Janssen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht gezeichnete Selbstporträts als unmittelbaren Ausdruck künstlerischer Selbsterfahrung, anhand der Werke von Käthe Kollwitz und Horst Janssen. Im Fokus steht die Analyse der Wahl der Zeichenmittel und deren Bedeutung für die künstlerische Aussage, sowie die Verbindung zwischen künstlerischer Technik und der inneren Welt der Künstler.
Welche Künstler werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Werke von Käthe Kollwitz und Horst Janssen. Konkret werden Kollwitz' Selbstbildnis "zeichnend" (1933) und Janssens Selbstbildnis "Selbst 14.7.71" analysiert.
Welche Aspekte der Selbstporträts werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Linienführung, die Wahl der Zeichenmittel (weich bei Kollwitz, hart bei Janssen), die Einordnung der Werke in das jeweilige Gesamtwerk der Künstler, das künstlerische Selbstverständnis beider Künstler, die Rezeption ihrer Arbeiten und die Frage nach der Unmittelbarkeit und dem Ausdruck von Selbsterkenntnis in den Zeichnungen. Es wird auch der Unterschied zwischen "Künstlermensch" und "Kunstmensch" im Kontext von Janssens Werk diskutiert.
Welche Rolle spielt die Epoche der Abstraktion?
Die Arbeit beleuchtet den Kontext der Epoche der Abstraktion im 20. Jahrhundert und die damit verbundene Abwendung vom Menschen als zentrales künstlerisches Thema. Es wird untersucht, warum sich Kollwitz und Janssen trotz dieser Entwicklung für das Selbstporträt entschieden haben.
Wie werden die Kapitel der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 bietet einleitende Gedanken zur Epoche der Abstraktion und zur Entstehung des Selbstporträts. Kapitel 2 und 3 analysieren die Werke von Käthe Kollwitz und Horst Janssen jeweils im Detail. Kapitel 4 vergleicht die Wahl der Zeichenmittel beider Künstler. Kapitel 5 befasst sich mit dem Aspekt der Unmittelbarkeit im gezeichneten Selbstporträt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstporträt, Zeichnung, Käthe Kollwitz, Horst Janssen, Abstraktion, Linienführung, Zeichenmittel, Künstlerisches Selbstverständnis, Unmittelbarkeit, Selbsterkenntnis, Künstlerische Identität, klassische Moderne, 20. Jahrhundert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das gezeichnete Selbstporträt als Ausdruck der künstlerischen Identität zu untersuchen, den Einfluss der Epoche der Abstraktion zu beleuchten, die Rolle der Zeichenmittel zu analysieren, die künstlerischen Strategien von Kollwitz und Janssen zu vergleichen und den Aspekt der Unmittelbarkeit im gezeichneten Selbstporträt zu erörtern.
Wie wird der Vergleich zwischen Kollwitz und Janssen vorgenommen?
Der Vergleich konzentriert sich auf die unterschiedlichen künstlerischen Strategien, insbesondere auf die Wahl der Zeichenmittel (weiche vs. harte Linienführung) und deren Auswirkungen auf die künstlerische Aussage und den Ausdruck des Selbst.
- Quote paper
- Tanja Ludwig (Author), 2004, Das gezeichnete Selbstporträt als unmittelbare Äußerung - Eine Untersuchung an Beispielen von Käthe Kollwitz und Horst Janssen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/48331