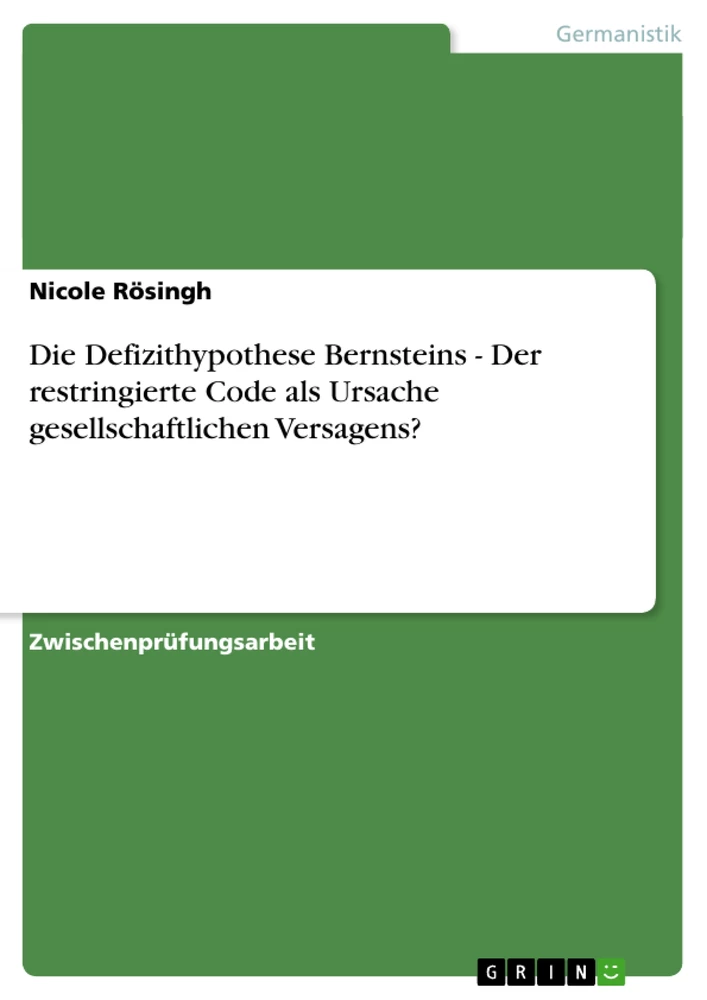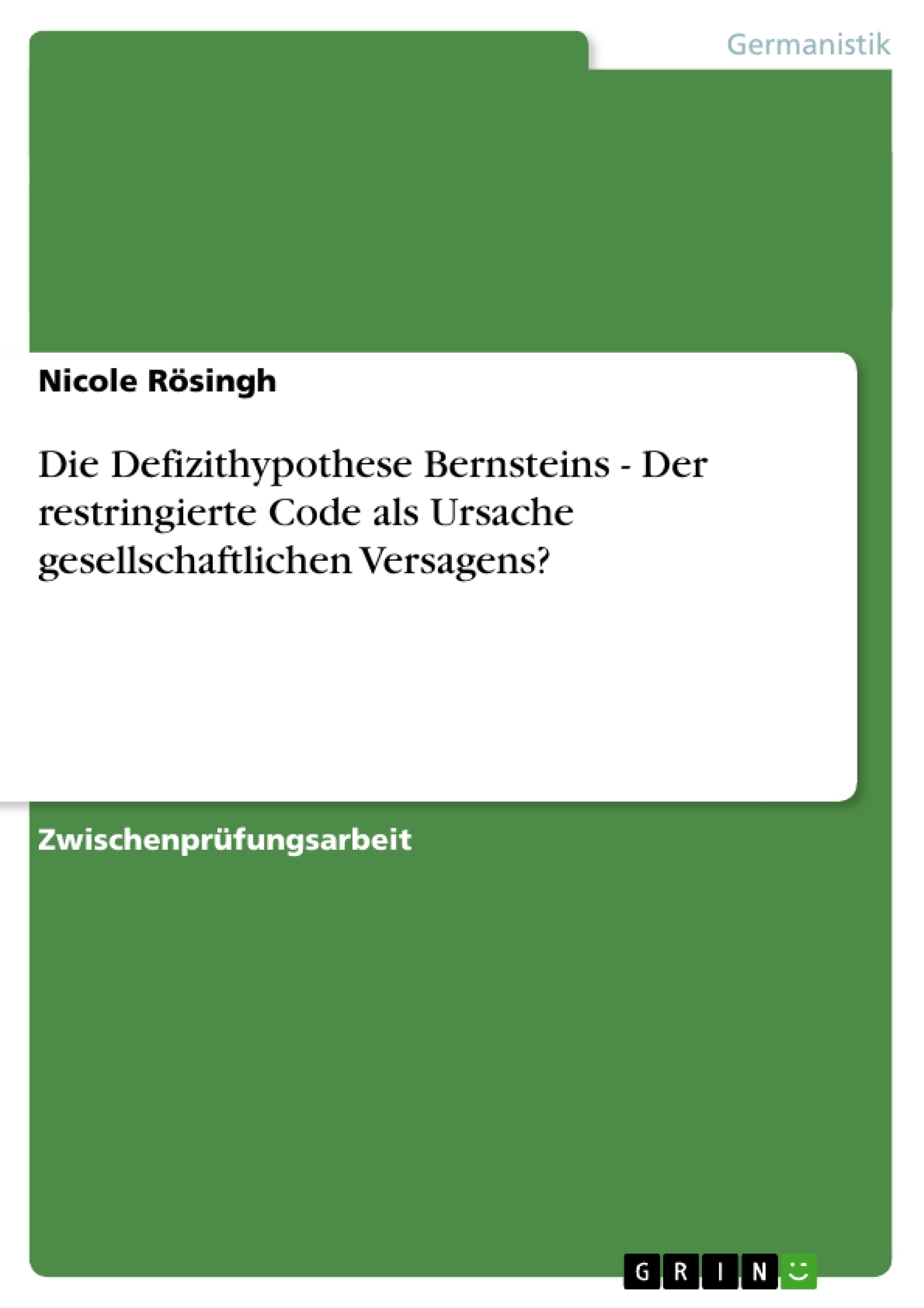„Die Vermutung ist ausgesprochen worden, daß unterschiedliche Sprechweisen (forms of spoken language) mit der Organisation besonderer sozialer Gruppen zusammenhängen. Linguistische Unterschiede - und hiermit sind keine Dialektformen gemeint - finden sich in der alltäglichen sozialen Umwelt, und soziale Schichten können durch ihre Sprechweisen (forms of speech) unterschieden werden.“ Mit dieser Einleitung zu seinem Aufsatz über den Zusammenhang von Sprache und sozialer Schicht hat Bernstein das beschrieben, was später die Basis der Defizit-Hypothese werden sollte: Nämlich die Tatsache, dass es einen grundlegenden Unterschied in der Realisierung von Sprache gibt zwischen Sprechern der so genannten Arbeiterschicht und der Mittelschicht. Diese Realisierung geht ihrerseits einher mit bestimmten lexikalischen und syntaktischen Merkmalen, die Bernstein später zu der dichotomen Einteilung in die Kategorien „restringiert“ und „elaboriert“ veranlasste, da sich die Sprache der Mittelschicht durch eine gewisse „Wohlorganisiertheit“ auszeichnet, wohingegen sich die Sprechweise der Arbeiterschicht im direkten Vergleich als verbal eingeschränkt erweist. Die Folge dieser Beschränkung sei schließlich eine nur begrenzte soziale Mobilität, da ein Mitglied der restringierten Sprachgemeinschaft mit seiner Sprechweise von den Angehörigen der vergleichsweise höheren Schicht nicht anerkannt und entsprechend an dieser Barriere scheitern wird. Die folgende Ausarbeitung wird sich schwerpunktmäßig mit der Konzeption von Bernsteins Defizit-Hypothese auseinander setzen, die heute noch zu den elementaren, wenn auch viel kritisierten Forschungsansätzen der Soziolinguistik zählt und deren Rezeption vor allem in den 60er und 70er Jahren für eine Vielzahl von gesellschaftspolitischen Kontroversen sorgte.
Der erste Teil der Arbeit wird sich zunächst mit der Entwicklung der Code-Theorie auseinander setzen und einen Überblick darüber geben, in welcher Weise Bernstein die Unterteilung der Gesellschaftsstruktur in zwei Schichten vorgenommen und wie er die beiden konstitutiven Codes im Hinblick auf die Schichteinteilung definiert hat. Der zweite Teil wird sich schließlich mit der Sozialisation als bestimmenden Faktor bei der Entstehung schichtspezifischer Codes beschäftigen und auf die Rolle eingehen, die die Organisationsstruktur einer Familie bei der Entwicklung von unterschiedlichen Sprechweisen spielt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der Code-Theorie
- Ältere Forschungsansätze
- Einteilung der Schichten bei Bernstein
- Unterscheidung von elaboriertem und restringiertem Code
- Sozialisation als Determinante bei der Herausbildung schichtspezifischer Codes
- Die Entwicklung von Sprechcodes anhand familientypischer Rollensysteme
- Der gesellschaftspolitische Ansatz der Defizit-Theorie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit Bernsteins Defizit-Hypothese auseinander, die die Annahme vertritt, dass Unterschiede in der Sprachrealisierung zwischen Arbeiterschicht und Mittelschicht zu sozialem Versagen führen können.
- Entwicklung der Code-Theorie und deren historische Wurzeln
- Unterscheidung zwischen elaboriertem und restringiertem Code
- Einfluss der Sozialisation auf die Bildung schichtspezifischer Codes
- Rolle der Familienstruktur bei der Entwicklung von Sprechweisen
- Gesellschaftspolitische Implikationen der Defizit-Hypothese
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Defizit-Hypothese ein und beleuchtet die grundlegenden Annahmen Bernsteins über die Unterschiede in der Sprachrealisierung zwischen Arbeiterschicht und Mittelschicht.
Kapitel 2 befasst sich mit der Entwicklung der Code-Theorie und präsentiert ältere Forschungsansätze, die bereits die Annahme vertreten haben, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen über begrenzte sprachliche Fertigkeiten verfügen. Hier werden auch Bernsteins Einteilung der Gesellschaftsstruktur in zwei Schichten und seine Definition der beiden konstitutiven Codes im Hinblick auf die Schichteinteilung beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die Rolle der Sozialisation als bestimmenden Faktor bei der Entstehung schichtspezifischer Codes und untersucht, wie die Organisationsstruktur einer Familie die Entwicklung unterschiedlicher Sprechweisen beeinflusst.
Kapitel 4 setzt sich mit dem gesellschaftspolitischen Ansatz der Defizit-Hypothese auseinander und diskutiert die Frage, ob Sprecher aus der unteren Gesellschaftsschicht aufgrund ihrer "restringierten" Sprechweise schlechtere Erfolgsaussichten in einer "mittelschichtzentrierten" Gesellschaft haben.
Schlüsselwörter
Defizit-Hypothese, Code-Theorie, Sprachrealisierung, Soziolinguistik, Arbeiterschicht, Mittelschicht, elaborierter Code, restringierter Code, Sozialisation, Familienstruktur, gesellschaftspolitische Implikationen.
- Arbeit zitieren
- Nicole Rösingh (Autor:in), 2003, Die Defizithypothese Bernsteins - Der restringierte Code als Ursache gesellschaftlichen Versagens?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/48327