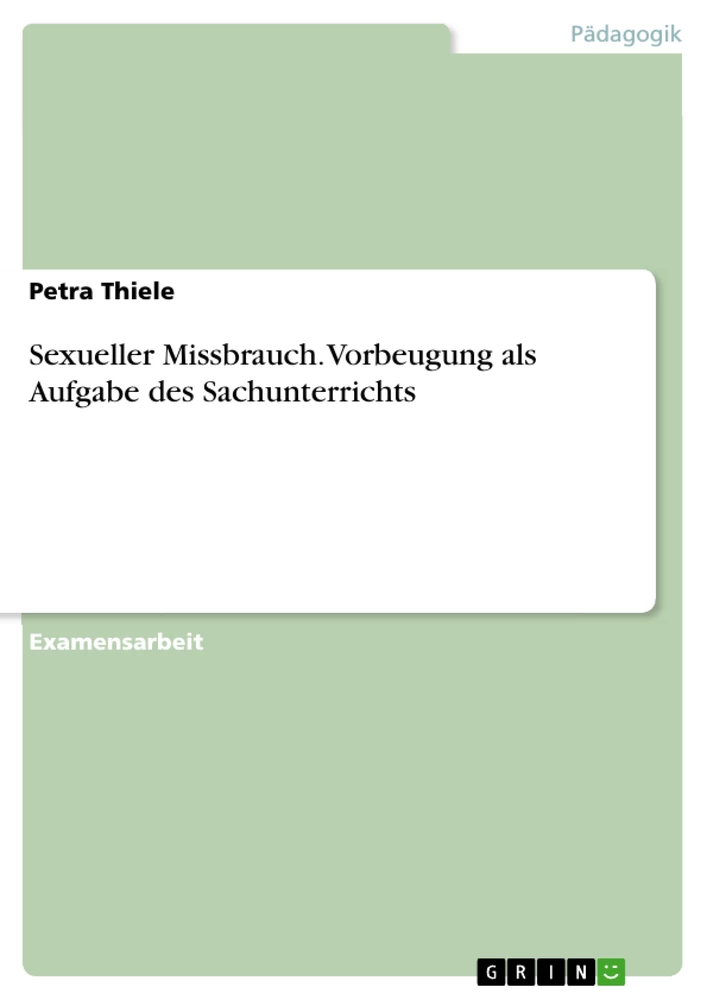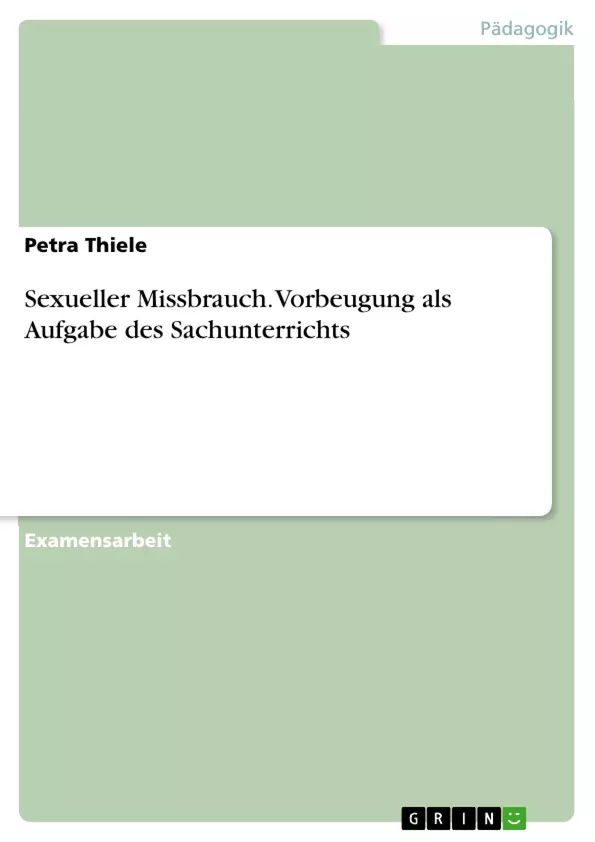Diese Arbeit soll versuchen, die in letzter Zeit durch die Medienberichte vermittelten unvollständigen und oftmals falschen Vorstellungen über Umstände und Hintergründe des sexuellen Missbrauchs zu verifizieren und hieraus Konsequenzen für eine geeignete Prävention abzuleiten.
Da die Opferzahlen und das Ausmaß stark von der zugrunde gelegten Definition des sexuellen Missbrauchs abhängen, soll zunächst versucht werden, basierend auf unterschiedlichen Studien, einen Eindruck über Definition und Erscheinungsformen des Missbrauchs zu vermitteln. Anschließend werden alters-, geschlechts- und schichtspezifische Merkmale potentieller Opfer herausgearbeitet.
Es handelt sich beim sexuellen Missbrauch nicht immer um einen einmaligen Übergriff. Die unterschiedlichen Phasen und der Ablauf des Missbrauchs sollen näher dargestellt werden.Eine nähere Erörterung der Ursachenfrage ist neben einer Thematisierung der opferbezogenen Verarbeitungs- und Abwehrmechanismen, von erheblicher Relevanz für die Präventionsarbeit.
Der zweite Teil und eigentliche Schwerpunkt dieser Arbeit ist der Prävention im Sachunterricht der Grundschule gewidmet. Untersuchungen haben ergeben, dass sich adäquate Präventionsmaßnahmen bis heute nicht immer im Grundschulalltag etablieren konnten.Die Schule als Sozialisations- und Erziehungsinstanz hat aber einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und somit eine Verantwortung zu tragen. Sie muss realisieren, dass es sich beim sexuellen Missbrauch nicht um ein marginales Problem handelt und adäquate Präventionskonzepte in den Schulalltag integrieren. Prävention muss, im Rahmen einer emanzipatorischen und im Lehrplan verankerten Sexualerziehung eine Erziehungshaltung repräsentieren, welche sich nicht auf eine kurzfristig angelegte Veranstaltung mit erhoffter immunisierender Wirkung beschränken kann.
Der zweite Teil dieser Arbeit beginnt mit der Darstellung allgemeiner Ziele und Aufgaben eines auf diesem Verständnis basierenden Sachunterrichts. Anschließend werden die drei verschiedenen Ebenen der Prävention näher beleuchtet. Darauf aufbauend sollen die Möglichkeiten und Grenzen einer schulischen Primärprävention, basierend auf zentralen Themenschwerpunkten, diskutiert werden. Hierbei wird besonders die Position der Lehrerin, sowie die Notwendigkeit einer schulischen Kooperation mit professionellen Institutionen, wie auch mit der Elternschaft herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Hintergründe und Fakten des sexuellen Missbrauchs
- 1.1 Definition
- 1.1.1 Terminologie
- 1.1.2 Verschiedenen Definitionskriterien
- 1.1.3 Grenze zwischen liebevoller Zuwendung und sexuellem Missbrauch
- 1.1.4 Erscheinungsformen
- 1.2 Häufigkeitsverteilung und Ausmaß
- 1.3 Die Opfer
- 1.3.1 Geschlechtsspezifische Verteilung
- 1.3.2 Altersspezifische Verteilung
- 1.3.3 Schichtspezifische Verteilung
- 1.3.4 Opferprofile
- 1.4 Die Täter
- 1.4.1 Geschlechtsspezifische Verteilung
- 1.4.2 Alterspezifische Verteilung
- 1.4.3 Schichtspezifische Verteilung
- 1.4.4 Bekanntschaftsgrad zwischen Täter und Opfer
- 1.4.5 Täterprofile
- 1.5 Dauer und Ablauf des sexuellen Missbrauch
- 1.5.1 Planung
- 1.5.2 Ablauf
- 1.5.3 Dauer
- 1.6 Ursachen
- 1.6.1 Gesellschaftlicher Erklärungsansatz
- 1.1 Definition
- 2. Erkennungsmerkmale und Folgen des sexuellen Missbrauchs
- 2.1 Konkrete Abwehrmechanismen
- 2.2 Unmittelbares emotionales Erleben
- 2.3 Kurz- und mittelfristige Folgen
- 2.3.1 Körperliche Folgen oder Verletzungen
- 2.3.2 Psychosomatische Folgen
- 2.3.3 Emotionale Reaktionen
- 2.3.4 Verhaltensweisen
- 2.3.5 Erkennungsmöglichkeiten anhand von Medien
- 2.4 Zwischenergebnis
- Einleitung des zweiten Teils
- 3. Prävention des sexuellen Missbrauchs als Aufgabe des Sachunterrichts
- 3.1 Aufgaben und Ziele des Sachunterrichts
- 3.1.1 Allgemeine Überlegungen zu Aufgaben, Inhalten und Zielen
- 3.1.2 Aufgaben, Prinzipien, Inhalte und Ziele des Sachunterrichts laut Lehrplan
- 3.2 Verschiedene Präventionsbegriffe
- 3.2.1 Primäre Prävention
- 3.2.2 Sekundäre Prävention
- 3.2.3 Tertiäre Prävention
- 3.1 Aufgaben und Ziele des Sachunterrichts
- 4. Schulische Primärprävention im Sachunterricht – Möglichkeiten und Grenzen
- 4.1 Entwicklung schulischer Prävention
- 4.2 Rolle der Lehrerin
- 4.3 Zentrale Themenbereiche der Prävention und deren Umsetzungsmöglichkeiten im Sachunterricht
- 4.3.1 Körperliche Selbstbestimmung
- 4.3.2 Gefühle wahrnehmen
- 4.3.3 Differenzierung zwischen unterschiedlichen Berührungen
- 4.3.4 „Nein“ sagen
- 4.3.5 Unterscheidung zwischen guten und schlechten Geheimnissen
- 4.3.6 Hilfe holen
- 4.3.7 Geschlechtsspezifische Präventionsmaßnahmen
- 4.3.8 Kritisch Beurteilung der Präventionsschwerpunkte
- 4.4 Prävention als Erziehungshaltung
- 4.5 Elternarbeit
- 4.6 Kooperation mit außerschulischen Institutionen
- 5. Schulische Sekundärprävention – Möglichkeiten und Grenzen
- 5.1 Situation der Lehrerin
- 5.2 Schulische Interventionsmöglichkeiten und –grenzen
- 5.2.1 Kontaktaufnahme zur betroffenen Schülerin bzw. zum betroffenen Schüler
- 5.2.2 Kontaktaufnahme zur Mutter
- 5.2.3 Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema sexueller Missbrauch und analysiert dessen Hintergründe, Ausprägungen und Folgen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für das Phänomen zu entwickeln und daraus konkrete Handlungsempfehlungen für die Prävention im Sachunterricht abzuleiten.
- Definition und Erscheinungsformen sexuellen Missbrauchs
- Häufigkeit und Ausmaß des sexuellen Missbrauchs
- Opferprofile und Tätermerkmale
- Folgen des sexuellen Missbrauchs für Betroffene
- Präventionsmöglichkeiten im Sachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz des sexuellen Missbrauchs als gesellschaftliches Problem. Das erste Kapitel liefert eine umfassende Analyse von Definition, Erscheinungsformen, Häufigkeit, Opfermerkmalen und Täterprofilen. Es untersucht die Ursachen des sexuellen Missbrauchs im gesellschaftlichen Kontext. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Folgen des sexuellen Missbrauchs für die Opfer und stellt verschiedene Abwehrmechanismen und Erkennungsmerkmale vor. Abschließend werden die Erkenntnisse aus den ersten beiden Kapiteln zusammengefasst und der Fokus auf die Prävention im Sachunterricht gelenkt.
Das dritte Kapitel analysiert die Aufgaben und Ziele des Sachunterrichts im Allgemeinen und im Hinblick auf die Prävention. Es stellt verschiedene Präventionsbegriffe vor und erläutert deren Bedeutung für die Arbeit mit Kindern. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die schulische Primärprävention im Sachunterricht. Es analysiert die Entwicklung schulischer Präventionsmaßnahmen, die Rolle der Lehrerin, die zentralen Themenbereiche der Prävention sowie die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Umsetzung im Sachunterricht.
Abschließend betrachtet das fünfte Kapitel die schulische Sekundärprävention und die Situation der Lehrerin bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Es untersucht die Interventionsmöglichkeiten und -grenzen sowie die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.
Schlüsselwörter
Sexueller Missbrauch, Prävention, Sachunterricht, Primärprävention, Sekundärprävention, Opfer, Täter, Folgen, Körperliche Selbstbestimmung, Gefühlswahrnehmung, Hilfe holen, Kooperation, Lehrerrolle, Schule.
- Arbeit zitieren
- Petra Thiele (Autor:in), 2004, Sexueller Missbrauch. Vorbeugung als Aufgabe des Sachunterrichts, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/48316