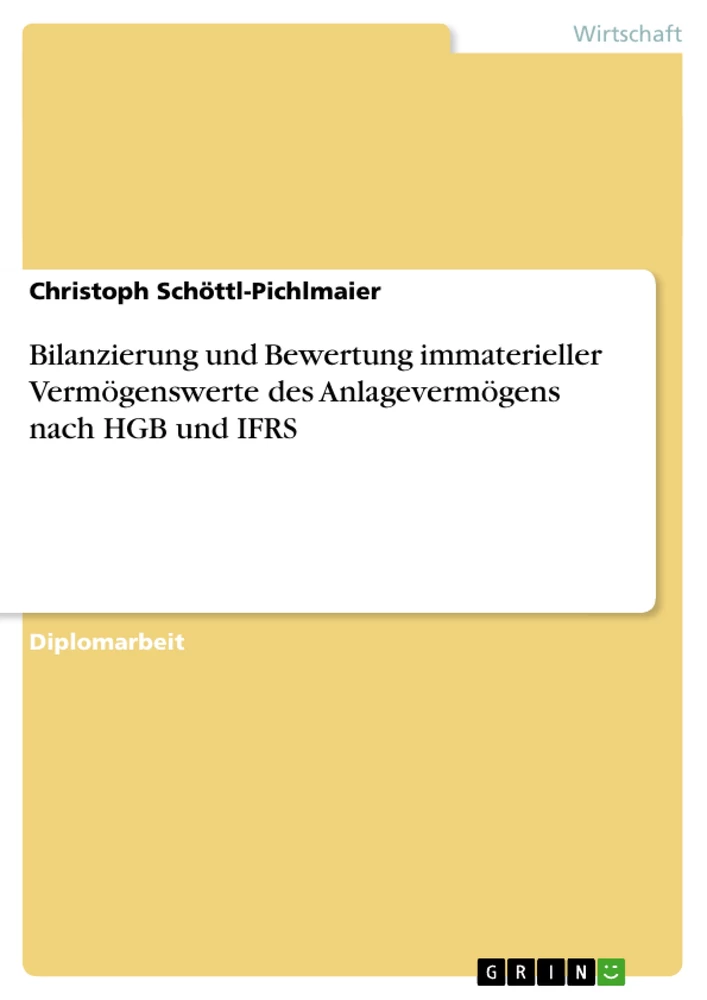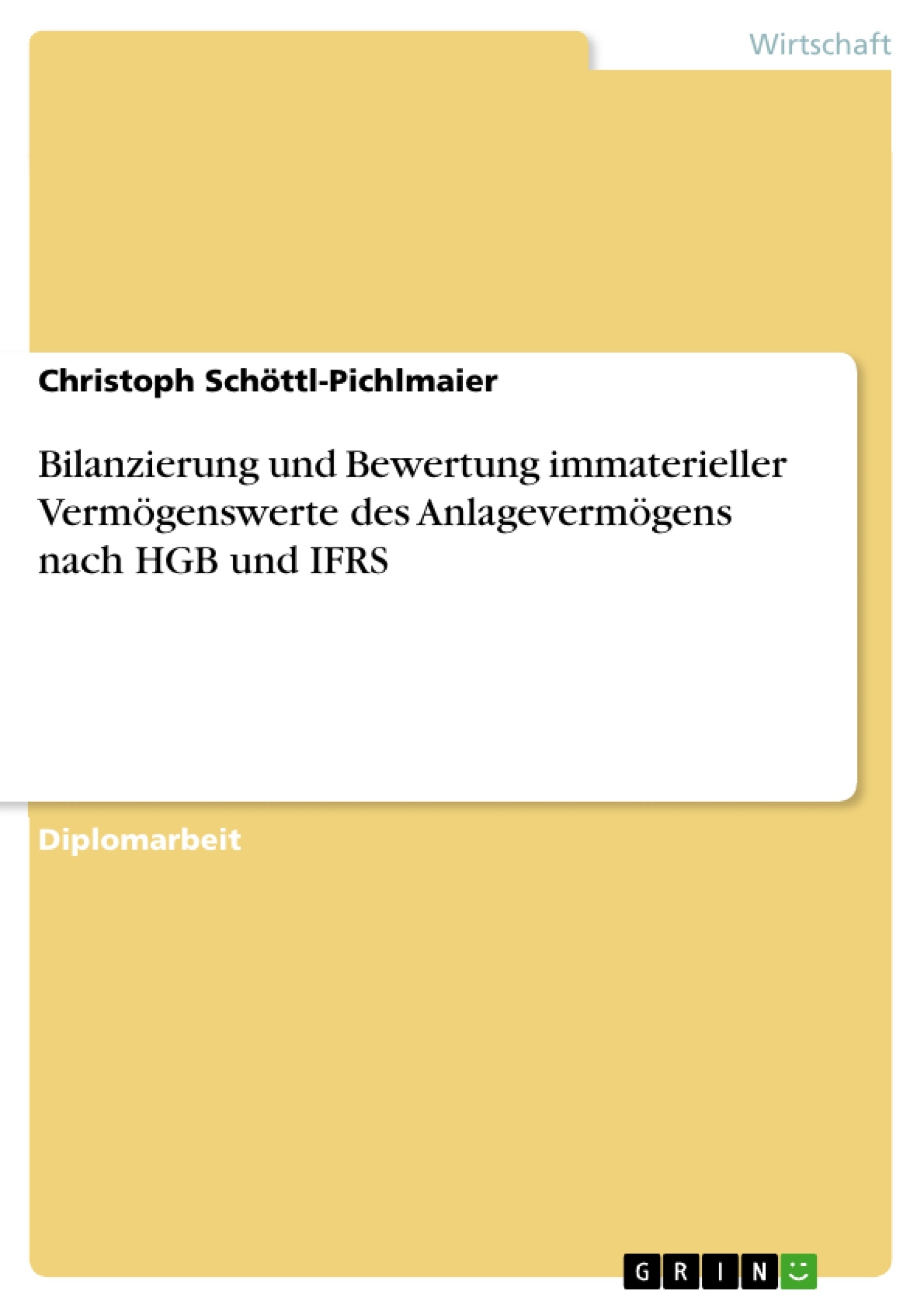Im Zuge der Entwicklung von der Agrarwirtschaft über die Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungs-, Hochtechnologie- und Wissensgesellschaft gewinnen immaterielle Vermögenswerte wie Patente, Lizenzen, Marken und Humankapital immer mehr an Bedeutung und prägen zunehmend stärker den Wert eines Unternehmens als die materiellen Vermögenswerte. 1 So beträgt zum Beispiel allein der Wert der Marke Coca Cola laut der Markenagentur Interbrand über 67 Mrd. US-$. 2 Bei einer Marktkapitalisierung von Coca Cola von derzeit ca. 100 Mrd. US-$ verkörpert also die Marke Coca Cola schon allein über die Hälfte des Marktwertes. Wenn man allerdings betrachtet, dass in der Bilanz des Geschäftsjahres 2004 von Coca Cola unter dem Posten „Trademarks with Indefinite Lives“ lediglich rund 2 Mrd. US-$ als Teil der immateriellen Vermögenswerte ausgewiesen wurden 3 , wird aus diesem Beispiel deutlich, dass dem Ansatz immaterieller Vermögenswerte häufig Grenzen gesetzt sind. Die Problematik hinsichtlich der bilanziellen Erfassung immaterieller Vermögenswerte liegt regelmäßig darin, dass sie körperlich nicht zu erfassen sind und sich ihr Wert in erster Linie nach den mit ihnen verbundenen künftigen Nutzenerwartungen richtet. Die Schätzung dieser Nutzenerwartungen ist allerdings häufig mit Schwierigkeiten verbunden, so dass die mangelnde Objektivierbarkeit der Wertbestimmung das Kernproblem bei der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte bildet, vor allem bei selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten.[...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Problemstellung
- II. Aufbau und Argumentationsfolge der Arbeit
- III. Charakterisierung immaterieller Güter
- B. Abbildung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB
- I. Bilanzierungsfähigkeit immaterieller Vermögensgegenstände
- 1. Differenzierung zwischen abstrakter und konkreter Bilanzierungsfähigkeit
- 2. Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit immaterieller Vermögensgegenstände
- 3. Konkrete Bilanzierungsfähigkeit immaterieller Vermögensgegenstände
- a. Ansatzverbot für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- b. Behandlung eines Geschäfts- oder Firmenwertes
- II. Zugangsbewertung des immateriellen Anlagevermögens
- III. Folgebewertung des immateriellen Anlagevermögens
- C. Abbildung immaterieller Vermögenswerte nach IFRS
- I. Bilanzierungsfähigkeit immaterieller Vermögenswerte
- II. Zugangsbewertung immaterieller Vermögenswerte
- III. Folgebewertung immaterieller Vermögenswerte
- D. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte des Anlagevermögens nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Rechnungslegungsstandards aufzuzeigen und kritisch zu beleuchten.
- Bilanzierungsfähigkeit immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
- Unterschiede in der Bewertung immaterieller Vermögenswerte (Zugangs- und Folgebewertung)
- Behandlung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten
- Der Geschäfts- oder Firmenwert im Kontext von HGB und IFRS
- Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Dieses einführende Kapitel beschreibt die Problemstellung der Arbeit, die sich mit der Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS beschäftigt. Es skizziert den Aufbau und die Argumentationslinie der Arbeit und charakterisiert immaterielle Güter. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen der Bilanzierung dieser Vermögenswerte aufgrund ihrer immateriellen Natur.
B. Abbildung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB: Dieses Kapitel befasst sich mit der Abbildung immaterieller Vermögensgegenstände im Handelsgesetzbuch (HGB). Es analysiert die Bilanzierungsfähigkeit, differenziert zwischen abstrakter und konkreter Bilanzierungsfähigkeit und untersucht die Behandlung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten sowie den Geschäfts- oder Firmenwert. Besonderes Augenmerk liegt auf den Ansatzbedingungen und den Bewertungsmethoden nach HGB, inklusive Zugangs- und Folgebewertung sowie planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Die Kapitelteile behandeln die rechtliche Natur des Firmenwerts detailliert und diskutieren die verschiedenen Bewertungsmethoden.
C. Abbildung immaterieller Vermögenswerte nach IFRS: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung immaterieller Vermögenswerte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Es behandelt die Bilanzierungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Kriterien der Identifizierbarkeit, Verfügungsmacht und des zukünftigen wirtschaftlichen Nutzens. Die Zugangsbewertung wird ausführlich dargestellt, inklusive der Behandlung von Einzelanschaffungen, Unternehmenszusammenschlüssen, öffentlichen Zuwendungen und Tauschgeschäften. Der Schwerpunkt der Folgebewertung liegt auf den Methoden der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, unter Berücksichtigung der Wertminderungstests und der Ermittlung des erzielbaren Betrags. Die Kapitelteile beleuchten die Unterschiede zu den HGB-Regelungen und die Herausforderungen bei der Anwendung der IFRS.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögenswerte, Bilanzierung, Bewertung, HGB, IFRS, Geschäfts- oder Firmenwert, Zugangsbewertung, Folgebewertung, Abschreibung, Anschaffungskosten, Wertminderung, Identifizierbarkeit, wirtschaftlicher Nutzen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte des Anlagevermögens nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie beleuchtet Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Rechnungslegungsstandards.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bilanzierungsfähigkeit immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS, die Unterschiede in der Bewertung (Zugangs- und Folgebewertung), die Behandlung selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte, den Geschäfts- oder Firmenwert im Kontext von HGB und IFRS sowie planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Abbildung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB, ein Kapitel zur Abbildung immaterieller Vermögenswerte nach IFRS und eine Schlussbetrachtung. Die Einführung beschreibt die Problemstellung, den Aufbau und die Argumentationslinie der Arbeit sowie die Charakterisierung immaterieller Güter. Die Hauptkapitel analysieren detailliert die Bilanzierungsfähigkeit, Bewertung und Abschreibung nach HGB und IFRS.
Was wird im Kapitel zur Abbildung immaterieller Vermögensgegenstände nach HGB behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Bilanzierungsfähigkeit nach HGB, differenziert zwischen abstrakter und konkreter Bilanzierungsfähigkeit und untersucht die Behandlung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten sowie den Geschäfts- oder Firmenwert. Es befasst sich mit Ansatzbedingungen und Bewertungsmethoden (Zugangs- und Folgebewertung), inklusive planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, und beleuchtet die rechtliche Natur des Firmenwerts und verschiedene Bewertungsmethoden.
Was wird im Kapitel zur Abbildung immaterieller Vermögenswerte nach IFRS behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die Bilanzierungsfähigkeit nach IFRS unter Berücksichtigung von Identifizierbarkeit, Verfügungsmacht und zukünftigem wirtschaftlichen Nutzen. Es beschreibt die Zugangsbewertung (Einzelanschaffungen, Unternehmenszusammenschlüsse, etc.) und die Folgebewertung mit Schwerpunkt auf planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Wertminderungstests und der Ermittlung des erzielbaren Betrags. Die Unterschiede zu den HGB-Regelungen und Herausforderungen bei der Anwendung der IFRS werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Immaterielle Vermögenswerte, Bilanzierung, Bewertung, HGB, IFRS, Geschäfts- oder Firmenwert, Zugangsbewertung, Folgebewertung, Abschreibung, Anschaffungskosten, Wertminderung, Identifizierbarkeit, wirtschaftlicher Nutzen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IFRS aufzuzeigen und kritisch zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Christoph Schöttl-Pichlmaier (Autor:in), 2005, Bilanzierung und Bewertung immaterieller Vermögenswerte des Anlagevermögens nach HGB und IFRS, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/47950