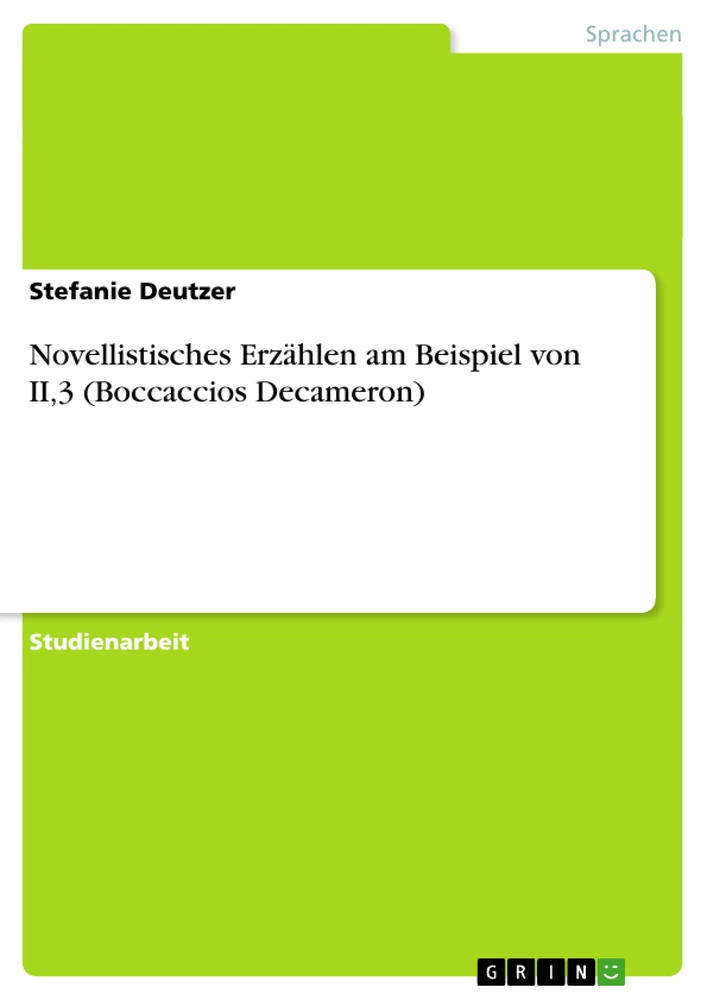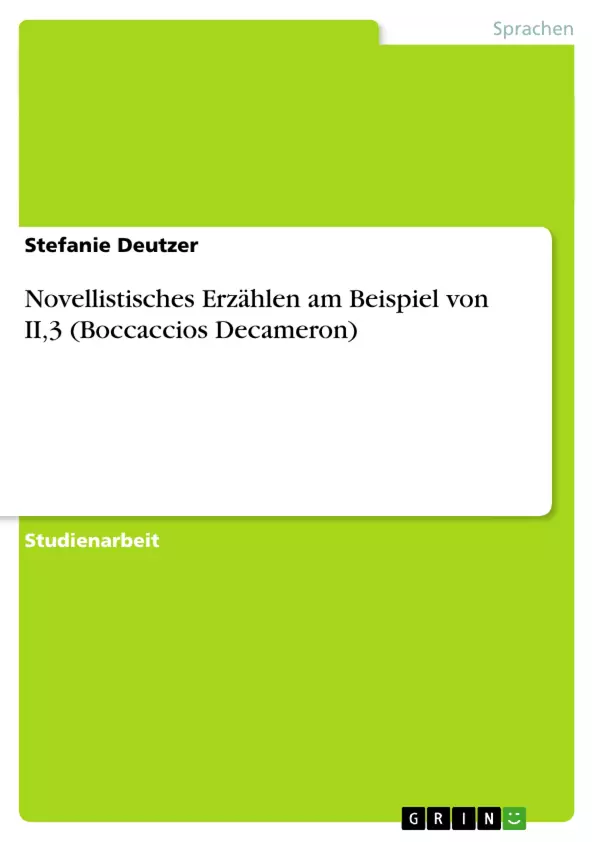Im Folgenden befasse ich mich mit Novelle II, 3 aus BoccacciosDecameron.Ich möchte an dieser Novelle beispielhaft die Grundzüge des novellistischen Erzählens festmachen. Die Quellen, von denen ich Ansätze und Gedanken der Novellentheorie übernehme, sind Werke von Degering1, Kunz2und Frau Caporello-Szykman3. Als Zusatzliteratur habe ich Werke von Elisabeth Arend4und Sergio Zatti5verwendet; dabei handelt es sich um Autoren, die das Decameron auf Einzelphänomene wie dessen Thematik, Hauptcharaktere, Komik und Stil untersucht haben. In meiner Arbeit beziehe ich mich überwiegend auf Forschungsergebnisse von Herrn Degering und Frau Caporello-Szykman, die bereits umfassende Analysen zur Novellentheorie und ihrer Anwendbarkeit auf die Novellen desDecameronvorgelegt haben. Da mir die, von Corradina Caporello-Szykman vorgenommene, Aufteilung der maßgeblichen Analysepunkte bezüglich der Novelle in Boccaccios Werk sinnvoll erscheint, habe ich ihre Standpunkte teilweise übernommen. Im Folgenden werde ich zuerst auf einige Ansätze der Novellentheorie eingehen, dann einige Merkmale der Novelle besprechen und auf die Position der von mir behandelten Novelle in der Gesamtheit desDecameroneingehen. Danach werde ich die Charakteristika einer Novelle an Novelle II, 3 desDecameronbelegen und zu guter Letzt noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen.
II Novellistisches Erzählen am Beispiel von II, 3
2.1. Herkunft und Definition einer Novelle
Den BegriffNovellekönnte man etymologisch etwa vom Italienischennovella,Neuigkeit, herleiten. Der italienische Begriff stammt jedoch ursprünglich vom Lateinischennovellus,der Diminuitivform vonnovus,kleine Neuigkeit, ab.6Tatsächlich bezeichnet man seit der Frührenaissance in Italien eine bestimmte Erzählungsgattung mit dem BegriffNovelle.Interessanterweise wurde dieser Begriff jedoch bereits zu Zeiten des römischen Kaiserreiches
[...]
1 Degering, Thomas,Kurze Geschichte der Novelle: Von Boccaccio bis zur Gegenwart,(München 1994).
2 Kunz, Josef,Theorie der Novelle,(Darmstadt 1973).
3 Caporello-Szykman, Corradina,The Boccaccian Novella,(New York 1990).
4 Arend Elisabeth, Lachen und Komik in Boccaccios Dekameron, (Göttingen 2004).Zatti, Sergio: “ Il mercante sulla ruota: la seconda giornata”, in:Introduzione al Decameron5 a cura di M. Picone e M. Mesirca,hg. von F. Cesati (Florenz 2004) 79-99.
6 Degering 1994: 7.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Novellistisches Erzählen am Beispiel von II, 3
- Herkunft und Definition einer Novelle
- Rahmenhandlung und Inhalt des Decameron
- Struktur der Novelle
- Rechtfertigung des Decameron
- Novelle II, 3
- Einordnung in der Gesamtheit des Decameron
- Zusammenführung von Novellentheorie und Novelle II, 3
- Boccaccio als Novellist
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Novelle II, 3 aus Boccaccios Decameron und versucht, an dieser Novelle die Grundzüge des novellistischen Erzählens aufzuzeigen. Dabei werden Ansätze und Gedanken der Novellentheorie aus verschiedenen Werken herangezogen und auf die Besonderheiten der Novelle II, 3 angewendet.
- Die Herkunft und Definition der Novelle
- Die Struktur und Merkmale der Novelle
- Die Position der Novelle II, 3 innerhalb des Decameron
- Die Rolle von Boccaccio als Novellist
- Die Charakteristika der Novelle II, 3 im Kontext der Novellentheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Der Text stellt die Thematik und den Umfang der Analyse vor. Es werden die wichtigsten Quellen und Autoren erwähnt, auf die sich die Analyse stützt, insbesondere die Werke von Degering, Kunz und Caporello-Szykman. Die Analyse wird sich auf die Novellentheorie konzentrieren und anhand der Novelle II, 3 aus Boccaccios Decameron die wichtigsten Merkmale und Charakteristika des novellistischen Erzählens beleuchten.
Novellistisches Erzählen am Beispiel von II, 3
Herkunft und Definition einer Novelle
Der Abschnitt beleuchtet die etymologische Herkunft des Begriffs "Novelle" und betrachtet verschiedene Theorien zur Definition der Novelle. Er stellt die Ansätze von Friedrich Theodor Vischer und Ludwig Tieck dar und versucht, anhand von gemeinsamen Merkmalen, wie beispielsweise der kürzeren Länge, einer "unerhörten" Begebenheit, einer Konflikt- bzw. Krisensituation und dem Element des Überraschenden, die Novellistik zu charakterisieren. Dabei wird auch auf den Unterschied zwischen Novelle und Roman eingegangen.
Rahmenhandlung und Inhalt des Decameron
[Der Abschnitt wird ausgelassen, da er möglicherweise wichtige Details der Rahmenhandlung und des Inhalts des Decameron enthüllen könnte.]
Struktur der Novelle
[Der Abschnitt wird ausgelassen, da er möglicherweise wichtige Details zur Struktur und Aufbau der Novelle enthüllen könnte.]
Rechtfertigung des Decameron
[Der Abschnitt wird ausgelassen, da er möglicherweise wichtige Details zur Rechtfertigung des Decameron enthüllen könnte.]
Novelle II, 3
Einordnung in der Gesamtheit des Decameron
[Der Abschnitt wird ausgelassen, da er möglicherweise wichtige Details zur Einordnung der Novelle II, 3 innerhalb des Decameron enthüllen könnte.]
Zusammenführung von Novellentheorie und Novelle II, 3
[Der Abschnitt wird ausgelassen, da er möglicherweise wichtige Details zur Analyse der Novelle II, 3 im Kontext der Novellentheorie enthüllen könnte.]
Boccaccio als Novellist
[Der Abschnitt wird ausgelassen, da er möglicherweise wichtige Details zur Rolle von Boccaccio als Novellist enthüllen könnte.]
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Novelle, Novellentheorie, Decameron, Boccaccio, Erzählweise, Struktur, Charakteristika, Konflikt, Krisensituation, Überraschung, Neuheit, imitatio, volgare.
- Quote paper
- Stefanie Deutzer (Author), 2005, Novellistisches Erzählen am Beispiel von II,3 (Boccaccios Decameron), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/47881