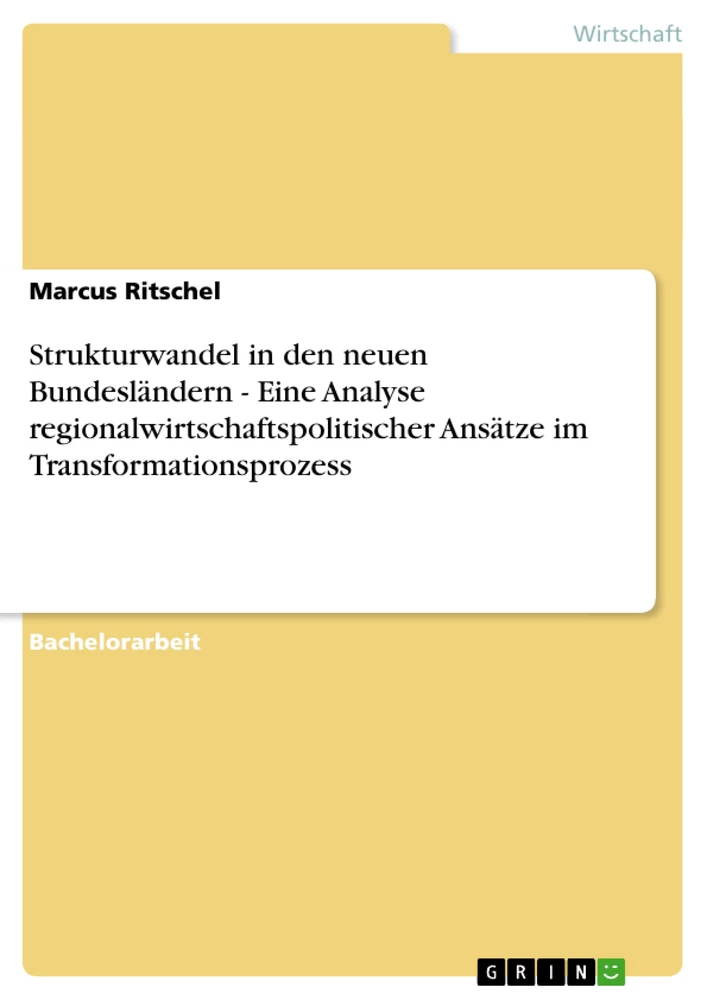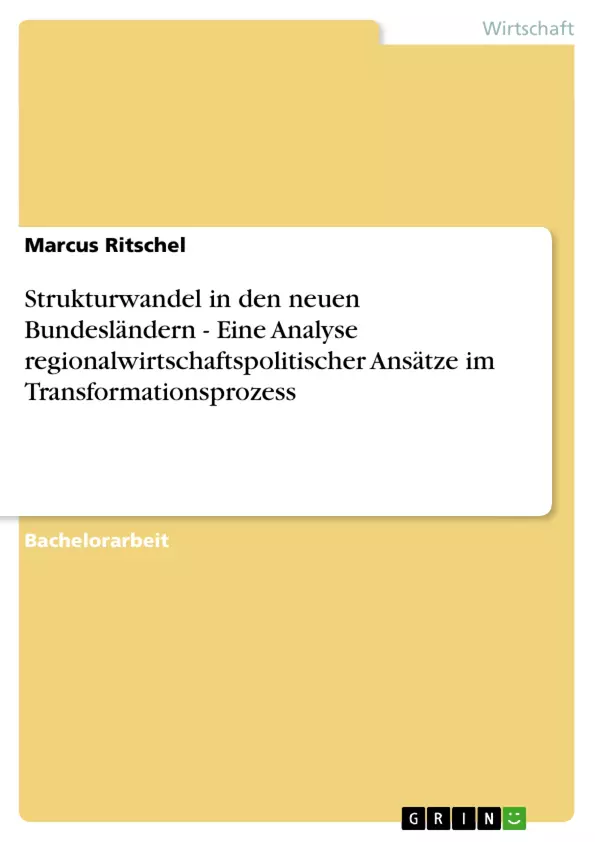Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, eine umfassende Analyse und Bewertung der gesamten Wirtschaftsförderung für die neuen Länder zu leisten. Gleichwohl sollen exemplarisch einige der wichtigsten Förderprogramme vorgestellt, analysiert und bewertet werden. Das geschieht im fünften Kapitel. Besonderes Augenmerk verdienen dabei die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und die Investitionszulage nach dem Investitionszulagengesetz. Daneben wird auf Programme zur Innovations- und Mittelstandsförderung eingegangen. Eine gesonderte Untersuchung des Förderinstrumentariums der Europäischen Union, das für die neuen Bundesländer Anwendung findet, würde den Umfang der Arbeit sprengen und erfolgt deswegen nicht. Für die Analyse der Förderinstrumente muss zuvor das theoretische Fundament gelegt werden, das als Beurteilungskriterium dienen soll. Dies geschieht im vierten Kapitel. Dazu werden die wichtigsten regionalwirtschaftspolitischen Ansätze mit ihren praktischen Implikationen vorgestellt und, soweit Studien dazu vorhanden sind, empirisch auf ihre Gültigkeit für die neuen Bundesländer hin überprüft. In diesem Zusammenhang wird auf die Neue Wachstumstheorie, die Neue Ökonomische Geografie, die Exportbasistheorie und die Wachstumspoltheorie eingegangen. Im sechsten Kapitel soll schließlich die grundsätzliche Problematik direkter Wirtschaftsförderung, vor allem wenn sie selektiv ist, verdeutlicht werden. Ordnungspolitische Bedenken werden ebenso geäußert wie Kritikpunkte, die sich aus Sicht der Public-Choice-Theorie ergeben. Alternative marktkonforme Strategien für den weiteren „Aufbau-Ost“ werden vorgeschlagen. Es soll in diesem Rahmen auch auf die Chancen eines Wettbewerbs der Regionen eingegangen werden, der sich aus einer Veränderung des institutionellen Designs ergeben könnte. Im siebenten Kapitel werden die aus den vorausgegangenen Analysen resultierenden wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen verdichtet und Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt. Erwähnung findet in diesem Zusammenhang auch der internationale Rahmen, in dem sich der „Aufbau-Ost“ bewegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ausgangssituation der neuen Bundesländer
- 2.1 Das Ende der DDR
- 2.1.1 Politische und wirtschaftliche Ursachen des Zusammenbruchs
- 2.1.2 Zusammenfassung
- 2.1.3 Wiedervereinigung und Anpassungsschock
- 2.2 Die Arbeit der Treuhandanstalt
- 2.2.1 Anfängliches Primat der schnellen Privatisierung
- 2.2.2 Späteres Primat der aktiven Sanierung
- 2.2.3 Zusammenfassung
- 3 Die ostdeutsche Wirtschaft im Transformationsprozess
- 3.1 Sektorale Produktions- und Beschäftigungsentwicklung
- 3.2 Strukturelle Gründe für den Produktivitätsrückstand
- 3.2.1 Mangel an überdurchschnittlich produktiven Wirtschaftszweigen
- 3.2.2 ungünstige Betriebsgrößenstruktur
- 3.2.3 Mangel an innovativen Wirtschaftszweigen
- 3.2.4 Mangel an exportintensiven Wirtschaftszweigen
- 3.2.5 Zusammenfassung
- 3.3 Weitere Gründe für den Produktivitätsrückstand
- 3.3.1 geringere Kapitalausstattung der Arbeitsplätze
- 3.3.2 schlechtere Infrastrukturkapitalausstattung
- 3.4 Überprüfung der Konvergenzhypothese im Lichte der neoklassischen Wachstumstheorie
- 4 Überprüfung von Strategien der regionalen Wirtschaftspolitik in den neuen Bundesländern
- 4.1 Neue Wachstumstheorie
- 4.1.1 Grundaussage
- 4.1.2 Wirtschaftspolitische Empfehlungen
- 4.1.3 Empirische Überprüfung
- 4.2 Neue Ökonomische Geografie
- 4.2.1 Grundaussage
- 4.2.2 Wirtschaftspolitische Empfehlungen
- 4.2.3 Empirische Überprüfung
- 4.3 Exportbasistheorie
- 4.3.1 Grundaussage
- 4.3.2 Wirtschaftspolitische Empfehlungen
- 4.3.3 Empirische Überprüfung
- 4.4 Wachstumspoltheorie
- 4.4.1 Grundaussage
- 4.4.2 Wirtschaftspolitische Empfehlungen
- 4.4.3 Empirische Überprüfung
- 5 Überprüfung ausgewählter Instrumente der regionalen Wirtschafts- und Strukturförderung Ost
- 5.1 Programme zur Investitionsförderung
- 5.1.1 GA „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- 5.1.2 Investitionszulage
- 5.2 Programme zur Innovationsförderung
- 5.2.1 Direkte FuE-Projektförderung (Fachprogramme)
- 5.2.2 Netzwerkprogramm „InnoRegio“
- 5.2.3 Beratungsprogramm „InnoMan“
- 5.3 Programme zur Mittelstandsförderung
- 5.3.1 ERP-Existenzgründungsprogramm
- 5.3.2 ERP-Exportfinanzierungsprogramm
- 6 Zur Problematik direkter Wirtschaftsförderung – Alternativen
- 6.1 Ordnungstheoretische Bedenken
- 6.1.1 mangelndes wirtschaftpolitisches Lenkungswissen
- 6.1.2 Notwendigkeit von Interventionsregeln
- 6.1.3 politische Rahmenbedingungen
- 6.2 Bedenken aus Sicht der Public-Choice-Theorie
- 6.2.1 Die Rolle politischer Unternehmer
- 6.2.2 Lobbyismus
- 6.3 Marktkonforme Strategien
- 6.3.1 verbesserter Kapitalmarktzugang
- 6.3.2 wachstumsorientierte Steuerpolitik
- 6.3.3 Bildungsinvestitionen
- 6.3.4 Infrastrukturinvestitionen
- 6.3.5 produktivitätsorientierte Lohnpolitik
- 6.3.6 Wettbewerb der Regionen
- 7 Resümee
- 7.1 Bestandsaufnahme
- 7.2 Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Strukturwandel in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung und analysiert dabei regionale wirtschaftspolitische Ansätze im Transformationsprozess. Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen des Strukturwandels zu beleuchten und die Effektivität verschiedener wirtschaftspolitischer Strategien zu bewerten.
- Die Herausforderungen des Strukturwandels in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung
- Die Rolle der Treuhandanstalt bei der Privatisierung und Sanierung von ostdeutschen Unternehmen
- Die Analyse verschiedener wirtschaftspolitischer Theorien und deren Anwendung im Kontext der ostdeutschen Wirtschaft
- Die Bewertung der Effektivität von Instrumenten der regionalen Wirtschafts- und Strukturförderung Ost
- Die Diskussion von marktkonformen Strategien zur Förderung des Wirtschaftswachstums in den neuen Bundesländern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 behandelt die Ausgangssituation der neuen Bundesländer nach dem Zusammenbruch der DDR. Es werden die politischen und wirtschaftlichen Ursachen des Zusammenbruchs sowie die Folgen der Wiedervereinigung und des Anpassungsschocks untersucht. Außerdem wird die Arbeit der Treuhandanstalt und deren Rolle bei der Privatisierung und Sanierung ostdeutscher Unternehmen beleuchtet.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der ostdeutschen Wirtschaft im Transformationsprozess. Es werden die sektorale Produktions- und Beschäftigungsentwicklung sowie die strukturellen Gründe für den Produktivitätsrückstand analysiert.
Kapitel 4 überprüft verschiedene Strategien der regionalen Wirtschaftspolitik in den neuen Bundesländern, wie z.B. die Neue Wachstumstheorie, die Neue Ökonomische Geografie, die Exportbasistheorie und die Wachstumspoltheorie. Für jede Theorie werden die Grundaussagen, wirtschaftspolitische Empfehlungen und empirische Überprüfungen vorgestellt.
Kapitel 5 analysiert ausgewählte Instrumente der regionalen Wirtschafts- und Strukturförderung Ost, wie z.B. Programme zur Investitionsförderung, Innovationsförderung und Mittelstandsförderung.
Kapitel 6 diskutiert die Problematik direkter Wirtschaftsförderung und stellt alternative, marktkonforme Strategien vor, wie z.B. verbesserter Kapitalmarktzugang, wachstumsorientierte Steuerpolitik, Bildungsinvestitionen und Infrastrukturinvestitionen.
Schlüsselwörter
Strukturwandel, Transformationsprozess, neue Bundesländer, regionale Wirtschaftspolitik, Treuhandanstalt, Privatisierung, Sanierung, Produktivitätsrückstand, Neue Wachstumstheorie, Neue Ökonomische Geografie, Exportbasistheorie, Wachstumspoltheorie, Investitionsförderung, Innovationsförderung, Mittelstandsförderung, Marktkonforme Strategien.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptursachen für den wirtschaftlichen Zusammenbruch der DDR?
Dazu gehörten mangelnde Innovationskraft, eine veraltete Infrastruktur, ineffiziente Produktionsprozesse und die politische Erstarrung des Systems.
Welche Rolle spielte die Treuhandanstalt im Transformationsprozess?
Die Treuhand war für die Privatisierung, Sanierung oder Stilllegung der ehemaligen Staatsbetriebe zuständig, wobei das Ziel der schnellen Privatisierung oft zu massiver Arbeitslosigkeit führte.
Warum gibt es bis heute einen Produktivitätsrückstand im Osten?
Gründe sind eine ungünstige Betriebsgrößenstruktur (wenige Großunternehmen), ein Mangel an exportintensiven Wirtschaftszweigen und eine geringere Kapitalausstattung.
Was ist die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA)?
Es ist eines der wichtigsten Förderinstrumente zur Unterstützung von Investitionen in strukturschwachen Regionen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Welche Alternativen zur direkten Wirtschaftsförderung werden diskutiert?
Vorgeschlagen werden marktkonforme Strategien wie eine wachstumsorientierte Steuerpolitik, Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie die Förderung des Wettbewerbs zwischen Regionen.
- Arbeit zitieren
- Marcus Ritschel (Autor:in), 2005, Strukturwandel in den neuen Bundesländern - Eine Analyse regionalwirtschaftspolitischer Ansätze im Transformationsprozess, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/47414