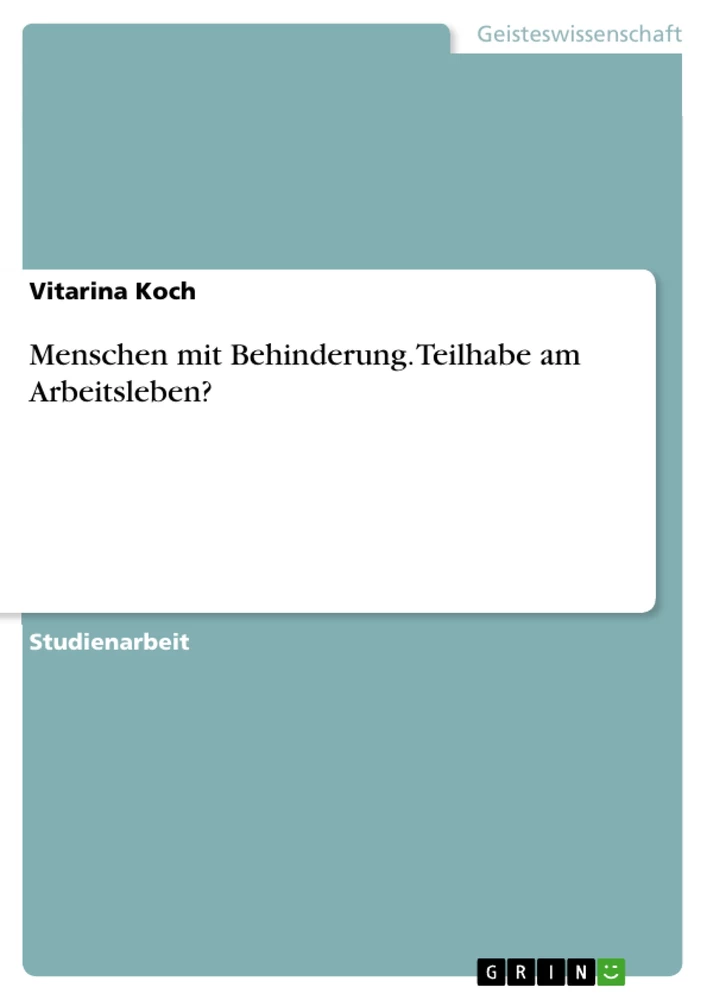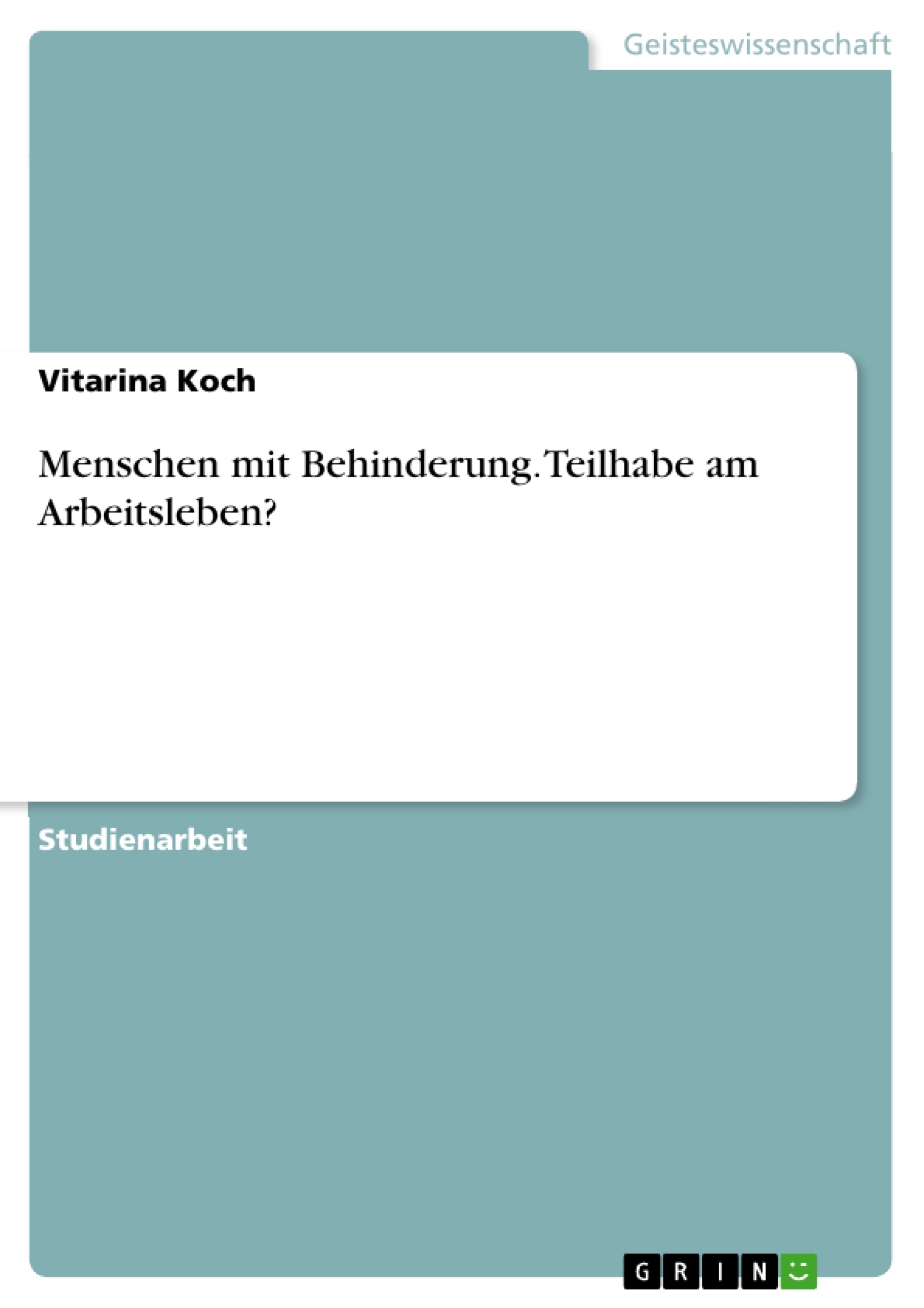Richard von Weizsäcker sagte einmal: „Was wir zu lernen haben ist so schwer und doch so einfach und klar: Es ist normal verschieden zu sein“. Richard von Weizsäcker möchte damit ausdrücken, dass die Menschen lernen sollen sich mit allen ihren Unterschieden zu akzeptieren. Es sind alles Menschen, egal ob Frau, Mann, heterosexuell, homosexuell, mit einer Behinderung oder ohne, klein, groß, schlank, dick, helle Hautfarbe oder dunkle Hautfarbe. Im Prinzip sind alle gleich und doch so unterschiedlich. Viele Menschen mit einer Behinderung haben schon selbst Diskriminierung erfahren. Trotz dessen werden viele diskriminiert. Nach Artikel 3 des Grundgesetzes darf niemand wegen seiner Behinderung, Rasse oder seines Geschlechts diskriminiert werden. Wie können Menschen mit einer Behinderung so akzeptiert und integriert werden, wie Menschen ohne eine Behinderung. Heutzutage gibt es inklusive Kindergärten, Schulen, Sportvereine, betreute Reisen für Menschen mit Behinderung, aber wie wird die Inklusion im Arbeitsleben ermöglicht? Welche Möglichkeiten hat ein Mensch mit einer Behinderung am Arbeitsleben teilzunehmen, trotz vielen Beeinträchtigungen. Welche Richtlinien hat ein Arbeitgeber, was muss er leisten, um einen Menschen mit einer Behinderung einstellen zu können.
Zu Beginn wird der Begriff Behinderung definiert, danach die rechtlichen Grundlagen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie die Unterstützungsmöglichkeiten die es gibt. Im Anschluss die Inklusionsmöglichkeiten und die Anforderungen an die Soziale Arbeit. Abschließend erfolgt noch ein Fazit über die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Behinderung
- 2.1 Aus medizinisch-juristischer Sicht
- 2.2 WHO-Klassifikation
- 2.3 Behindertensoziologische Sicht
- 3. Teilhabe am Arbeitsleben
- 3.1 Bedeutung von Arbeit
- 3.2 Sozialrechtliche Grundlagen
- 3.3 Pflichten für den Arbeitgeber
- 3.4 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 4. Unterstützungsmöglichkeiten
- 4.1 Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- 4.2 Arbeitsassistenz
- 4.3 Unterstützte Beschäftigung
- 5. Inklusionsmöglichkeiten
- 5.1 durch Berufsberatung
- 5.2 durch Jobcoaching
- 5.3 durch Integrationsfachdienste
- 6. Anforderung an die Soziale Arbeit
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die Möglichkeiten der Inklusion im Berufsleben. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Herausforderungen und Chancen der Integration von Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt zu analysieren.
- Definition von Behinderung aus verschiedenen Perspektiven
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Teilhabe am Arbeitsleben
- Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung im Berufsleben
- Inklusionsmöglichkeiten durch verschiedene Akteure
- Anforderungen an die Soziale Arbeit im Kontext der Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben dar und liefert einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition von Behinderung. Dabei werden verschiedene Perspektiven beleuchtet, darunter die medizinisch-juristische Sicht, die WHO-Klassifikation und die behindertensoziologische Sicht.
Kapitel 3 analysiert die Bedeutung von Arbeit für Menschen mit Behinderung und stellt die rechtlichen Grundlagen der Teilhabe am Arbeitsleben dar.
Kapitel 4 widmet sich den Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung im Berufsleben, wie Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Arbeitsassistenz und unterstützte Beschäftigung.
Kapitel 5 behandelt die Inklusionsmöglichkeiten, die durch Berufsberatung, Jobcoaching und Integrationsfachdienste ermöglicht werden.
Kapitel 6 beleuchtet die Anforderungen an die Soziale Arbeit im Kontext der Inklusion von Menschen mit Behinderung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Behinderung, Teilhabe am Arbeitsleben, Inklusion, rechtliche Rahmenbedingungen, Unterstützungsmöglichkeiten, Integrationsfachdienste, Soziale Arbeit, Diskriminierung und Gleichstellung.
- Arbeit zitieren
- Vitarina Koch (Autor:in), 2016, Menschen mit Behinderung. Teilhabe am Arbeitsleben?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/468234