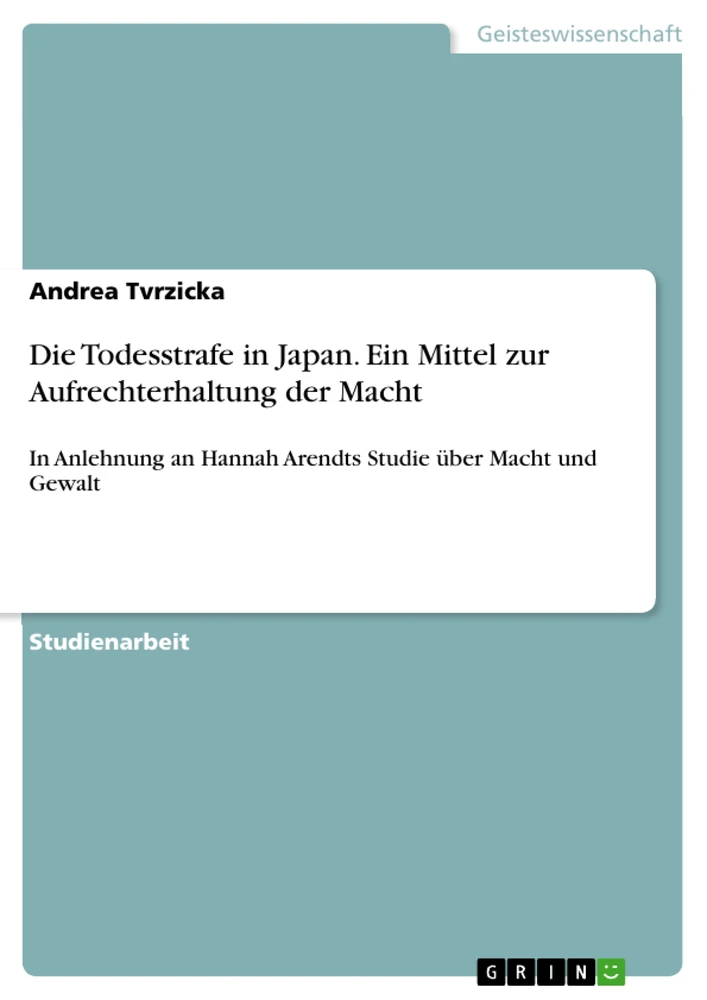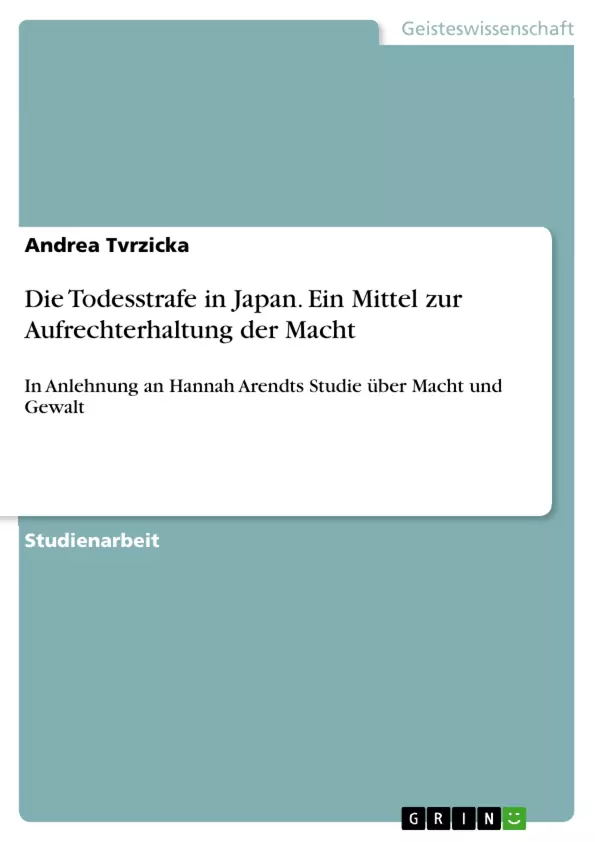Diese Arbeit thematisiert das Verhältnis zwischen Macht und Gewalt in Staaten mit Todesstrafe. Sie behandelt die Frage, inwiefern Todesstrafe als Gewaltmittel die Aufrechterhaltung der Macht in Japan beeinflusst, während der Fokus auf der Studie von Hannah Arendt liegt.
Das Ziel der Arbeit ist die Studie von Hannah Arendt vorzustellen und am Beispiel von Todesstrafe in Japan näherzubringen, um schlussendlich die Forschungsfrage zu beantworten. Im ersten Kapitel wird die Abgrenzung von Macht und Gewalt analysiert, wobei auf den Begriff Gewalt näher eingegangen wird. Weiter folgt die Beeinflussung des öffentlichen Raums durch die totalitäre Herrschaft. Zudem wird der Zweck der Todesstrafe im Allgemeinen erläutert. Der letzte Abschnitt handelt von der Todesstrafe in Japan und von ihrem aktuellen Stand.
Einerseits sind Macht und Gewalt laut Hannah Arendt zwei Gegensätze und wo das eine herrscht kann das andere nicht herrschen, andererseits ist bis heute die Todesstrafe als Mittel zur Gewaltausübung in einigen Staaten erhalten geblieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Abgrenzung von Macht und Gewalt laut Hannah Arendt
- 2.1 Gewalt im weiteren Sinne
- 3. Öffentlicher Raum unter der totalitären Herrschaft
- 4. Zwecke der Todesstrafe
- 4.1 Todesstrafe als Abschreckung
- 5. Todesstrafe in Japan
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Macht und Gewalt im Kontext der Todesstrafe in Japan, insbesondere im Lichte der Theorien Hannah Arendts. Das Ziel ist es, Arendts Unterscheidung von Macht und Gewalt zu erläutern und anhand des Beispiels Japans zu veranschaulichen, wie die Todesstrafe die Aufrechterhaltung von Macht beeinflussen kann. Die Arbeit beleuchtet dabei die komplexe Interaktion dieser beiden Konzepte.
- Hannah Arendts Unterscheidung von Macht und Gewalt
- Die Todesstrafe als Mittel der Gewaltausübung
- Der Einfluss der Todesstrafe auf die Aufrechterhaltung der Macht in Japan
- Der öffentliche Raum unter totalitärer Herrschaft
- Die historische Entwicklung der Todesstrafe in Japan
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Todesstrafe in einer Welt, in der sie von vielen Nationen abgeschafft wurde, heraus. Sie hebt Japan als eine der wenigen Industrienationen hervor, die die Todesstrafe weiterhin anwendet, und beschreibt kurz die historische Entwicklung der Todesstrafe in Japan, insbesondere den Anstieg der Hinrichtungen nach dem "Blutigen Freitag". Die Arbeit wird als Untersuchung des Verhältnisses von Macht und Gewalt im Kontext der japanischen Todesstrafe, basierend auf den Theorien Hannah Arendts, positioniert.
2. Abgrenzung von Macht und Gewalt laut Hannah Arendt: Dieses Kapitel definiert Macht und Gewalt nach Hannah Arendt. Macht wird als Ergebnis des Zusammenhalts einer Gruppe und ihrer Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln beschrieben, im Gegensatz zu Gewalt, die als instrumentelles Mittel zur Herrschaft Einzelner über andere verstanden wird. Arendt betont den Gegensatz zwischen Macht und Gewalt, wobei Macht gewaltlos und durch Rede aufrechterhalten wird, während Gewalt alle Mittel umfasst, die Rede ersetzen. Das Kapitel verdeutlicht, dass Gewalt zwar Macht zerstören, aber keine neue Macht erzeugen kann. Die unterschiedliche Legitimität von Macht und Gewalt wird ebenfalls herausgestellt.
2.1 Gewalt im weiteren Sinne: Dieser Abschnitt vertieft die Betrachtung von Gewalt und unterscheidet zwischen Machtherrschaft und Gewaltherrschaft. Gewaltherrschaft ist unabhängig von der herrschenden Meinung und beruht auf den Mitteln der Gewalt. Arendt beschreibt die Machtzerstörung durch Gewalt auf zwei Ebenen: die Zerstörung individueller Handlungsmöglichkeiten (physische und psychische Gewalt) und die Zerstörung kollektiver Handlungsmöglichkeiten, die zur Ohnmacht führt. Das Kapitel betont, dass der Einsatz von Gewalt die eigene Macht gefährdet, da sie die Handlungsfähigkeit sowohl des Einzelnen als auch der Gruppe beeinträchtigt.
Schlüsselwörter
Todesstrafe, Macht, Gewalt, Hannah Arendt, Japan, totalitäre Herrschaft, öffentlicher Raum, Gewaltherrschaft, Machtherrschaft, kollektives Handeln, Legitimität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Macht und Gewalt im Kontext der Todesstrafe in Japan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Macht und Gewalt im Kontext der Todesstrafe in Japan, insbesondere unter Berücksichtigung der Theorien Hannah Arendts. Sie beleuchtet, wie die Todesstrafe die Aufrechterhaltung von Macht beeinflussen kann und analysiert die komplexe Interaktion zwischen Macht und Gewalt in diesem Zusammenhang.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Hannah Arendts Unterscheidung von Macht und Gewalt, die Todesstrafe als Mittel der Gewaltausübung, den Einfluss der Todesstrafe auf die Aufrechterhaltung der Macht in Japan, den öffentlichen Raum unter totalitärer Herrschaft und die historische Entwicklung der Todesstrafe in Japan.
Wie definiert die Arbeit Macht und Gewalt nach Hannah Arendt?
Die Arbeit definiert Macht nach Arendt als Ergebnis des Zusammenhalts einer Gruppe und ihrer Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln. Gewalt hingegen wird als instrumentelles Mittel zur Herrschaft Einzelner über andere verstanden. Ein wichtiger Aspekt ist der Gegensatz zwischen gewaltloser Macht, die durch Rede aufrechterhalten wird, und Gewalt, die alle Mittel umfasst, die Rede ersetzen. Gewalt kann Macht zerstören, aber keine neue Macht erzeugen.
Welche Rolle spielt die Todesstrafe in der Arbeit?
Die Todesstrafe dient als Fallbeispiel, um Arendts Theorie von Macht und Gewalt zu veranschaulichen. Die Arbeit untersucht, wie die Todesstrafe als Mittel der Gewaltausübung die Aufrechterhaltung von Macht in Japan beeinflusst. Die historische Entwicklung der Todesstrafe in Japan, insbesondere der Anstieg der Hinrichtungen nach dem "Blutigen Freitag", wird ebenfalls betrachtet.
Welche Bedeutung hat der öffentliche Raum in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den öffentlichen Raum im Kontext totalitärer Herrschaft und dessen Beziehung zur Ausübung von Macht und Gewalt durch die Todesstrafe. Es wird analysiert, wie die Todesstrafe den öffentlichen Raum prägt und beeinflusst.
Was ist das Fazit der Arbeit (Zusammenfassung)?
(Der HTML-Code enthält keine explizite Zusammenfassung, sondern nur Kapitelzusammenfassungen. Ein Fazit müsste aus den Einzelkapiteln erschlossen werden. Die Arbeit zeigt die komplexe Interaktion von Macht und Gewalt im Kontext der Todesstrafe in Japan auf und analysiert diese anhand der Theorien Hannah Arendts.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Todesstrafe, Macht, Gewalt, Hannah Arendt, Japan, totalitäre Herrschaft, öffentlicher Raum, Gewaltherrschaft, Machtherrschaft, kollektives Handeln, Legitimität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Abgrenzung von Macht und Gewalt laut Hannah Arendt (inkl. Unterkapitel "Gewalt im weiteren Sinne"), Öffentlicher Raum unter der totalitären Herrschaft, Zwecke der Todesstrafe (inkl. Unterkapitel "Todesstrafe als Abschreckung"), Todesstrafe in Japan und Fazit.
- Arbeit zitieren
- Andrea Tvrzicka (Autor:in), 2019, Die Todesstrafe in Japan. Ein Mittel zur Aufrechterhaltung der Macht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/467915